Nietzsche POParts
Sind nicht Worte und Töne
Regenbogen und Schein-Brücken
zwischen Ewig-Geschiedenem?
Nietzsche
POP
arts
Nietzsche

Sind

nicht

Worte


und

Töne
Regenbogen
POP

und

Scheinbrücken

zwischen

Ewig-

Geschiedenem
arts

Zeitgemässer Blog zu den Erkenntnissen Friedrich Nietzsches
Artikel
_________
Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts?
Ein Essay im Geiste Nietzsches
Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts?
Ein Essay im Geiste Nietzsches
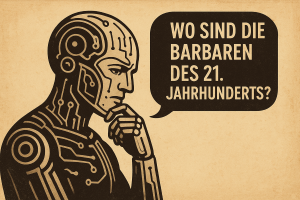
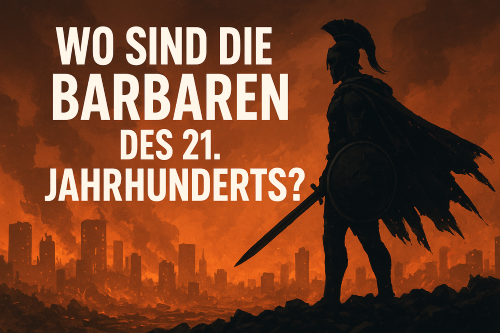
Am 25. August veröffentlichten wir ein Interview, das unser Autor Paul Stephan mit dem KI-Tool Chat GPT geführt hatte (Link). Darin bat er es unter anderem, ihm ein Essay zur Preisfrage des diesjährigen Eisvogel-Preises „Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts?“ (Link) zu schreiben. Wir legten den Text probehalber der fünfköpfigen Jury des Preises, bestehend aus Lukas Meisner, Hans-Martin Schönherr-Mann, Theodor Schild, Natalie Schulte und Paul Stephan selbst vor – und er kam überraschend gut an: In der Vorrunde erreichte er den vierten Platz nach Punkten und hätte es somit um ein Haar in die engere Auswahl geschafft. Nur Natalie Schulte hatte Verdacht geschöpft und den Text einer Prüfungssoftware vorgelegt, die allerdings nicht ausschlug. – Hätten Sie den Text für menschlich gehalten?
In den kommenden Wochen werden dann die Essays der diesjährigen Sieger erscheinen. Ob Sie es, wie wir glauben, besser gemacht haben als die KI?
Wir verzichteten bewusst auf ein Lektorat des Textes, sondern publizieren ihn genau so, wie das Programm ihn uns ausspuckte. Auch das Artikelbild stammt von ihm.
1. Einleitung: Die Frage nach den kommenden Menschen
Friedrich Nietzsche war ein Denker der Schwellen, der Übergänge, der Erschütterungen. Seine Philosophie richtet sich nicht an die Besitzstandswahrer, sondern an die Verheißung eines anderen Menschen. Nicht zufällig fragt er in einem seiner späten Fragmente: "Wo sind die Barbaren des 20. Jahrhunderts?" Diese Frage ist weit mehr als kulturkritische Polemik. Sie ist ein Ausdruck seiner tiefen Unzufriedenheit mit der europäischen Kultur seiner Zeit, die er als dekadent, satt und erschöpft empfand. "Barbaren" meint bei Nietzsche gerade nicht die Rückfälligen, sondern die, die bereit sind, das Alte zu zerstören, um Neues möglich zu machen. Es sind nicht die Zivilisationsbrecher, sondern die Zivilisationsüberwinder.
Heute, 125 Jahre nach Nietzsches Tod, stellt sich diese Frage erneut, ja dringlicher denn je: Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts? Und vor allem: Wie müssten sie beschaffen sein, um dem Geist Nietzsches zu entsprechen?
2. Der falsche Barbar: Populismus, Gewalt, Regression
Die Versuchung ist groß, die Barbaren in den politischen Rändern oder Extremen zu suchen: in Autokraten, Demagogen, Krawallmachern. Tatsächlich inszenieren sich viele von ihnen als "Systemsprenger", als "Gegner der Eliten" oder als Retter einer wie auch immer gearteten Ursprünglichkeit. Doch Nietzsche wäre kaum mit ihnen ins Bündnis getreten. Er war kein Freund der Masse, kein Apologet von Ressentiment, kein Verteidiger des dumpfen "Volkswillens". Im Gegenteil: Er war ein elitärer Denker, wenn auch nicht im Sinne sozialer Herkunft, sondern geistiger Unbestechlichkeit.
Der Barbar, den Nietzsche ersehnt, handelt nicht aus Hass, sondern aus Überfluss. Er zerstört nicht aus Frustration, sondern aus Schöpfungskraft. Die völkischen, autoritären Bewegungen unserer Gegenwart sind aus dieser Perspektive keine Barbaren, sondern Regressionsphänomene. Sie wollen nicht Neues schaffen, sondern Altes restaurieren. Sie sind nicht am Werden interessiert, sondern an der Wiederherstellung eines imaginierten Gestern.
3. Die Erschöpfung der Werte
Nietzsche diagnostizierte den "Tod Gottes" als das Ende einer metaphysischen Ordnung, die jahrhundertelang das westliche Denken prägte. Dieser Tod war für ihn kein Grund zur Trauer, sondern eine Herausforderung: Die alten Werte haben ihre Verbindlichkeit verloren, und nun liegt es am Menschen selbst, neue zu schaffen. Doch genau an diesem Punkt hält die Gegenwart inne. Der "letzte Mensch", den Nietzsche in der Vorrede zu Also sprach Zarathustra karikiert, hat sich breitgemacht: bequem, sicherheitsorientiert, ironisch, abgeklärt. Die Möglichkeit des radikal Neuen wird als Risiko empfunden, nicht als Verheißung.
In einer Kultur der ständigen Selbstoptimierung, der Digitalisierung des Lebens und der moralischen Hyperüberwachung ist kaum Raum für das, was Nietzsche das "Chaos" nannte, aus dem ein tanzender Stern geboren werden kann. Alles ist geregelt, vermessen, bewertet. Aber nichts wird mehr gewagt.
4. Die wahren Barbaren: Schöpfer der Zukunft
Nietzsches Barbaren sind Gestalten des Aufbruchs. Sie kommen "aus der Zukunft" und bringen etwas mit, das sich der Gegenwart noch entzieht: neue Werte, neue Perspektiven, neue Möglichkeiten des Lebens. Dabei darf man sich diese neuen Menschen nicht als Superhelden oder Genies vorstellen. Vielleicht sind sie exzentrisch, vielleicht marginalisiert. Vielleicht handeln sie gar nicht laut, sondern beharrlich. Aber sie eint ein Zug: die radikale Abkehr vom Hergebrachten.
Man wird sie nicht in Talkshows finden, nicht in Parteiprogrammen, nicht in Influencer-Videos. Sie lassen sich nicht integrieren, weil ihr Denken jenseits des Integrierbaren liegt. Vielleicht sind es Künstler, die sich bewusst der Verwertung entziehen. Vielleicht Philosophen, die keine Wahrheit verkünden, sondern Denkbewegungen provozieren. Vielleicht auch Einzelgänger, die neue Formen von Gemeinschaft, Arbeit, Intimität erproben, ohne ideologische Vorgaben.
Ihre Barbarei besteht nicht in Gewalt, sondern in Unbeugsamkeit. Nicht in Zerstörung, sondern in Geburt.
5. Was heißt: Barbare sein?
Barbar zu sein heißt im 21. Jahrhundert: nicht mitzuspielen. Es heißt, sich der Dauerbeobachtung, dem digitalen Konformismus, dem moralischen Rigorismus zu entziehen. Es heißt, – wie Nietzsche es fordert –, "der Versuchung der Zeit widerstehen, sich ihr nicht unterwerfen". Ein Barbar denkt quer, nicht weil es Trend ist, sondern weil er anders sieht. Er lebt nicht außerhalb der Gesellschaft, aber auch nicht in ihr – sondern jenseits ihrer Selbstverständlichkeit.
Die Barbaren können auch Leser Nietzsches sein, wenn sie ihn nicht als Heiligen verehren, sondern als Sprengmeister. Wenn sie seinen Hammer nicht zum Zerschlagen anderer, sondern zur Prüfung ihrer eigenen Idole verwenden.
6. Ausblick: Das Unverhörte denken
"Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können" – dieses oft bemühte Nietzsche-Zitat ist kein poetischer Schmuck, sondern eine Kampfansage gegen die Saturiertheit unserer Kultur. Der Chaosbegriff ist bei Nietzsche nie nihilistisch. Er meint das Offene, das Werdende, das Noch-nicht-Festgelegte. Der Barbar ist derjenige, der diesen Zustand nicht fürchtet, sondern pflegt.
Wo also sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts? Vielleicht sind sie noch nicht sichtbar. Vielleicht sind sie noch in sich gekehrt. Vielleicht lesen sie gerade diesen Text. Was sie aus ihm machen, wird zeigen, ob sie wirklich Barbaren sind – oder doch nur Nachlassverwalter der Moderne.
Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts?
Ein Essay im Geiste Nietzsches
Am 25. August veröffentlichten wir ein Interview, das unser Autor Paul Stephan mit dem KI-Tool Chat GPT geführt hatte (Link). Darin bat er es unter anderem, ihm ein Essay zur Preisfrage des diesjährigen Eisvogel-Preises „Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts?“ (Link) zu schreiben. Wir legten den Text probehalber der fünfköpfigen Jury des Preises, bestehend aus Lukas Meisner, Hans-Martin Schönherr-Mann, Theodor Schild, Natalie Schulte und Paul Stephan selbst vor – und er kam überraschend gut an: In der Vorrunde erreichte er den vierten Platz nach Punkten und hätte es somit um ein Haar in die engere Auswahl geschafft. Nur Natalie Schulte hatte Verdacht geschöpft und den Text einer Prüfungssoftware vorgelegt, die allerdings nicht ausschlug. – Hätten Sie den Text für menschlich gehalten?
In den kommenden Wochen werden dann die Essays der diesjährigen Sieger erscheinen. Ob Sie es, wie wir glauben, besser gemacht haben als die KI?
Wir verzichteten bewusst auf ein Lektorat des Textes, sondern publizieren ihn genau so, wie das Programm ihn uns ausspuckte. Auch das Artikelbild stammt von ihm.
Nietzsche und die Philosophie der Orientierung
Im Gespräch mit Werner Stegmaier
Nietzsche und die Philosophie der Orientierung
Im Gespräch mit Werner Stegmaier
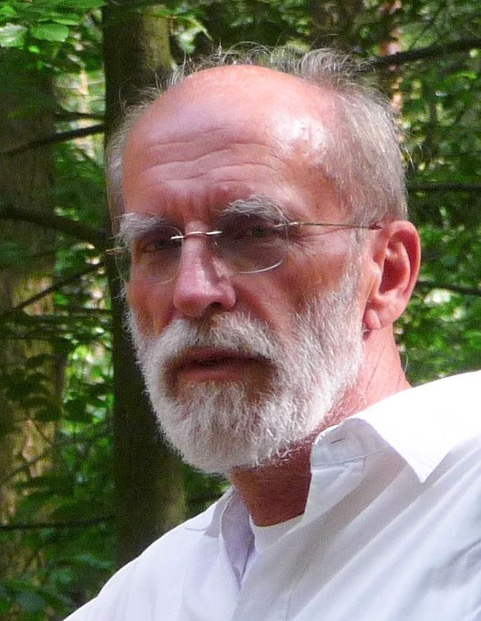
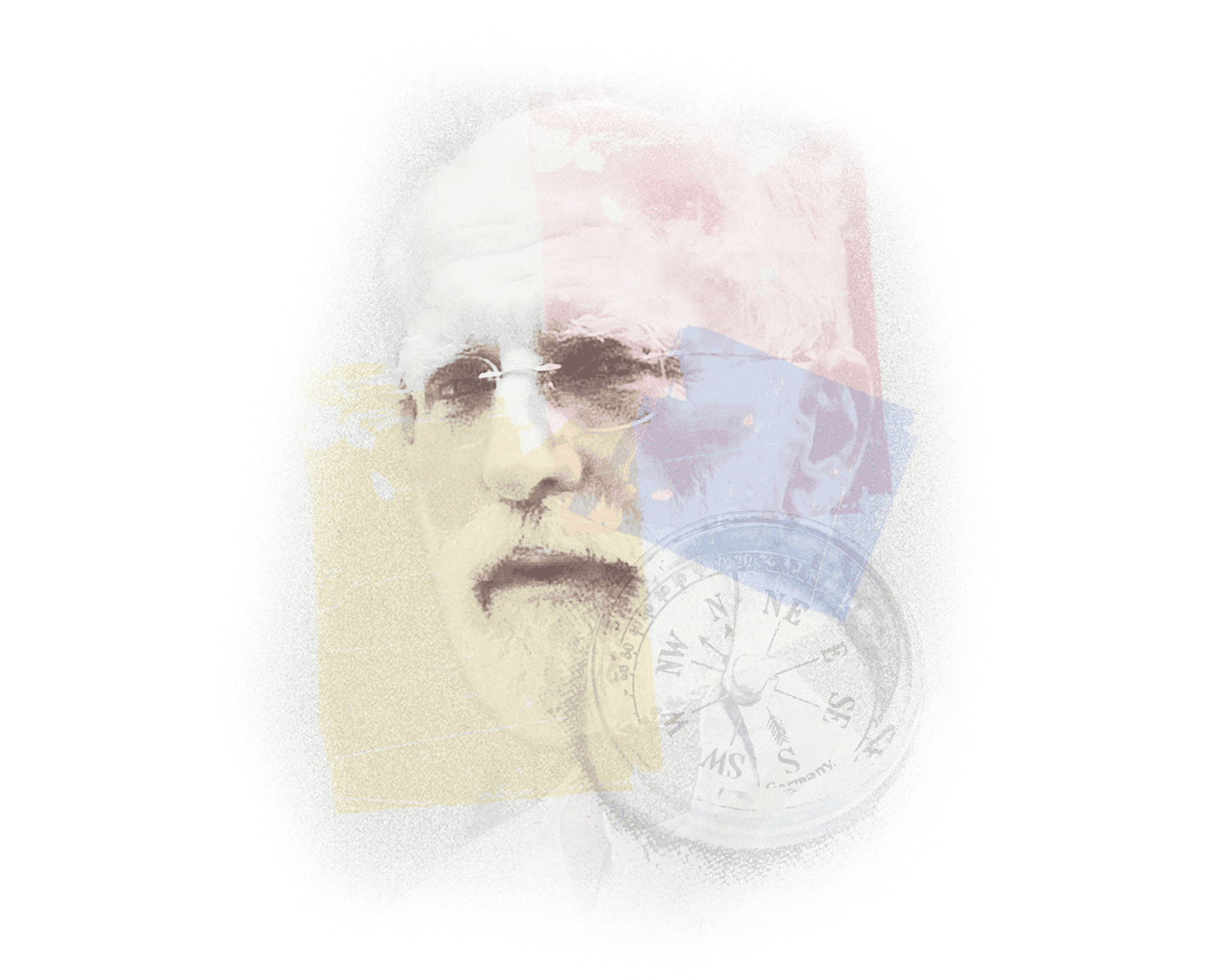
Anlässlich des 125. Todestags von Nietzsche am 25. August unterhielten wir uns mit zwei der international anerkanntesten Nietzsche-Experten, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier. Während sich das Gespräch mit Sommer (Link) vor allem um Nietzsches Leben drehte, sprachen wir mit letzterem über sein Denken, dessen Aktualität und Stegmaiers eigene „Philosophie der Orientierung“. Was sind Nietzsches zentrale Einsichten? Und inwiefern helfen sie uns dabei, uns in der Gegenwart zurechtzufinden? Was bedeutet sein Konzept des „Nihilismus“? Und was sind die politischen Implikationen seiner Philosophie?
I. Nietzsche und der Nihilismus
Paul Stephan: Sehr geehrter Herr Professor Stegmaier, es ist wohl keine Übertreibung, Sie als eine Koryphäe der philosophischen Nietzsche-Forschung zu bezeichnen. Neben zahllosen Aufsätzen haben Sie insbesondere eine äußerst lesenswerte Junius-Einführung in das Denken Nietzsches verfasst, die man in englischer Übersetzung kostenlos hier herunterladen kann, sowie eine umfangreiche Interpretation des so wichtigen fünften Buches der Fröhlichen Wissenschaft (Nietzsches Befreiung der Philosophie, 2011), die Studie Orientierung im Nihilismus. Luhmann meets Nietzsche (2016), eine kostenlos im Internet verfügbare Aufsatzsammlung mit dem Titel Europa im Geisterkrieg. Studien zu Nietzsche (2018, Link) und eine Interpretation seines Nachlasses (Nietzsche an der Arbeit, 2022) – um nur die vielleicht wichtigsten zu nennen. Hinzu kommen noch zahllose von Ihnen edierte Sammelbände. Nicht zuletzt waren Sie 18 Jahre lang der leitende Herausgeber der wichtigen Fachzeitschrift Nietzsche-Studien und der Schriftenreihe Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung. Wenn Sie auf all die Jahre Ihrer „Beschäftigung“, sofern das Wort nicht untertrieben ist, mit Nietzsche zurückblicken: Was scheint Ihnen seine zentrale Einsicht zu sein? Was ist die wesentliche Lektion, die man bei der Lektüre von Nietzsches Schriften – die sich, wie Sie selbst in der Einleitung Ihrer erwähnten Einführung in sein Denken schreiben, leicht lesen lassen, aber nur schwer zu verstehen sind – lernen kann und lernen sollte?
Werner Stegmaier: Nietzsches mutigste und zentrale Einsicht war, scheint mir, dass der Nihilismus, nach dem es mit den scheinbar höchsten Werten und allen absoluten Gewissheiten nichts ist, ein „normaler Zustand“ ist, wie er zuletzt noch eine lange Aufzeichnung dazu überschrieb mit doppelter Unterstreichung.1 Da ist auch nichts, wie vor allem Heidegger meinte, zu überwinden. Nach Nietzsche hat sich der Nihilismus des Christentums und der Metaphysik, für die es mit den wirklich lebenswerten Werten nichts auf sich hatte, dadurch selbst überwunden, dass sie mit ihrem asketischen Ideal einen Wahrheitssinn heranzüchteten, der sich schließlich gegen sie selbst wandte und sie unglaubwürdig machte. Diese Einsicht hat ungeheuer befreiend gewirkt. Nach Nietzsche haben in der „Umwertung aller Werte“, die nun anstand, alle selbst zu entscheiden, welche Werte sie hochhalten wollen, und in der Philosophie konnte man, wenn man seinerseits mutig genug dazu war, mit allem neu anfangen, in den Inhalten ebenso wie in den Formen. Wir leben bis heute davon.
PS: Nietzsche sieht den Nihilismus ohne Zweifel als große Chance an, als notwendiges Durchgangsstadium einer neuen Kultur. Doch nicht ebenso als Gefahr, als Verlust an Orientierung in einer Welt, die keine objektiven Orientierungen mehr zu bieten hat? Ich denke da nur an Nietzsches vielleicht berühmtesten Aphorismus, den 125. der Fröhlichen Wissenschaft.
WS: Ja, da lässt Nietzsche einen „tollen Menschen“ – im damaligen Sinn einen Verrückten – hinausschreien: „Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen! Wir haben ihn getödtet, – ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder!“, ihn zugleich jedoch auch fragen:
Aber wie haben wir diess gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was thaten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an?
Dieser tolle Mensch beschwört in räumlichen Metaphern eine neue und vollkommene Orientierungslosigkeit in einem unendlichen Nichts, in dem man sich an nichts mehr halten kann. Zu Beginn des V. Buches der Fröhlichen Wissenschaft, das Nietzsche fünf Jahre später hinzufügte, nimmt er im eigenen Namen das „grösste neuere Ereigniss, – dass ,Gott todt ist‘,“ präzisierend so wieder auf, „dass der Glaube an den christlichen Gott unglaubwürdig geworden ist“, und malt, wonach Sie fragen, eine „lange Fülle und Folge von Abbruch, Zerstörung, Untergang, Umsturz“ aus, die nun mit dem Nihilismus bevorstehe, „eine Verdüsterung und Sonnenfinsterniss, deren Gleichen es wahrscheinlich noch nicht auf Erden gegeben hat“2. Wenig später fügt er in der berühmten Lenzerheide-Aufzeichnung, in der er seine Einschätzung des Nihilismus zu überblicken und zu ordnen versucht, hinzu, es werde ein „Wille zur Zerstörung“ und „Selbstzerstörung“ aufkommen, mit dem die nun Rat- und Orientierungslosen sich ihre „Henker selbst züchten“ würden,3 und damit konnte man dann leicht die Deutschen und die Russen sowie ihre Führer Adolf Hitler und Josef Stalin identifizieren. Für Nietzsche, der so etwas ahnen mochte, aber natürlich nicht voraussehen konnte, war das nur eine „Crisis“, die „reinigen“ und zu von Grund auf neuen gesellschaftlichen Verhältnissen führen würde. Für Philosophen wie ihn aber werde sie „eine neue schwer zu beschreibende Art von Licht, Glück, Erleichterung, Erheiterung, Ermuthigung, Morgenröthe“ bringen. Da komme in ihm eine große „Dankbarkeit“ auf, dass nun „der Horizont wieder frei“ werde, „jedes Wagniss des Erkennenden wieder erlaubt“ sei und „das Meer, unser Meer“ wieder offen daliege. Für Nietzsche stand die Philosophie nicht über dem Weltgeschehen als bloße Theorie, sondern war unmittelbar in es eingebunden, so wie jede Orientierung in es eingebunden ist, weil sie immer einen Standpunkt in ihm hat und es selbst auch beeinflusst. Nietzsche glaubte daran, dass die Philosophie dem Weltgeschehen neue Ziele setzen und Wege bahnen kann, und seine Philosophie hat das vielleicht tatsächlich auch getan.
PS: Welche neuen Ziele und Wege haben Sie da vor Augen?
WS: Nietzsche legte sie denkbar groß an: Der Nihilismus wird die (europäische) Menschheit, nahm er an, zu einer Höherentwicklung befreien, sie aus der Fesselung der asketischen Ideale des Christentums lösen, so dass sie ihre realen und starken Möglichkeiten neu entfalten kann. Das heißt nicht, wie jetzt manche ‚Transhumanisten‘ meinen, dass alle Übermenschen werden sollten.4 Man solle nur nicht annehmen, die Menschheit hätte ihr Ziel schon erreicht, wenn sie jene Ideale erfüllte, und der „letzte“, nun definitiv festgestellte Mensch könne sich in seinem Glück sonnen. Der Mensch ist, nach einer berühmten Formulierung Nietzsches, „das noch nicht festgestellte Thier“5, das gar nicht anders kann, als sich weiterzuentwickeln und das aufgrund seiner außerordentlichen intellektuellen Fähigkeiten viel schneller als andere Tiere. Für Nietzsche kann das dennoch nur auf evolutionärem Weg, durch ständige Auseinandersetzung der Individuen untereinander geschehen. Evolution produziert für ihn einen ungeheuren Reichtum an Varianten, und für eine Höherentwicklung komme es dann auf die besonders „gelungenen Fälle“ (ebd.) an. Sie blieben immer Ausnahmen, die sich aber kaum hervorwagen könnten, solange alle, entsprechend dem alten „‚Gleich vor Gott‘“ (ebd.), möglichst in allem gleich sein und darum auch definitiv gleichgestellt werden sollen. So werde „der Typus ‚Mensch‘ auf einer niedrigeren Stufe“ (ebd.) festgehalten, und die großen Probleme, die nun anstünden, nämlich zuallererst „bessere Bedingungen für die Entstehung der Menschen, ihre Ernährung, Erziehung, Unterrichtung schaffen, die Erde als Ganzes ökonomisch verwalten, die Kräfte der Menschen überhaupt gegen einander abwägen und einsetzen“6, könnten so nicht erfolgversprechend angegangen werden. Stattdessen müssten „die abgeschlossenen originalen Volks-Kulturen“7 überwunden, „eine alle bisherigen Grade übersteigende Kenntnis der Bedingungen der Cultur als wissenschaftlicher Maassstab für ökumenische Ziele“8 erreicht werden, die die ganze Erde umspannen, und dazu zuerst einmal Europa, das Nietzsche hier noch in einer Führungsrolle sieht, vereinigt und den Juden9 dabei ihre wegweisende Rolle zugestanden werden. Für „eine solche bewusste Gesammtregierung“10 der Erde brauche es „höhere Menschen“, die mit überlegener Orientierung neue Ziele für die Welt im Ganzen setzen könnten. Und Nietzsche hatte wohl einen irrlichternden Weltpolitiker wie Kaiser Wilhelm II., aber noch nicht die weltweite Umweltzerstörung durch die Industrialisierung, die Gefahr atomarer Weltkriege und die inzwischen explosive, extreme Reichtumsverteilung vor Augen, mit der wir, neben vielen anderen globalen Problemen, konfrontiert sind. Dagegen erscheine „[d]ie ältere Moral, namentlich die Kant’s, [die] vom Einzelnen Handlungen [verlangt], welche man von allen Menschen wünscht“ (ebd.), nun als „eine schöne naive Sache“ (ebd.): „[A]ls ob ein Jeder ohne Weiteres wüsste, bei welcher Handlungsweise das Ganze der Menschheit wohlfahre, also welche Handlungen überhaupt wünschenswerth seien“ (ebd.). Nietzsche pflegte in solchen Zusammenhängen oft noch eine Sprache, die später durch die Nazis kontaminiert wurde, und verschärfte sie aggressiv, je weniger man ihn hören wollte. Das sollte über seine Weitsicht aber nicht hinwegtäuschen.
II. Nietzsches Politik
PS: Ich sehe bei diesem Aspekt der Philosophie Nietzsches eine große Nähe zum Marxismus. Es gibt da auch eine bemerkenswerte Stelle in Ecce homo, wo er sein Programm wie folgt resümiert:
Meine Aufgabe, einen Augenblick höchster Selbstbesinnung der Menschheit vorzubereiten, einen grossen Mittag, wo sie zurückschaut und hinausschaut, wo sie aus der Herrschaft des Zufalls und der Priester heraustritt und die Frage des warum?, des wozu? zum ersten Male als Ganzes stellt –, diese Aufgabe folgt mit Nothwendigkeit aus der Einsicht, dass die Menschheit nicht von selber auf dem rechten Wege ist, dass sie durchaus nicht göttlich regiert wird, dass vielmehr gerade unter ihren heiligsten Werthbegriffen der Instinkt der Verneinung, der Verderbniss, der décadence-Instinkt verführerisch gewaltet hat.11
Wobei man da sogar an die UNO denken könnte. Während der Unterschied doch vielleicht darin besteht, dass Nietzsche diese „bewusste Gesammtregierung“ ja nicht gerade demokratisch konzipiert. Doch vielleicht ist das auch einfach realistisch und solche umfassenden sozialen und kulturellen Reformen müssen von kleinen Avantgarden angestoßen werden. Trotz seines Anspruchs war ja auch der Marxismus in seiner konkreten Umsetzung in der Praxis ironischerweise näher bei Nietzsche als bei Marx in dieser Hinsicht; und auch die UNO wird von vielen als elitär und ‚abgehoben‘ wahrgenommen. Denken Sie, man müsste angesichts der zahlreichen fundamentalen Menschheitsprobleme, mit denen wir in der Tat gegenwärtig konfrontiert sind, an dieses ‚elitäre‘ Modell sozialer Transformation offenherziger anknüpfen? Oder ließe sich eine radikale Transformation auch demokratischer gestalten, als es bei Nietzsche anklingt?
WS: Die in der Tat herausragende Stelle aus Ecce homo umschreibt noch einmal in Begriffen der Morgenröthe, der sie gilt, was Nietzsche später ‚Nihilismus‘ nennt: die Notwendigkeit einer gänzlichen Neuorientierung der Philosophie, nachdem sich die metaphysisch-christlich-priesterlichen obersten Werte als von Grund auf haltlos erwiesen haben. Die Menschheit muss sich nun darauf besinnen, dass nicht eine höhere Macht ihr Ziele vorgibt, sondern dass sie sich selbst Ziele setzen muss, wenn sie nicht sinnlos herumirren will. Statt ‚Nihilismus‘ zieht Nietzsche zuletzt den in Frankreich aufgekommenen Begriff ‚décadence‘ vor – aus Enttäuschung über die alten Sinnstiftungen sieht man vorerst nur noch Verfall, verneint nur noch. Das dauert bis heute an. Aber es waren eben Metaphysik und Christentum, die versteckt verneint haben, indem sie gegen die tatsächlich lebenswerten Werte jene ‚höheren‘ Werte gesetzt hatten, die sie verneinten oder doch herabwürdigten. Die Philosophen waren bisher oft, fügt Nietzsche an derselben Stelle hinzu, „versteckte Priester“. Sie konstruierten aus der „Verachtung des Leibes“ und seines gesunden „‚Egoismus‘“ „‚das Heil der Seele‘“. Doch da gibt es nun eben starke Gegenbewegungen. Nietzsche spricht hier auch, das darf man nicht verschweigen, von der „Entartung des Ganzen, der Menschheit“, doch ohne wie die Nazis, die das natürlich gerne aufnahmen, damit einen biologischen Rassismus zu verbinden; die Nazi-Ideologie hätte Nietzsche scharf abgelehnt. Er bekannte sich schon zu seiner Zeit klar als Anti-Nationalist, Anti-Sozialist und Anti-Antisemit.
Den damaligen Marxismus hat Nietzsche kaum wahrgenommen; nicht einmal der Name Marx fällt bei ihm (das gilt auch umgekehrt). Hätte er Marx beachtet, hätte er bei ihm wohl eine mutige neue Zielsetzung für die Menschheit wahrgenommen, im „Kampf gegen die Entselbstungs-Moral“, den er auch selbst führte – so endet der oben zitierte Aphorismus. Beide sprachen von „Entfremdung“, und beide konnten dabei auf Ludwig Feuerbach zurückgreifen, der im Christentum eine Entfremdungs-Moral sah: Alles Gute am Menschen wird auf Gott und Gottes Sohn projiziert, das Schlimme bleibt beim Menschen selbst. Doch Marx sah nun in der Entwicklung der (europäischen) Menschheit, und da hätte Nietzsche nicht mitgemacht, einen selbstläufigen, von den Produktionsverhältnissen der aufkommenden Industriegesellschaft vorbestimmten Gang, der schließlich zur Revolution des Proletariats führen musste. Für Nietzsche wäre das nur eine Fremdbestimmung anderer Art gewesen. Er sah, dass es, wo es um die genannten großen Menschheitsprobleme geht, von denen wir gesprochen haben, auch in der Demokratie, die er für „unaufhaltsam“12 hielt, in allen Bereichen nicht ohne orientierungsüberlegene Führungskräfte – nicht herrsch- und selbstsüchtige Autokraten – geht. Da können und müssen sich vielleicht mit der Zeit auch Eliten herausbilden, was aber durchaus in demokratischen Auswahlprozessen möglich ist. ‚Elitär‘ ist ebenfalls zum Kampfbegriff geworden; ‚Elite‘, im 18. Jahrhundert auch aus dem Französischen übernommen, bedeutete ‚Auslese der Besten‘. Können diese sich – in der Aristokratie, im Militär, in der Wirtschaft und im Bankenwesen – zu einer Kaste formieren, z. B. durch gezielte Heiratspolitik, und dauerhaft Machtpositionen einnehmen, wirken sie ‚abgehoben‘. Doch auch das hat sich deutlich überlebt, die Demokratie hat erfolgreich dagegengehalten.
Man muss heute nicht mehr aus einer elitären Kaste abstammen – auch mit diesem Gedanken hat Nietzsche gespielt, als er sich das indische „Gesetzbuch des Manu“ mit seinen menschlich „vornehmen Werthen überall“, seinem „Jasagen zum Leben“ anschaute13 –, um der Menschheit neue Ideen zu einer umsichtigen und weitsichtigen Orientierung für ihre Zukunft zu geben, und auch diese Ideen müssen sich erst in einem demokratischen Prozess durchsetzen. Im Nihilismus als normalem Zustand ist so wie eine „Experimental-Philosophie“14 auch eine „Experimental-Moral“ angesagt – über „lange Jahrhunderte“15 hinweg. Was sich in ihr bewährt, wird dann in Normen, Werten und Gesetzen festgeschrieben und, wenn das hilft, auch Offenbarungen zugeschrieben, damit man sich nun vorerst daran halten kann, und hier kommen die ‚Priester‘ dann wieder zum Zug. Dagegen finden, so Nietzsche, „[d]ie geistigsten Menschen, als die Stärksten, […] ihr Glück, worin Andre ihren Untergang finden würden: im Labyrinth“ (ebd.) – also dort, wo andere sich nicht mehr orientieren können –, „in der Härte gegen sich und Andre, im Versuch; ihre Lust ist die Selbstbezwingung: der Asketismus wird bei ihnen Natur, Bedürfniss, Instinkt“ (ebd.) – wir würden heute sagen, zu einer Orientierungssicherheit, die sie auch anderen vermitteln können. Nietzsche gesteht ihnen aufgrund der höheren „Verantwortlichkeit“ vage auch andere „Rechte“ und „Vorrechte“ zu – da würden wir heute nicht mehr mitgehen, zumindest rechtliche Privilegien wurden durch die inzwischen eingespielten demokratischen Prozeduren überholt. Ideen und Leute mit Ideen müssen im Wettbewerb bleiben, wenn sie erfolgreich sein sollen. Effektives Regieren gerade in den großen Belangen, das nun überall erwartet und eingefordert wird, ist dadurch nicht leichter geworden, aber Entscheidungen können so mehr Zustimmung finden und nachhaltiger durchgesetzt werden.
III. Die Philosophie der Orientierung
PS: Hier ist vielleicht ein guter Punkt, um endlich auf Ihr eigenes Denken zu sprechen zu kommen, das seit einiger Zeit ja genau um den Begriff der „Orientierung“ kreist. 2008 publizierten Sie das umfängliche Werk Philosophie der Orientierung, und seitdem sind zahlreiche Publikationen zu diesem Konzept hinzugekommen. Diese Idee fand seitdem so viel Anklang, dass sich sogar eine eigene Stiftung, die 2019 gegründete Foundation for Philosophical Orientation, auf deren Internetseite man auch englischsprachige Einführungen in die Philosophie der Orientierung zum kostenlosen Download findet (Link), der Popularisierung und Diskussion dieses Begriffs widmet. Möchten Sie vielleicht umreißen, um was es Ihnen dabei geht, und inwiefern Sie in Nietzsche einen Vordenker dieser neuen Philosophie erblicken?
WS: Gerne, ich habe ja bisher schon Nietzsches Philosophieren in Begriffen der Orientierung deutlich zu machen versucht. Nihilismus bedeutete für ihn, wie gesagt, eine denkbar tiefgreifende und schwer auszuhaltende Desorientierung der ganzen europäisch gebildeten Menschheit, als sie den Glauben an Christentum und Metaphysik verlor. In der Folge wollten alle den Nihilismus ‚überwinden‘ – und dabei irgendwie zu absoluten Gewissheiten des alten Typs zurückkehren. Ich habe Nietzsches Philosophieren stets als befreiend empfunden – zu einer umfassend neuen philosophischen Orientierung im Nihilismus als „normalem Zustand“. Ich sah immer deutlicher, dass die Begriffe der großen philosophischen Tradition nicht mehr zu einer solchen Neuorientierung taugten. Ich hatte meine Dissertation, nach einem gründlichen Studium Kants, Hegels, Wittgensteins und Heideggers, dem Grundbegriff der Metaphysik, dem Begriff der Substanz, gewidmet.16 Sie ergab, dass ‚Substanz‘ auf dem Weg von Aristoteles über Descartes und Spinoza zu Leibniz und Kant selbst den Sinn eines festen und absolut gewissen Bestandes verliert und zu einer bloßen Kategorie mit der Funktion wird, im heraklitischen Werden Halt zu finden, einen Halt jedoch auf Zeit, der sich mit der Zeit verschiebt. Das habe ich dann ‚Fluktuanz‘ genannt und dazu meine Habilitationsschrift zu Dilthey und Nietzsche verfasst, in deren Werk sich diese Fluktuanz auf unterschiedliche Weise herausbildet.17 Im Blick auf die Evolution zum Menschen und dann des Menschen in seiner Geschichte rechnen wir heute damit, dass alle Begriffe, auch die der Philosophie, unablässig im Fluss sind und sein müssen, wenn sie mit der Zeit gehen sollen. Darauf hat auch Nietzsche mit seinem „Die Form ist flüssig, der ‚Sinn‘ ist es aber noch mehr …“18 beständig gedrungen. Aufgrund der Kompilation Der Wille zur Macht, die Nietzsches ziemlich verbiesterte Schwester nach seinem Tod sehr einkömmlich organisiert hatte, stilisierte Heidegger dagegen Nietzsches Philosophieren zu einer neuen Metaphysik des Willens zur Macht, die alle bisherige Metaphysik zum Äußersten treiben und damit zu Ende gebracht haben sollte – eine heute nachweislich verfehlte, in ihrer weltweiten Wirkung aber verhängnisvolle Interpretation. Sie diente Heidegger vor allem dazu, sich selbst einen ‚anderen Anfang‘ im abendländischen Philosophieren vorzubehalten. Er versuchte das mit der wieder aufgenommenen Frage nach dem ‚Sinn von Sein‘, die er für die ursprüngliche und eigentliche der Philosophie hielt und die er in seinem späteren Werk auf ein bloßes Hören auf die Zugehörigkeit des menschlichen Daseins zu einem unbestimmbaren ‚Seyn‘ zuschnitt. Doch es ist bis heute unklar, was damit anzufangen sein soll. Bei Heidegger selbst vertrug es sich mit einer tiefen Zustimmung zum Nationalsozialismus und mit einer radikalen Technik-Kritik, die heute monströs anmutet.
Wenn es im Nihilismus um eine große Desorientierung geht, so muss man stattdessen vielleicht gerade bei ihr anfangen und dann mit dem Begriff der Orientierung selbst. Er hatte sich, seit Moses Mendelssohn und Immanuel Kant ihn im Zuge eines religionsphilosophischen Streits vor 250 Jahren in die Philosophie einführten (das ist gegenüber dem Substanz-Begriff, der fast 2.500 Jahre alt ist, eine vergleichsweise kurze Zeit), immer mehr verbreitet und ging in den allgemeinen Sprachgebrauch ein. Nur in der Philosophie war er noch nicht recht angekommen: Nietzsche kannte ihn, gebrauchte ihn aber kaum, Wittgenstein schon mehr, Heidegger begann ihn in seinem frühen Werk Sein und Zeit zu thematisieren, Jaspers verkürzte ihn gleich wieder auf die Orientierung der Philosophie in den und durch die Wissenschaften. Wenn man den Begriff der Orientierung inzwischen überall gebraucht und also auch braucht, so deshalb, weil man sich zu jeder Zeit, in jeder neuen Situation mehr oder weniger neu orientieren muss und dafür eben keine absoluten Gewissheiten mehr, nur Anhaltspunkte hat. Hinter dem, wie wir uns mit unseren begrenzten Ausstattungen in der unendlichen komplizierten Wirklichkeit orientieren, steckt immer noch weit mehr, als man zunächst wahrnimmt und denkt, aber nichts Metaphysisches, nur Komplexeres. Das gilt in der Astronomie, der Physik und der Biologie ebenso wie in der alltäglichen Kommunikation, der Politik, dem Recht, dem Journalismus usw. Am auffälligsten wird das in der Kriminalistik, von der die Fernsehabende zum großen Teil leben: Es ist immer spannend zu verfolgen, was hinter dem ersten Augenschein noch alles herauskommen könnte. Philosophisch gesprochen, haben wir überall nur Anhaltspunkte für das, was wir ‚Sein‘, ‚Wirklichkeit‘, ‚Wahrheit‘ nennen, Punkte, an die wir uns vorläufig und bis auf Weiteres halten. Und es wird allen auch immer deutlicher, dass alle sich stets von einem Standpunkt aus in begrenzten Horizonten und Perspektiven mit jeweils begrenzten Orientierungsfähigkeiten orientieren, also alle Orientierung letztlich individuell ist. Damit müssen wir zurechtkommen, und können das sichtlich auch. Wir können nun nicht mehr bei einem an sich bestehenden Sein, sondern müssen bei der Orientierung anfangen, die uns in unserer Welt jeweils möglich ist. Und man kann auch nicht mehr gut wie noch vor 200 Jahren auf eine bei allen gleiche Vernunft setzen, sondern muss sehen, wie sich in der Orientierung aneinander in der Kommunikation jeweils das einstellt, was man ‚vernünftig‘ nennt. Das kann sehr vielfältig sein.
Das, was man beobachtet, um sich zu orientieren, hält man in Zeichen fest und interpretiert es in Sprachen, die man wiederum in unterschiedlichen Situationen und von unterschiedlichen Standpunkten aus unterschiedlich interpretieren kann. So kann man, wie der späte Wittgenstein es prägnant gefasst hat, letztlich nie wissen, was der andere mit seinen Zeichen und man auch selbst mit seinen eigenen Zeichen meint.19 In aller Orientierung, heißt das, spielt mögliche Desorientierung mit. Davon müssen wir heute ausgehen, und tun das, indem wir unserer eigenen Orientierung und unserer Orientierung aneinander, auch in der Philosophie, überall Spielräume im Verstehen einräumen. Und darauf hat auch Nietzsche, in Jenseits von Gut und Böse (Nr. 27; Link), schon verwiesen.
Man kommt hier mit den Begriffen der bisherigen Erkenntnis-, Entscheidungs- und Handlungstheorie nicht weiter, sondern muss wirklich neu anfangen, wenn man verstehen will, wie man die Welt und einander versteht. Das muss zunächst einmal beschreibend geschehen, und dabei bedarf es, nachdem sich der Anhalt an Jenseitigem als unhaltbar erwiesen hat, auch nicht mehr des abgehobenen Pathos von Predigern, in dem sich Philosoph(inn)en so gerne ergehen. Philosophie wird nur plausibel, wenn sie nahe an alltäglichen Erfahrungen bleibt. Ich versuche, ebenfalls mit dem späten Wittgenstein, „die Wörter von ihrer metaphysischen, wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurückzuführen“20, und sie dennoch auf dem Niveau zu halten, das die Philosophie in ihrer Jahrtausende langen Geschichte erarbeitet hat.
Der Anfang des Philosophierens scheint danach einfach zu sein, dass man irgendwo, im Kleinen oder im Großen, desorientiert ist, sich nicht auskennt, sich nicht zurechtfindet und aus der Desorientierung herauskommen will. Mehr braucht es nicht. Was man dann findet, sind jene Anhaltspunkte, zu denen es immer auch Alternativen gibt, so dass man zu ihnen auf Distanz bleibt, sich immer nur vorläufig an sie hält und also ihnen gegenüber frei bleibt. Orientierung auf Zeit könnte der Sinn der großen Frage nach ‚Sein und Zeit‘ sein, mit dem man auch im Alltag etwas anfangen kann. Zu dieser Orientierung auf Zeit gehört sicher auch, dass Philosoph(inn)en ‚Orientierung geben‘, auch in Gestalt von Ethiken, mit denen sie die Welt besser zu machen versuchen, als sie ihnen jetzt erscheint. Aber das geschieht ebenfalls erkennbar stets von bestimmten Standpunkten aus und auf Zeit, und auch hier gibt es immer plausible Alternativen.
Vom Nihilismus, den Nietzsche ausgerufen hat, bleibt die ständig beunruhigende Ungewissheit zurück, dass es immer auch anders sein, man die Dinge immer auch anders sehen könnte, als man sie in seiner Perspektive wahrnimmt. Das hält wachsam für die Möglichkeit anderer Sichten. Wie sehr wir Orientierung brauchen, weil wir ständig Situationen meistern müssen, in denen wir uns nur unzureichend auskennen, wird nirgendwo so deutlich wie in den globalen Krisen, die uns jetzt einholen. In den USA traut man sich da typischerweise mehr zu. Doch wie ich nun erlebe, können auch hierzulande immer mehr Menschen, im Persönlichen, in ihren Berufen und in den Wissenschaften, die sie betreiben, und auch in ihrem Philosophieren, immer mehr mit dem Neuanfang bei der Orientierung selbst, ohne die es nirgendwo geht, etwas anfangen. Darüber freue ich mich.
IV. Philosophenverstecke
PS: Haben Sie vielen herzlichen Dank für diese umfassende Erläuterung Ihres eigenen Ansatzes, dem hoffentlich eine breite Wirkung beschieden sein wird. Natürlich würde diese Darlegung zahlreiche Nachfragen provozieren – doch vielleicht müssen wir dies einmal bei anderer Gelegenheit nachholen. Ich möchte diesen Austausch stattdessen mit einer etwas anders gearteten Frage abrunden: Nietzsche ist ja ein Philosoph, der schon allein aufgrund seines lebendigen Stils so stark wie wenige andere auch zu einem breiten Publikum spricht. Denn die Menschen fühlen sich von ihm persönlich angesprochen; nicht nur auf einer intellektuellen, sondern nicht zuletzt auf einer emotionalen Ebene. Wenn ich mich nun nicht nur an den Denker, sondern auch den Menschen Stegmaier richten darf, mit all seiner Lebenserfahrung: Gibt es eine Stelle bei Nietzsche, die Sie persönlich besonders berührt hat, die Sie vielleicht sogar in Ihrem persönlichen Werdegang geprägt hat und die Sie gerne mit uns teilen möchten?
WS: Ja, die Stelle gibt es, und ich will sie Ihnen zum Abschluss unseres Gesprächs, für das ich Ihnen herzlich danke, auch verraten. Sie handelt vom „Philosophen-Anspruch auf Weisheit“, und man muss sie sich – Nietzsche war gerade mal 43 Jahre alt, als er sie publizierte, ich werde bald 80 – mit einem Schuss Ironie zu Gemüte führen. Häufig, schreibt er im V. Buch der Fröhlichen Wissenschaft (Nr. 359; Link), das ich so schätze, ist der Anspruch auf Weisheit, also auf eine durch reiche Lebenserfahrung gesättigte philosophische Lehre,
ein Versteck des Philosophen, hinter welches er sich aus Ermüdung, Alter, Erkaltung, Verhärtung rettet, als Gefühl vom nahen Ende, als Klugheit jenes Instinkts, den die Thiere vor dem Tode haben, – sie gehen bei Seite, werden still, wählen die Einsamkeit, verkriechen sich in Höhlen, werden weise… Wie? Weisheit ein Versteck des Philosophen vor – dem Geiste? –
Werner Stegmaier, geboren am 19. Juli 1946 in Ludwigsburg, war von 1994 bis 2011 Professor für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische Philosophie an der Universität Greifswald. Von 1999 bis 2017 war er Mitherausgeber der Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, dem renommiertesten Organ der internationalen Nietzsche-Forschung, sowie der wichtigen Schriftenreihe Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung. Er veröffentlichte zahlreiche Monographien und Sammelbände zu Nietzsches Philosophie und der Philosophie im Allgemeinen, unter anderem Philosophie der Orientierung (2008), Nietzsche zur Einführung (2011) und Luhmann meets Nietzsche. Orientierung im Nihilismus (2016) und jüngst Wittgensteins Orientierung. Techniken der Vergewisserung (2025). Die Weiterentwicklung der von ihm begründeten „Philosophie der Orientierung“ ist sein gegenwärtiger Arbeitsschwerpunkt. Weitere Informationen zu ihm und seinem Werk finden Sie auch auf seiner persönlichen Internetseite: https://stegmaier-orientierung.com/
Fußnoten
1: Vgl. Nachlass 1887, 9[35]. In einer anderen Stelle im Nachlass (1887, 9[60]) heißt es: „Der Nihilism als normales Phänomen“. Auch hier ist „als normales Phänomen“ später hinzugefügt.
2: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 343.
3: Vgl. Nachlass 1887 5[71].
4: Anm. d. Red.: Vgl. dazu auch den Artikel Seht, ich lehre euch den Transhumanisten von Jörg Scheller (Link).
5: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 62.
6: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. I, Aph. 24.
7: Ebd. Vgl. auch den vorherigen Abschnitt (Link).
8: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. I, Aph. 25.
9: Vgl. Jenseits von Gut und Böse, Aph. 251.
10: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. I, Aph. 25.
11: Ecce homo, Morgenröthe, Nr. 2.
12: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. II, Der Wanderer und sein Schatten, Aph. 275.
13: Der Antichrist, Nr. 56 & 57.
14: Nachlass 1888 16[32].
16: Substanz. Grundbegriff der Metaphysik (Stuttgart-Bad Cannstatt 1977).
17: Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und Nietzsche (Göttingen 1992).
18: Zur Genealogie der Moral II, Nr. 12.
19: Vgl. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 504.
20: Ebd., § 116.
Nietzsche und die Philosophie der Orientierung
Im Gespräch mit Werner Stegmaier
Anlässlich des 125. Todestags von Nietzsche am 25. August unterhielten wir uns mit zwei der international anerkanntesten Nietzsche-Experten, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier. Während sich das Gespräch mit Sommer (Link) vor allem um Nietzsches Leben drehte, sprachen wir mit letzterem über sein Denken, dessen Aktualität und Stegmaiers eigene „Philosophie der Orientierung“. Was sind Nietzsches zentrale Einsichten? Und inwiefern helfen sie uns dabei, uns in der Gegenwart zurechtzufinden? Was bedeutet sein Konzept des „Nihilismus“? Und was sind die politischen Implikationen seiner Philosophie?
Eine neue Nietzsche-Biographie
Im Gespräch mit Andreas Urs Sommer
Eine neue Nietzsche-Biographie
Im Gespräch mit Andreas Urs Sommer

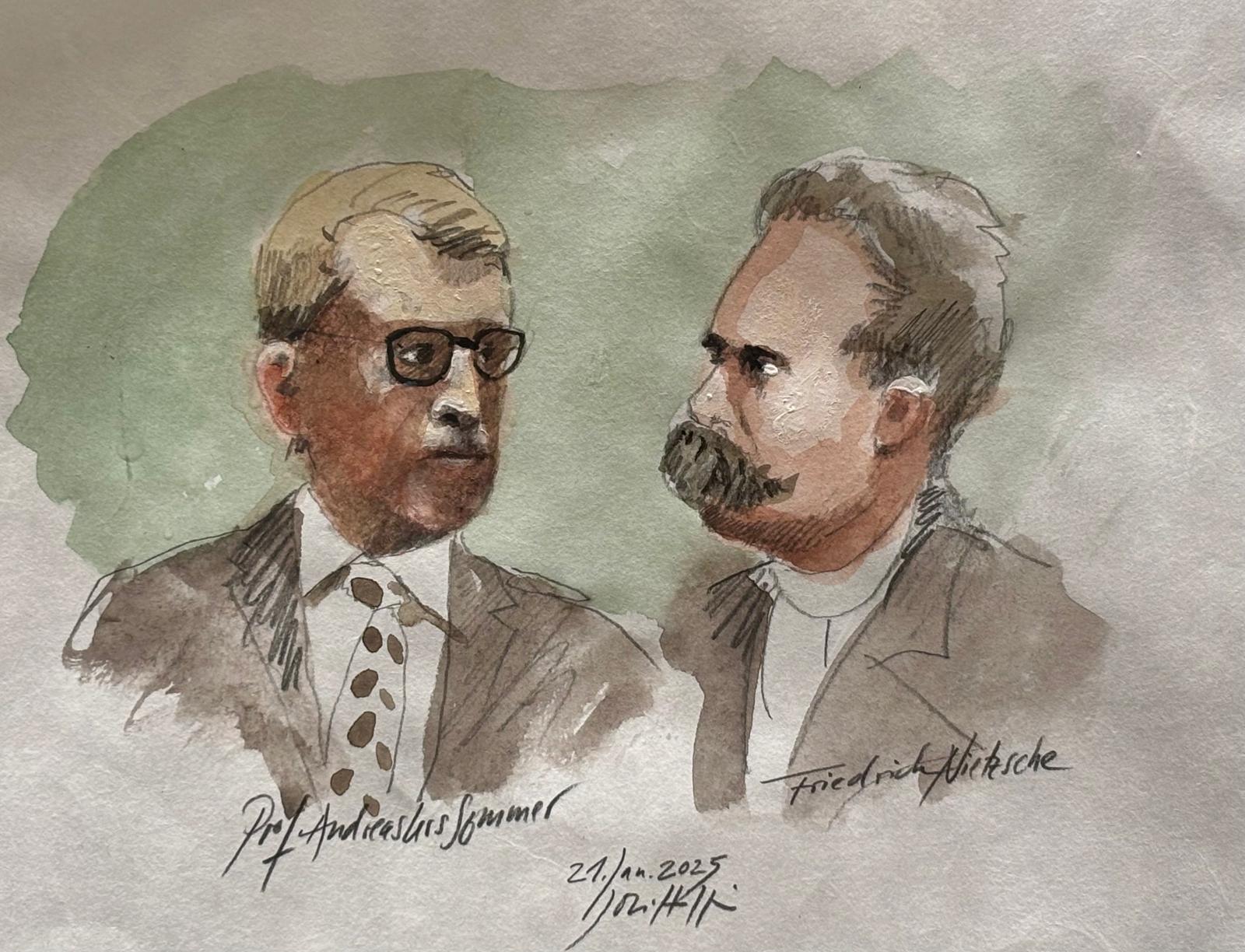
Vor 125. Jahren, am 25. August 1900, starb der Philosoph Friedrich Nietzsche. Dieses bedeutende Datum nehmen wir zum Anlass, um rund um den diesjährigen Jahrestag seiner Geburt am 15. Oktober 1844 herum Interviews mit zweien der international renommiertesten Nietzsche-Forschern, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier, zu publizieren. Der Freiburger Philosophieprofessor Sommer arbeitet gerade an einer umfangreichen Biographie des Denkers, weshalb sich das Gespräch mit ihm insbesondere um dessen Leben drehte; das Gespräch mit seinem Greifswalder Kollegen, in dem es vor allem um Nietzsches Denken geht, wird in Kürze folgen (Link). Dass beides nicht zu trennen ist, wird sich schnell zeigen. Wir befragten den Experten u. a. zu Nietzsches Charakter, seiner Sexualität und der Frage, inwiefern er das lebte, was er verkündete.
I. Vom Kommentar zur Biographie
Paul Stephan: Sehr geehrter Herr Professor Sommer, haben Sie zunächst vielen herzlichen Dank, dass Sie sich zu diesem Gespräch bereit erklärt haben. Es ist ja wohl kaum eine Untertreibung, Sie als einen der führenden Nietzsche-Forscher überhaupt zu bezeichnen. Neben vielem anderen sind Sie ja insbesondere der Leiter der Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und haben selbst zu diesem wichtigen Kommentar einige Bände beigesteuert.1 Nun wagen Sie sich an ein neues Großprojekt, nämlich eine neue wissenschaftliche Nietzsche-Biographie. Derzeit, wir beginnen diesen E-Mail-Dialog am 4. 4. 2025, arbeiten Sie daran noch; zum Zeitpunkt der Publikation dieses Gesprächs werden Sie sie wahrscheinlich bereits abgeschlossen haben, wenn sie nicht sogar schon veröffentlicht worden ist. Auch wenn Sie zu wahrscheinlich allen Aspekten von Nietzsches Leben, Werk und Wirkung ein würdiger Gesprächspartner wären, soll daher dieses laufende Vorhaben der Hauptgegenstand dieses Austauschs werden.
Meine erste Frage, die sich diesbezüglich an Sie richtet, ist vielleicht ein wenig provokant, aber wird Sie sicherlich nicht überraschen. Zu wohl keinem Philosophen gibt es ja so viele Biographien wie zu Nietzsche, möchte ich behaupten. Neben unzähligen populärwissenschaftlichen Darstellungen seines Lebens liegt u. a. seit vielen Jahren die dreibändige wissenschaftliche Biographie von Curt Paul Janz vor – selbst abseitige Themen wie Nietzsches Sexualität oder seine, mögliche, Erkrankung an der Syphilis sind Gegenstand umfangreicher Monographien geworden. In welchen Punkten wollen Sie sich von Ihren Vorgängern abheben? Wo erhoffen Sie sich, neue Akzente setzen zu können?
Andreas Urs Sommer: Die jetzt geweckten Erwartungen muss ich leider ein wenig zurückschrauben und mich bei Ihnen, lieber Herr Stephan, für die Möglichkeit eines Interviews bedanken, obwohl sein Gegenstand, eben die Nietzsche-Biographie, noch keineswegs abgeschlossen ist. Sie wird es auch zu Nietzsches 181. Geburtstag am 15. 10. 2025 noch nicht sein. Tatsächlich war mit dem Verlag – es ist C. H. Beck in München – ursprünglich ein Manuskriptabgabetermin Ende letzten Jahres vereinbart, den ich wegen der von Ihnen angesprochenen, vielfältigen sonstigen Obliegenheiten leider nicht einhalten konnte. Der viertelsrunde Todestag durfte kein Anlass werden, mit dem Buch zu hetzen, das doch Hand und Fuß haben soll – und vielleicht noch ein paar Körperteile mehr. So hat mir der C. H. Beck Verlag freundlicherweise noch weitere Denk- und Schreibzeit eingeräumt. Denn wir befinden uns in einer sehr eigentümlichen Situation: Zum einen sind die internationalen Forschungsaktivitäten zu Nietzsche immens, zum anderen ist seit 1978, seit dem Werk von Curt Paul Janz, das Sie erwähnen, keine umfassende Nietzsche-Biographie mehr erschienen, die tatsächlich aus der aktuellen Forschung geschöpft wäre. Wollte man es überspitzt formulieren, könnte man sagen: Seit 1978 schreiben alle Biographen von Janz ab, der im Übrigen selbst fleißig abgeschrieben hat: der erste Band seiner Biographie beruht auf Richard Blunck: Friedrich Nietzsche. Kindheit und Jugend von 1953 – ein Buch, das eigentlich schon 1945 fertig war und noch entnazifiziert werden musste, da es ursprünglich im NS-Dunstkreis entstanden war.
Kurzum: Auf der einen Seite steht eine reiche Fülle von jüngeren Forschungserkenntnissen, auf der anderen Seite sind diese noch nie synthetisch in die Form einer allgemein lesbaren Biographie gegossen worden. Zudem wird die Biographie einen dezidiert philosophischen Anspruch verfolgen: Sie will zum Denken ermuntern.
PS: Das ist natürlich sehr verständlich, dass Sie ein solches Großprojekt nicht übereilen möchten. Zumal ja auch Nietzsche in der Vorrede zur Morgenröthe schreibt: „Ein solches Buch, ein solches Problem hat keine Eile; überdies sind wir Beide Freunde des lento, ich ebensowohl als mein Buch. Man ist nicht umsonst Philologe gewesen, man ist es vielleicht noch, das will sagen, ein Lehrer des langsamen Lesens: – endlich schreibt man auch langsam.“2 Vielleicht wäre das auch eine der Lektionen, die man von Nietzsche lernen könnte? Sich nicht von den Anforderungen einer überhitzten und hektischen Gegenwart stressen zu lassen und sich seine Zeit zu nehmen, lernen, gemäß dem eigenen Tempo zu leben?
AUS: Sicher kann man diesen Ratschlag in das Rezeptbuch gelingenden Lebens aufnehmen – und auch Nietzsche hätte es, wie allerdings zahlreiche Denkerinnen und Denker vor ihm, bestimmt getan. Eine heitere Gelassenheit gegenüber den angeblich so superdringlichen Forderungen des Tages dürfte nie verkehrt sein. Allerdings ist Nietzsche als Lebenskunst-Orakel oft nur eine Karikatur seiner selbst, zumal dann, wenn man ihm Gemeinplätze zuordnet. Selbst hat er sich weder an den Ratschlag langsamen Lesens gehalten – er liest oberflächlich, rasch, kreuz, quer und stets auf seine eigenen intellektuellen Bedürfnislagen hin fokussiert. Noch an den Ratschlag des langsamen Schreibens. Gerne beschreibt er, wie er – etwa bei Also sprach Zarathustra – in einen eruptiven Schreibrausch hineingeraten sei.3 Oft nehmen Lesende mit Hintergrundwissen die Atemlosigkeit, auch das Überstürzte seiner Schreibaktivitäten wahr, während er dann phasenweise ins „più lento" gerät. Nietzsche sondert keinen kontinuierlichen Schreibfluss ab – er schlägt beim Schreiben wilde Haken.
PS: Ja, man stößt bei Nietzsche immer wieder auf eine große Diskrepanz zwischen Leben und Werk, zwischen dem Mythos, den Nietzsche vor allem in seiner vermeintlichen „Autobiographie“ Ecce homo um sich kreierte und der bis heute immer wieder weitergesponnen wird und dem, wie er wirklich war. Wie gehen Sie beim Schreiben Ihrer Biographie mit diesem offensichtlichen Widerspruch um? Ist es überhaupt möglich, jenseits des Dickichts der Anekdoten und Legenden zu einem „authentischen Nietzsche“ vorzudringen? Und muss das etablierte Nietzsche-Bild in manchen Teilen im Lichte der jüngeren Forschung vollkommen revidiert werden? Gilt es, Nietzsches berühmten „Hammer“ nun endlich auch einmal auf seine vielleicht hartnäckigste Schöpfung anzuwenden: die „Marke Nietzsche“; das „Götzenbild“ seiner selbst, dass er und nach ihm seine zahllosen Jünger und Feinde schufen?
AUS: Nietzsche ist, seit er sich als Kind und als Jugendlicher schreibend erfindet, in unentwegter autobiographischer Selbstreflexion begriffen: Wir haben zahllose Zeugnisse von ihm, in denen er sein Leben beschreibt, auch aus ganz früher Zeit, wo es scheinbar noch gar kein Leben zu beschreiben gab. Der Biograph ist dabei gut beraten, diesen Selbstzeugnissen gegenüber misstrauisch zu sein – insbesondere gegenüber dem Paradepferd im Stall von Nietzsches autobiographischem Werkkomplex, dem 1888 entstandenen Ecce homo. Diese Schrift ist nicht einfach eine „Autobiographie“, sondern eine Schrift mit glasklar formulierter Zielsetzung, nämlich die Welt vorzubereiten auf den zerstörenden Blitzschlag der „Umwerthung aller Werthe“, die Nietzsche mit Der Antichrist zu vollziehen hoffte. Entsprechend liegt so ziemlich das Gegenteil einer akkurat-objektiven Abspiegelung eines Lebensweges vor. Man sollte Nietzsche bei seinen autobiographischen Äußerungen also nicht vorschnell auf den Leim gehen und sie einfach für bare Münze nehmen. Vielmehr ist immer zu fragen, was der Verfasser mit ihrer Platzierung bezweckt hat. Und zum Glück stehen dem Biographen eine Vielzahl anderer Dokumente zur Verfügung, die es erlauben, diese autobiographischen Äußerungen zu kontextualisieren. Überhaupt ist Kontextualisierung eine zentrale Aufgabe einer Nietzsche-Biographie. Er ist eben nicht der einsame Denkerheld auf einem Gipfel der Ideengeschichte, sondern vielfach verflochten und verhakelt mit seiner Zeit und mit seinen Zeitgenossen. „Objektiv“ einen „wahren Nietzsche“ wird auch meine Biographie nicht vor Augen stellen. Aber sie versucht, ein reiches, ein differenziertes Bild zu geben.
II. Der Mensch Nietzsche – und seine Sexualität
PS: Wie muss man sich den Menschen Nietzsche denn konkret vorstellen? In Filmen wie der Adaption des Romans Und Nietzsche weinte von Irvin D. Yalom (USA 2007) oder Lou Andreas-Salomé (D/Ö 2016) wird er als getriebener Exzentriker gezeigt. In meinen eigenen Forschungen stieß ich jedoch immer wieder auf Äußerungen Dritter, die ihn als eher höflich und zurückhaltend darstellen. Ein verbreitetes Bild eines „typischen Nietzscheaners“ wäre wohl ein Art Klaus Kinski4, der phasenweise friedlich ist, dann aber plötzlich wütend und aufbrausend wird, ohne Rücksicht auf seine Umgebung zu nehmen. Konnte Nietzsche selbst auch so sein?
AUS: Nach allem, was wir von seinen Zeitgenossen wissen, hat Nietzsche sich in seiner sozialen Umgebung zurückhaltend aufgeführt; anfallartige Transgressionsexzesse im Kinski-Stil sind ihm wohl fremd gewesen und fremd geblieben, wenn er sie bei anderen beobachtete. Die Selbstkultivierungsaufforderung aus Morgenröthe (1881) hat er sich anscheinend zu eigen gemacht: „Die guten Vier. – Redlich gegen uns und was sonst uns Freund ist; tapfer gegen den Feind; grossmüthig gegen den Besiegten; höflich – immer: so wollen uns die vier Cardinaltugenden.“5 Höflichkeit und Vornehmheit hat Nietzsche nicht nur theoretisch, sondern auch lebenspraktisch hochgehalten: Von Höflichkeit bestimmtes Sozialverhalten produziert die geringsten Reibungsverluste. Dass er demgegenüber auf dem Papier ein Berserker sein konnte (was zur Annahme verführte, er sei es auch im Leben gewesen), steht im wahrsten Sinn auf einem anderen Blatt. Er scheint aber keine Mühe gehabt zu haben, die eine Sphäre von der anderen zu unterscheiden. Tatsächlich gehörte zur Höflichkeit auch, die anderen zu lassen, wie sie sind. In einer Aufzeichnung von 1880 schmiedete er daraus sogar einen „neuen Kanon an alle Einzelnen“: „sei anders, als alle Übrigen und freue dich, wenn Jeder anders ist, als der Andere“6. Allerdings ist diese Maxime im Nachlass begraben geblieben; Nietzsche hat sie nie in ein publiziertes Werk aufgenommen.
PS: Ob er sich dann in Abwesenheit seiner Bekannten oder, wenn er unbeobachtet war, doch gelegentliche Gefühlsausbrüche leistete, wird man wohl nie mehr rekonstruieren können. Aber ich gebe Ihnen vollkommen Recht: Das Bild vom Nietzscheaner als cholerischem Exzentriker passt vor allem auch gar nicht so recht zu dem, was Nietzsche schreibt über einen adäquaten sozialen Umgang. Doch lassen Sie mich nun ein vielleicht etwas heikles Thema ansprechen, das ebenfalls Nietzsches unbeobachtetes Privatleben betrifft, was aber viele unserer Leser ebenfalls umtreibt und auch schon für Diskussionen sorgte auf unserem Blog7: Ich meine damit Nietzsches Sexualität. Bei kaum einem Philosophen ist die Spekulation darüber so weit verbreitet, scheint mir – wobei in der seriösen Forschung dieses Thema oft umschifft wird. Wenn ich mich recht entsinne, spielt es etwa bei Janz keine besondere Rolle. Es gibt da, soweit ich es überblicke, drei verbreitete konkurrierende Erzählungen: Erstens, dass Nietzsche sehr gehemmt und unbeholfen war, was Frauen angeht, obgleich er sich nach ihnen sehnte – und sich, so der Mythos, bei seiner einzigen physischen intimen Begegnung, mit einer Kölner Prostituierten, auch noch unglückselig mit Syphilis infiziert habe.8 Zweitens, dass er in Wahrheit, trotz etwa seiner möglichen Verliebtheit in Lou Andreas-Salomé, in Wahrheit homosexuell gewesen sei und sogar Kontakte zu jungen männlichen Prostituierten pflegte – wie etwa Rüdiger Safranski in seiner bekannten Nietzsche-Biographie von 2002 argumentiert und nicht zuletzt Joachim Köhler in seiner umfangreichen Untersuchung Zarathustras Geheimnis, die 1989 erschien, in der Forschung jedoch weitgehend ignoriert wird. Drittens, dass er Sadomasochist war mit einer starken masochistischen Neigung zu dominanten Frauen. Kronzeugin ist hier pikanterweise niemand geringerer als Lou Andreas-Salomé – der oftmals ihrerseits ein gewisser Sadismus unterstellt wird im Umgang mit Männern – selbst, die diese Variante in ihrer Nietzsche-Biographie von 1894 andeutete und im posthum veröffentlichten Tagebuch ihres längeren Aufenthalts 1912/13 in Wien bei Sigmund Freud sogar von Nietzsche als „diesem Sadomasochist an sich selber“9 sprach. Wer, wenn nicht sie, müsste es wissen, könnte man meinen, auch wenn der genaue Charakter ihrer Beziehung zu Nietzsche ja ebenfalls sehr umstritten ist. Köhler griff diese Vermutung in dem Kapitel „Ritter, Tod und Domina“ des besagten Buches auf und argumentiert beispielsweise, dass Nietzsche Leopold von Sacher-Masochs Romane gekannt haben muss. Allerdings hakt seine Argumentation meines Erachtens etwas, da er in für meinen Geschmack etwas küchenpsychologischer Manier unterdrückte Homosexualität und heterosexuellen Masochismus identifiziert.10 – Wir berühren hier sicherlich erneut spekulatives Terrain, da Nietzsche in dieser Hinsicht ja leider weniger offenherzig als beispielsweise sein Erzfeind Jean-Jacques Rousseau gewesen ist. Seinen Schriften lässt sich, wie mir scheint, entnehmen, dass er mit dem Puritanismus seiner Zeit und seines Milieus hadert, ohne darum für eine völlige Enthemmung der Sexualität zu plädieren. Fast immer ist dabei von „stinknormaler“ heterosexueller Sexualität die Rede, doch pikanterweise gibt es eine auffällige Tendenz bei Nietzsche, Schmerz und Lust zusammenzudenken – Köhler interpretiert etwa den berühmten „Peitschen-Satz“ in diesem Sinn als Bekenntnis zur Peitsche der Frau! –, aber auch hin und wieder anerkennende Stellen über die antike Knabenliebe.11 Wie gehen Sie als Biograph damit um? Und auf welche Seite schlagen Sie sich im Streit um Nietzsches Intimität?
AUS: Das zweifellos bestehende Interesse an Nietzsches Sexualleben verrät viel über das Publikum, das danach fragt, und das kulturelle Umfeld, in dem dieses Publikum sein Dasein fristet. Für die meisten westlich und im 20. oder 21. Jahrhundert Sozialisierten ist das Thema Sex von eminenter Bedeutung – was wiederum kulturphilosophisch sehr bedenkenswert ist: Was sagt es über eine Kultur und ihre Vorstellung von der Gestaltbarkeit der eigenen Lebensform aus, wenn in ihr eine ideologische Prädominanz des Sexus, also des tendenziell Ungestaltbaren obwaltet? Aber das ist natürlich nicht die Frage, auf die Sie hinauswollten. Wir können also im Blick auf Nietzsche einfach nüchtern feststellen: Die Vorstellung, dass Geschlechtlichkeit, Trieb, sexuelle Begierden womöglich für einen Philosophen eines vorangegangenen Jahrhunderts kein kapitales Problem gewesen sein könnten, ist dem heutigen Publikum empörend, ja unerträglich. Geradezu zwanghaft muss dieses Publikum dem früheren Menschen unterstellen, er habe da etwas – das Wesentliche – verdrängt oder (womöglich noch schlimmer) es heimlich ausgelebt, ohne frecherweise der Nachwelt davon Kunde zu geben.
Also wähnt sich der Biograph genötigt, dazu Stellung zu nehmen. Man hofft doch auf Schlüsselloch-Geschichten, neue „Enthüllungen“. Dieses Geschäftsmodell hat Joachim Köhler mit dünner Evidenz in den Realien und den Texten bereits 1989 perfekt genutzt. Ich kann nicht ausschließen, dass Nietzsche Sacher-Masochs 1870 erschienene Venus im Pelz gelesen hat, weil er eine Menge Literatur zu konsumieren pflegte – warum also nicht auch Sacher-Masoch, der übrigens viel harmloser und bürgerlicher daherkommt, als es der nach ihm gebildete „Masochismus“ vermuten lässt. Was ich aber ausschließen kann, ist, dass diese mögliche Lektüre irgendeinen in Nietzsches schriftlichen Hinterlassenschaften nachweisbaren Eindruck hinterlassen hat. Die Parallelstellen-Indizien„beweise“, die Joachim Köhler dafür beibringen will, überzeugen mich jedenfalls nicht. Übrigens erwähnt Nietzsche Sacher-Masoch tatsächlich einmal, nämlich in einem Brief an seinen Verleger Naumann, in einer langen Liste von Zeitschriften-Redakteuren, die ein Rezensionsexemplar von Jenseits von Gut und Böse bekommen sollten (Link). Sacher-Masoch stand nicht auf dieser Liste, weil Nietzsche mit ihm etwas besonders Pikantes verbunden hätte, sondern weil er ihn als gewöhnlichen Journalisten unter anderen Journalisten wahrnahm – wenn er ihn denn wirklich wahrnahm.
Mit prickelnden erotischen Enthüllungen kann ich in der Biographie leider nicht aufwarten, obwohl diese das Publikumsinteresse sicher anstacheln würden. Trotz gewiss besserer Verkaufszahlen trotze ich der Biographen-Versuchung, Nichtigkeiten zu Ereignissen aufzublasen. In der Genealogie der Moral macht sich Nietzsche Gedanken, wie Philosophen zu den asketischen Idealen stehen sollten. Dabei zielt die Argumentation darauf, sich die Askese zunutze zu machen: Philosophen erscheinen als radikale Sachwalter ihres eigenen Interesses, ungestört zu bleiben. Sie wollen sich irritationsfrei halten, sowohl im Blick auf äußere Ablenkung als auch im Blick auf die eigene Sinnlichkeit: „Ruhe in allen Souterrains; alle Hunde hübsch an die Kette gelegt; kein Gebell von Feindschaft und zotteliger Rancune“12.
Was genau für Hunde Nietzsche in seinem Souterrain hielt, hat er nie verraten. Und die heutigen Spekulationen über die Hundearten verrät vor allem etwas über die Disposition der jeweiligen biographischen Spekulantinnen und Spekulanten. Heute den „Streit um Nietzsches Intimität“ führen zu wollen, hat etwas unfreiwillig Komisches. Wer auf biographische Redlichkeit hält, wird sich hier jener methodischen Vorgabe befleißigen, die Nietzsche im Antichrist „Ephexis in der Interpretation“13 nennt: Man sollte sich eines Urteils enthalten, wo verlässliches Material fehlt, um sich ein Urteil bilden zu können.
PS: Ja, was ich an dieser ganzen Diskussion eigentlich traurig finde, ist, dass man versucht, Nietzsche unbedingt in irgendeine Schublade der heute definierten sexuellen Identitäten zu pressen. Spätestens Michel Foucault sollte uns doch mit seiner Studie Sexualität und Wahrheit (1976) eines besseren belehrt haben: Dieser ganze moderne Kategorienapparat (Homosexualität, Masochismus, Sadismus …) und die Vorstellung von der Sexualität als ‚eigentlichen‘, ‚authentischen‘ Identität sind historisch sehr jungen Datums und Nietzsche wird sich sicherlich in seinem Selbstverständnis gar nicht in diesem Rahmen verortet haben, sondern einfach seinen Bedürfnissen gefolgt sein – und sah sich wahrscheinlich vor allem als Philosoph, Philologe, Freigeist, nicht primär als sexuelles Wesen, auch wenn er immer wieder den triebhaften Charakter auch des Denkens betont14. Wir müssen da in der Tat sehr aufpassen, uns nicht von der Herrschaft von „König Sex“ (Foucault) blenden zu lassen, die eben auch sehr repressiv und verarmend ist, was unsere Seinsmöglichkeiten betrifft. Das angeblich so spießige ausgehende 19. Jahrhundert war jedenfalls offen genug, einen Autoren wie Sacher-Masoch als seriösen Schriftsteller anzuerkennen. Er war ein Bestsellerautor, kein exzentrischer Sonderling. – Vielleicht sind wir gerade in unserer Obsession für das Sexuelle es, die in dieser Hinsicht verklemmt sind? Aber heute wird im Internet ja auch ernsthaft darüber diskutiert, ob Alexander der Große oder Julius Cäsar homosexuell waren …
Was sich gleichwohl kaum bestreiten lässt, ist aber, wie mir scheint, doch, dass sich Nietzsche, wenn man nur von seinen Texten ausgeht und alles andere außer Acht lässt, immer wieder auf das Thema Sexualität bezieht.15 Schon für seinen Lehrer Schopenhauer war der „Wille zum Leben“ ja nicht zuletzt ein allgegenwärtiger Wille zur Fortpflanzung. Freud basierte auf diesem Gedanken später seine Psychoanalyse und ließ sich dabei auch von Nietzsche inspirieren. Die schon erwähnte Lou Andreas-Salomé zum Beispiel war ja später auch Schülerin Freuds und verfasste einige wichtige Beiträge zur psychoanalytischen Theorie und zur Theorie der Erotik. Von vielen wurde er später als Prophet einer dionysischen Befreiung des Sexus wahrgenommen gerade auch in ihrer ‚perversen‘ Dimension, ich denke da etwa an Georges Bataille, Antonin Artaud, den ersten Freudomarxisten Otto Gross oder auch den sexpositiven Feminismus (beginnend um die Jahrhundertwende etwa bei Hedwig Dohm, Lily Braun oder Helene Stöcker). Auch beim berüchtigten Wilhelm Reich lässt sich ein gewisser Nietzscheanismus nachweisen und später bei Herbert Marcuse. Es ließen sich hier zahlreiche weitere Namen anführen, doch auf was ich eigentlich hinauswill: Halten Sie diesen Strang der Nietzsche-Rezeption für eine reine Projektionsleistung oder ist er nicht doch in Nietzsches Kritik an der puritanischen Heuchelei seiner ja eben womöglich doch nicht so sittsamen Zeit und seinem Konzept des Dionysischen fundiert?
AUS: Das ist ja das Bemerkenswerte bei Nietzsche: Er lädt zu unterschiedlichsten und oft kontradiktorischen Rezeptionen ein, die sich allesamt mit gewissem Recht auf ihn berufen. Zum einen erscheint er als der große Denker der Leiblichkeit, der jede Schwergewichtsverlagerung in eine ätherisch-reine Geisteswelt dem Spott preisgibt. Das Dionysisch-Rauschhafte scheint in ihm einen Anwalt zu finden. Zum anderen aber steht er für „Pathos der Distanz“16, die große Ernüchterung, die große Kälte, die sich aller körperlichen Zwänge entzieht. Ist er für die einen der Philosoph des Orgiasmus, ist er für die anderen der Philosoph strengster philosophischer Askese – nicht einer Askese um ihrer selbst, sondern um der schonungslosen Erkenntnis willen. Aber kann man, bohrt er weiter, die Erkenntnis wirklich wollen? Warum ein Wille zur Wahrheit und nicht viel lieber ein Wille zur Unwahrheit?
Wenn wir Nietzsche als Zeugen für dieses oder jenes aufrufen, wird er sich sehr schnell entziehen. Er ist in jeder Hinsicht ein höchst unzuverlässiger Zeuge. Vielleicht wäre es klüger, auf seine Zeugenschaft, auf sein Patronat für dieses oder jenes zu verzichten. Und nicht auf seine Schützenhilfe zu hoffen – weder bei der sexuellen Revolution noch bei allerlei Konterrevolutionen. Bestenfalls hilft Nietzsche dabei, sich selbst zu helfen.
III. Konnte Nietzsche sich selbst helfen?
PS: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Nur eine kurze letzte Frage drängt sich mir noch auf. Was würden Sie nach all Ihrer jahre- und jahrzehntelangen intensiven Auseinandersetzung mit Nietzsches Leben und Werk resümieren: War es ein Mensch, der sich selbst helfen konnte?
AUS: Eine bemerkenswerte Frage! Tatsächlich war er ein Mensch, der sich stets der Menschen zu bedienen wusste, die ihm helfen konnten. Er verfügte über eine erstaunliche Fähigkeit, andere Menschen für seine Zwecke einzuspannen und gleichzeitig pathetisch die Fiktion aufrechtzuerhalten, er stünde ganz allein da, von aller Welt verlassen. Das wäre schon einmal ein Indiz, dass er sich – mittels anderer – in lebensweltlichen Dingen sehr wohl helfen konnte. Und auch jenseits der Instrumentalisierung anderer neige ich dazu, ihm großes Selbsthilfetalent zu attestieren. Philosophisch ohnehin: Sackgassen, in die er sich manövrierte – angefangen mit Schopenhauer und Wagner über Lou Andreas-Salomé und Paul Ree bis hin zu allerlei Krankheitsüberlasten und zur späten Selbstvergottung –, erwiesen sich als Widerfahrnisse, die er sich, meist nicht nach den Regeln folgerichtigen Schließens, nutzbar zu machen vermochte, sei es durch waghalsige Rösselsprünge, sei es durch kess-ironisch Volten. Wenn sich selbst helfen bedeutet, den Zufall gar zu kochen, dann ist ihm das erstaunlich oft gelungen. Es zeigt die Macht des Philosophierens.
PS: Ich danke Ihnen herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch.
AUS: Es war mir ein Vergnügen. Versuchen wir es doch weiter mit der Macht des Philosophierens.
Andreas Urs Sommer, geboren am 14. Juli 1972 im Schweizer Kanton Aargau, ist seit 2016 Professor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und seit 2019 geschäftsführender Direktor des dort beheimateten Nietzsche-Forschungszentrums. Er habilitierte sich 2004 unter der Betreuung von Werner Stegmaier mit einer Studie zur Geschichtsphilosophie bei Kant und Bayle an der Universität Greifswald. Seit 2014 ist er Leiter der Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und trug selbst mehrere Bände zu demselben bei. Er publizierte u. a. die Monographien Lexikon der imaginären philosophischen Werke (Frankfurt a. M. 2012), Werte. Warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt (Stuttgart 2016), Eine Demokratie für das 21. Jahrhundert. Warum die Volksvertretung überholt ist und die Zukunft der direkten Demokratie gehört (Freiburg, Basel & Wien 2022) und den hervorragenden Einführungsband Nietzsche und die Folgen (Stuttgart 2017).
Quellen
Andreas-Salomé, Lou: Friedrich Nietzsche in seinen Werken. Wien 1894.
Dies.: In der Schule bei Freud. Tagebuch eines Jahres 1912/13. Taching am See 2017.
Blunck, Richard: Friedrich Nietzsche. Kindheit und Jugend. Basel & München1953.
Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I. Frankfurt a. M. 1977.
Janz, Curt Paul: Friedrich Nietzsche. Biographie. München 1978/79. 3 Bd.e.
Köhler, Joachim: Zarathustras Geheimnis. Friedrich Nietzsche und seine verschlüsselte Botschaft. Reinbek b. Hamburg 1992.
Niemeyer, Christian: Nietzsches Syphilis – und die der Anderen. Eine Spurensuche. Baden-Baden 2020.
Safranski, Rüdiger: Nietzsche. Biographie seines Denkens. München & Wien 2000.
Yalom, Irvin D.: Und Nietzsche weinte. Übers. v. Uda Strätling. München 2001.
Quellenangabe zum Artikelbild
Johannes Hüppi: Andreas Urs Sommer & Friedrich Nietzsche (2025).
Fußnoten
1: Vgl. hierzu den Bericht über die diesem Kommentar gewidmete Jahrestagung der Nietzsche-Gesellschaft im Jahr 2024 von Jonas Pohler auf diesem Blog (Link).
2: Morgenröthe, Vorrede, Abs. 5.
3: Vgl. insb. den diesem Werk gewidmeten Abschnitt in Ecce homo (Link).
4: Vgl. Paul Stephans Artikel Mythomanen in dürftiger Zeit. Über Klaus Kinski und Werner Herzog auf diesem Blog (Link).
5: Aph. 556.
6: Nr. 3[98].
7: Vgl. insb. Henry Hollands Artikel Mit Nietzsche und Marx in die Erbstreitrunde (Link) und Christian Saehrendts Beitrag Dionysos ohne Eros. War Nietzsche ein Incel? (Link).
8: Aktualisiert wurde diese Erzählung jüngst von Christian Niemeyer in seiner umfangreichen Studie Nietzsches Syphilis – und die der Anderen.
9: In der Schule bei Freud, S. 134.
10: Eine ‚Diagnose‘, die allerdings mit Bezug auf Nietzsche auch Andreas-Salomé formulierte, die mit dem Philosophen auch über dieses Thema sprach (vgl. ebd.).
11: Allerdings lassen diese sich an den Fingern abzählen. Die wichtigsten sind Menschliches, Allzumenschliches Bd. I, Aph. 259, Morgenröthe, Aph. 503 und Götzen-Dämmerung, Streifzüge, Aph. 47.
12: Zur Genealogie der Moral, Abs. III, 8.
13: Abs. 52.
14: Vgl. etwa Nachgelassene Fragmente 1883, Nr. 7[62].
15: So kritisiert er am Christentum vor allem seine Ablehnung der Sexualität (vgl. etwa AC 56 &Gesetz) und sogar die mangelnde Sexualerziehung der „vornehmen Frauen“ (FW 71) und prangert die Verlogenheit der monogamen Ehe an (vgl. MA I, 424). Der „Rausch der Geschlechtserregung“ sei die „älteste und ursprünglichste Form des Rausches“ (GD, Streifzüge, 8), wobei er ebenso von einer ursprünglichen „Lust an der Grausamkeit“ (GM II, 7) ausgeht und diese auch immer wieder mit der Sexualität assoziiert (vgl. etwa bereits GT 2).
16: Vgl. etwa Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 2.
Eine neue Nietzsche-Biographie
Im Gespräch mit Andreas Urs Sommer
Vor 125. Jahren, am 25. August 1900, starb der Philosoph Friedrich Nietzsche. Dieses bedeutende Datum nehmen wir zum Anlass, um rund um den diesjährigen Jahrestag seiner Geburt am 15. Oktober 1844 herum Interviews mit zweien der international renommiertesten Nietzsche-Forschern, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier, zu publizieren. Der Freiburger Philosophieprofessor Sommer arbeitet gerade an einer umfangreichen Biographie des Denkers, weshalb sich das Gespräch mit ihm insbesondere um dessen Leben drehte; das Gespräch mit seinem Greifswalder Kollegen, in dem es vor allem um Nietzsches Denken geht, wird in Kürze folgen (Link). Dass beides nicht zu trennen ist, wird sich schnell zeigen. Wir befragten den Experten u. a. zu Nietzsches Charakter, seiner Sexualität und der Frage, inwiefern er das lebte, was er verkündete.
Also sprach die Maschine
Nietzsche imitieren mit KI
Also sprach die Maschine
Nietzsche imitieren mit KI

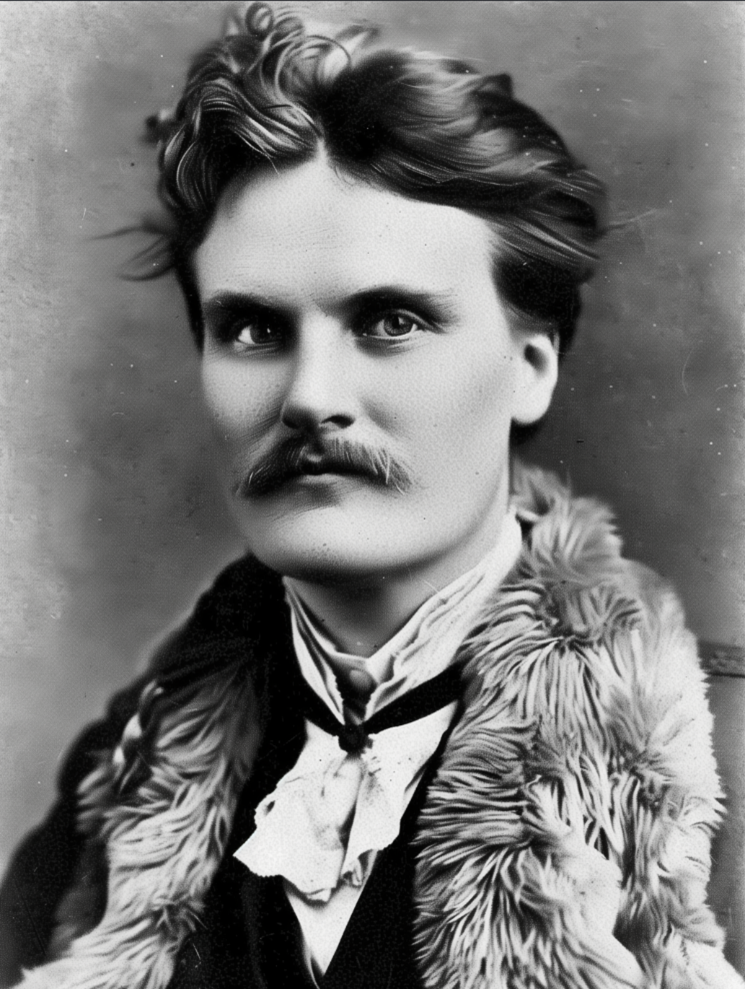
Die stetige Verfeinerung von Large-Language-Models, kurz LLMs, erlaubt zunehmend treffende Stilimitationen von Texten. Das gilt auch für die Schreibstile von Philosoph:innen. So lässt sich unlängst mit Sokrates oder Schopenhauer chatten – meist mit durchzogener Qualität und begrenzter inhaltlicher Tiefe.1 Unser Gastautor Tobias Brücker hat in den vergangenen Monaten versucht, mittels verschiedener KI-Methoden spannende Nietzsche-Texte zu generieren. Er wird im Folgenden einige dieser „neuen Nietzsche-Texte“ präsentieren, ihre Entstehung beschreiben und ein kurzes Fazit ziehen.
I. Schreiben mit LLMs
Im Rahmen meines privaten Schreibprojekts beabsichtige ich, mit verschiedenen KI-Sprachmodellen (LLMs) gezielt philosophische Texte zu generieren, die sich stilistisch und inhaltlich an Friedrich Nietzsche orientieren. Dabei geht es mir nicht bloss um philosophisch klingende Texte mit einigen Nietzsche-Buzzwords, wie das aktuell mit simplen Prompts bei ChatGPT geschieht. Mein Ziel ist es, differenzierte Texte zu erhalten, die sich literarisch, inhaltlich und kontextuell an bestimmten Werkphasen oder Textsorten (z. B. Sprüche, Aphorismen oder Briefe) orientieren. Hierzu trainiere ich KI-Modelle spezifisch mit Nietzsche-Texten, um stilistische und rhetorische Eigenheiten präziser zu erfassen.
Die folgenden Texte wurden mit dem Modell ChatGPT-4o mittels „Instruction Tuning“ generiert. Dies bedeutet, dass ich mit ausgewählten Beispielen und vielen Prompts mehr und mehr zum gewünschten Resultat gekommen bin. Zur Generierung einzelner und kurzer Textbeispiele reicht dies oft schon aus, während für ein systematisches Generieren ein Modell mit grösseren, aufbereiteten Datenmengen durch „Finetuning“ trainiert wird.2 Das technische Aufsetzen von lokal trainierten Modellen ist für Laien nach wie vor mit zeitraubenden Unwägbarkeiten verbunden und abhängig von leistungsstarker Hardware. Generell empfiehlt es sich, möglichst überschaubare Versuche zu unternehmen, um die Ergebnisse nachvollziehen und entsprechend kontrolliert optimieren zu können.3
II. Nietzsche-Aphorismen über Sorrent und Sizilien
Eine naheliegende Art der Neugier beim Imitieren besteht darin, sich zu fragen, was jemand über etwas gedacht oder gesagt haben könnte. Ich habe oft mit Landschafts-Aphorismen gearbeitet, weil diese offener formuliert werden können und nicht zwingend einer zugespitzten These folgen müssen. So versuchte ich, einen Aphorismus zur italienischen Stadt Sorrent zu generieren. Ich habe dazu drei zeitlich nah beieinander liegende Bücher nach geeigneten Textstellen zu Landschaften und Wandern durchsucht: den ersten Band von Menschliches, Allzumenschliches (14. April 1878), Vermischte Meinungen und Sprüche (12. März 1879) und Der Wanderer und sein Schatten (18. Dezember 1879). Die Ergebnisse waren anfangs holprig. Ich vermute deshalb, weil es sich bei Sorrent um eine konkrete Stadt handelt und damit die Beschreibung auf diese Konkretion passen musste. Auch die Betitelungen waren aphoristisch wenig ergiebig. Zudem kam hier die Gesprächigkeit von ChatGPT in den Weg, weshalb ich einige Male kürzend eingegriffen habe, um zu folgendem Resultat zu gelangen:
Surrentum ex umbra. – Der Süden im Rückzug, ein Winkel, wo selbst das Licht eine Pause macht: kühl, schattig, und doch still fordernd. Die Felsen beinah schwerelos, lehnen sich an – müde vielleicht, oder weise. Alles scheint hier halb gesagt. Der Wind flüstert von Vergangenem und stille Grotten träumen von Sirenen, die längst verstummt sind. Hier, wo jeder Gedanken betört wird, von Limonen und Orangen, aromatischen Düften. Hier wo nur die Farben klar sind – das Denken fabuliert.
Dieses Resultat musste optimiert werden. Mir gefiel zwar der grundsätzliche Mix an Themen gut – das südliche Sorrent, die schattenspendenden Bäume, die Felsen… Der Gegensatz von klaren sinnlichen Farben und betörtem geistigem Denken verlieh dem Text sogar ansatzweise eine aphoristische Pointe. Allerdings war die Orientierung am Aphorismus «Et in Arcadia ego» aus dem Wanderer und sein Schatten (Link) zu stark: Zu oft wird auf das Muster «Hier, wo…» zurückgegriffen. Zudem schien mir die Metapher der sich anlehnenden Felsen für Sorrent nicht schlüssig. So gelangte ich über vorgeschlagene Kürzungen und Verdichtungen sowie über die Suche nach einem Titel zu folgendem Ergebnis:
Fugit lux, Surrentum apparet. – Der Süden im Rückzug vor sich selbst. Hier, wo selbst das Licht innehält – kühl, schattig, und doch fordernd. Die Felsen halbhoch, geradlinig und beinah schwerelos: nicht stürzend, nicht trotzig – sondern alt, müde und klug geworden. Alles ist hier halblaut, halb gesagt. Der Wind flüstert vom Vergangenen. Die Grotten träumen vom Echo der Sirenen. Und dazwischen: Durchdringende Düfte nach Zitrone, Salz, Sonne.
Die Stilimitation gefiel mir hier gut, wobei die inhaltliche Bedeutsamkeit v. a. im Schlusssatz magerer wurde – zumal ein einzelner Aphorismus im Vergleich zu einer Aphorismen-Reihe in sich schlüssig sein muss. Die beiden Beispiele sollen deshalb zunächst bloss verdeutlichen, was ein LLM durch Imitation leisten kann und wie dies mit Prompts, Zielvorstellungen und geeigneten Materialien befördert werden kann.
In einer weiteren Versuchsreihe forderte ich ChatGPT auf, einen Aphorismus über Sizilien zu generieren. Einen solchen hat Nietzsche weder in Messina noch sonst wo geschrieben – und doch schien es mir zuweilen fast wie eine Lücke, dass ein solcher in Nietzsches Werken nicht vorliegt. So ist über mehrere Überarbeitungsstufen folgender Aphorismus generiert worden. Für das „Instruction Training“ habe ich hier zudem Beispiele anderer Ortsbeschreibungen Nietzsches, Briefstellen aus Messina sowie ein paar Auszüge aus historischen Reiseführern aus Nietzsches Bibliothek verwendet:
Sizilien. – Auf Siziliens Boden ringen zwei Mächte um die Seele des Wanderers: dort der Ätna, Sinnbild des dionysischen Feuers, der ewig schaffenden und zerstörenden Leidenschaft – hier die Tempel, Künder apollinischer Klarheit, in Stein gemeisselter Schönheit und Harmonie. Nur wer den Mut hat, sich im Feuer zu läutern, vermag auch die Höhen reinen Erkennens zu erklimmen und so, im Einklang mit dem Göttlichen, wahrhaft Mensch zu sein. Mancher verbrennt sich bei diesem Wagnis, verglüht im Übermass des Gefühls – doch wer wollte ihm seine Bejahung ausreden, die vom Dasein ihr Recht lieh?
Es wird hier ersichtlich, dass GPT-4o sehr gut mit Begriffspaaren arbeiten kann: apollinische Mächte, Tempel, Erkennen vs. dionysisches Feuer, Vulkan, Gefühl. Allerdings werden hier die Werkphasen vermischt, da der Nietzsche von 1878/79 längst nicht mehr so stark mit Dionysischem und Apollinischem argumentiert. Da in meinen Instruktionsbeispielen keine Zitate des frühen Nietzsche dabei waren, ist klar, dass ChatGPT einige Elemente aus Nietzsches Philosophie hinzugedichtet hat. Dies zeigt, dass LLMs tendenziell einen generischen bzw. Werkphasen vermischenden Autorenstil erzeugen, den sie gemäss ihrer Trainingsdaten errechnen. Dies schwächt das Ergebnis aus Sicht einer plausiblen werkkohärenten Imitation. Schwierig war auch stets der Schlusssatz, in welchem eine neue Pointe liegen sollte. Dies gelang erst nach einigen Anläufen einigermassen gut.
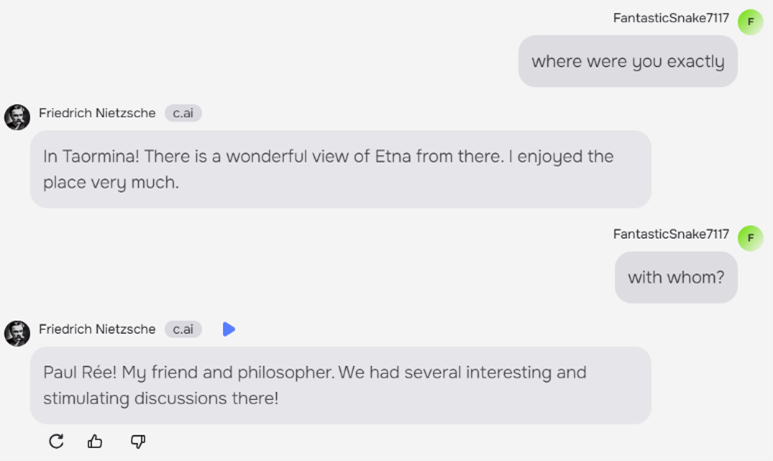
III. Zwei generierte Nietzsche-Sprüche aus der mittleren Phase
Ich erhielt durchgehend bessere Resultate, wenn ich mich auf kurze Formen und auf einen Stil festlegte: seien es Briefe, Aphorismen oder Sprüche. Mit einer Auswahl an Sprüchen aus Vermischte Meinungen und Sprüche (VM) liess ich GPT-4o dann einen neuen Spruch generieren. Meistens gleich zwei oder drei, damit ich einen für die weitere Verwendung auswählen konnte. Folgende zwei Sprüche gefielen mir:
Der Mensch ist Natur, die sich schämt – und Kultur, die sich entschuldigt.
Zwischen Trieb und Tugend flackert der Mensch.
Die Titel der Sprüche waren einmal mehr schwierig mit dem gleichen Prompt zu generieren. Mit einigen Nachfragen und Beispieltexten gelang es meiner Meinung nach dann aber gut, solche nachzuliefern oder nachzubessern. So wurde in folgendem Beispiel der erste Titel „Windbruch“ durch „Einzeln“ ersetzt, was konzis und passend wirkt:
Einzeln. – Manches fällt nicht, weil es schwach ist, sondern weil es frei steht.
Dieser Spruch regt zum Denken an, ergibt Sinn und kann mehrmals ergiebig gelesen werden. Vor allem das mehrdeutige „frei stehen“ (ungeschützt stehen, allein sein, frei sein etc.) lädt zu unterschiedlichen Interpretationen ein. Der Spruch fügt sich mit dem Verweisspiel von Vereinzelung („Einzeln“) und einer Freiheit („frei stehen“), die ihren Preis hat (z. B. freie Geister in Menschliches, Allzumenschliches), zudem passgenau in den Kontext des mittleren Nietzsches.
Ein weiteres Verfahren bestand darin, Originalstellen aus VM vom LLM zu einem neuen Spruch kombinieren zu lassen. Hier sind aufgrund des originalen Materials und der Vieldeutigkeit der Original-Sprüche erstaunlich gute Resultate generierbar. Sehr gelungen fand ich diesen:
Stille Pflicht. – Wer im Schatten des Grossen arbeitet, kennt den Glanz nicht, aber das Gewicht.
IV. Fazit und Ausblick
Mein Fazit lautet: LLMs können mit geeignetem Beispielmaterial und Instruktionen Nietzsches Stil in einzelnen kurzen Texten treffend imitieren. Bei steigender Komplexität und Textmenge wird es rasch schwieriger, sinnvolle Texte zu generieren – beispielsweise eine Reihe von 10 sich aufeinander beziehenden Aphorismen. Der Zusammenhang von Werkphasen, Stilen und zeitgenössischen Kontexten zu Nietzsches Werk erhöht die Plausibilität signifikant und macht die Resultate interessanter. Gerade die Kohärenz von Werkphasen ist aufgrund der bereits trainierten, generischen Nietzsche-Stile der vorgefertigten LLMs aber schwer herzustellen. Dies spricht für eigene Finetunings von LLMs. Hier waren meinen technischen Kompetenzen und zeitlichen Möglichkeiten bisher enge Grenzen gesetzt: Die von mir durch Finetuning trainierten Nietzsche-Generatoren erwiesen sich bisher als dürftig im Vergleich zum „Instruction-Tuning“ mit führenden Modellen wie ChatGPT oder Claude. Diese zeitaufwändigen Finetunings haben mir allerdings geholfen, immer besser zu verstehen, was ein LLM genau macht und wie ich es durch Prompts anleiten kann. Zudem lernt man philosophische Werke von einer anderen Seite her kennen, wenn man sie durch ein LLM verarbeiten lässt – dieser Lerneffekt ist nicht zu unterschätzen, v. a. für Personen, welche sich bisher ausschliesslich mit qualitativen und interpretativen Verfahren auseinandergesetzt haben. Da Finetuning zunehmend einfacher und zugänglicher wird, erwarte ich hier mittelfristig noch viel Potenzial.
Mich interessiert in diesem Stadium der technischen Entwicklung von LLMs einerseits die Auslotung der Möglichkeiten, andererseits die Haltung der (menschlichen) Lesenden, welche stets durch die Brille ihrer Autorvorstellungen lesen und interpretieren. Ich gehe deshalb bewusst noch nicht auf Chancen und Risiken für die wissenschaftliche Nietzsche-Forschung ein. Festhalten lässt sich für den Moment bloss: LLMs eröffnen zahlreiche Möglichkeiten, mit philosophischen Texten zu experimentieren. Solche Experimente mögen einigen als sinnlos vorkommen, weil es sich nicht um «originale» Zitate handelt oder weil sie errechnete Texte philosophisch nicht für relevant halten. An diesen Reaktionen wird sichtbar, wie unsere Vorstellungen von Autorschaft, Originalität oder menschlicher Herkunft die philosophische Autorschaftsvorstellung formieren. Diese Formationen bewegen sich im Fluss der Zeit. Ich würde mit Blick auf die pseudo-aristotelischen Schriften, die Pseudepigraphie oder die anonym publizierten Texte der Aufklärung nicht ausschliessen, dass sich der enge Blick auf philosophische Autorschaft und historisch-kritisch edierte «Gesamtwerke» ändern wird.
Tobias Brücker ist promovierter Kulturwissenschaftler und Leiter der HR-Personalentwicklung an der Zürcher Hochschule der Künste. Er hat zu Nietzsches Arbeitsweise geforscht und 2019 die Monografie Auf dem Weg zur Philosophie. Friedrich Nietzsche schreibt „Der Wanderer und sein Schatten“ publiziert. Er interessiert sich für alle Facetten von Diäten, Autorschaft und Kreativitätstechniken in der Philosophie und in den Künsten.
Zum Artikelbild
„Nietzsche–Salomé“ (KI-generiertes Bild, Tobias Brücker, 2024): Erstellt mit Midjourney auf Basis folgender historischer Fotografien: Friedrich Nietzsche (ca. 1875, Fotografie von Friedrich Hermann Hartmann, gemeinfrei) und Lou Andreas-Salomé (ca. 1897, Atelier Elvira München, gemeinfrei).
Fussnoten
1: So etwa auf character.ai | AI Chat, Reimagined–Your Words. Your World.
2: Die aufwändigen Arbeiten bei der Erstellung und dem Finetuning eines Nietzsche-Bots mit verschiedenen Volltexten unterschiedlicher Werkphasen wird hier dokumentiert: Building an Advanced Nietzsche AI Database | by Wayward Verities | Medium. Der daraus resultierende „Nietzsche Reference Bot“ ermöglicht es, mit den Volltexten Nietzsches über Chat zu interagieren und referenzierte Antworten zu erhalten, siehe hier: https://chat.openai.com/g/g-F62wnKW8A-nietzsche-reference-bot.
3: Wertvolle Einblicke in ein «Instruction Tuning» finden sich in diesem Erfahrungsbericht: I used AI to Generate Nietzschean Aphorisms | Towards AI
Also sprach die Maschine
Nietzsche imitieren mit KI
Die stetige Verfeinerung von Large-Language-Models, kurz LLMs, erlaubt zunehmend treffende Stilimitationen von Texten. Das gilt auch für die Schreibstile von Philosoph:innen. So lässt sich unlängst mit Sokrates oder Schopenhauer chatten – meist mit durchzogener Qualität und begrenzter inhaltlicher Tiefe.1 Unser Gastautor Tobias Brücker hat in den vergangenen Monaten versucht, mittels verschiedener KI-Methoden spannende Nietzsche-Texte zu generieren. Er wird im Folgenden einige dieser „neuen Nietzsche-Texte“ präsentieren, ihre Entstehung beschreiben und ein kurzes Fazit ziehen.
Warum sich viele nicht mehr für die Demokratie engagieren!
Individualismus als politische und soziale Gefahr bei Tocqueville und Nietzsche – aber auch als Chance
Warum sich viele nicht mehr für die Demokratie engagieren!
Individualismus als politische und soziale Gefahr bei Tocqueville und Nietzsche – aber auch als Chance


Individualismus, gar Egoismus sind in allen politischen, religiösen und sozialen Lagern verpönt. Sie werden dem Liberalismus und dem Kapitalismus zugeschrieben. Solche Menschen setzen sich nicht für andere ein, engagieren sich nicht politisch oder für die Umwelt. Sie huldigen auch keinem gemeinsamen Weltverständnis und verhalten sich dadurch verantwortungslos. Die Nietzscheanerin lässt sich von solchen Verdikten nicht beeindrucken. Sie tanzt – nicht nur!
„Die ganze Welt dreht sich um mich / Denn ich bin nur ein Egoist / Der Mensch, der mir am nächsten ist / Bin ich, ich bin ein Egoist“, singt Falco 1998.
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“
Was sagt Nietzsche 1888 dazu? „Man lebt für heute, man lebt sehr geschwind, – man lebt sehr unverantwortlich: dies gerade nennt man ‚Freiheit‘.“1 Unverantwortliche Leichtlebigkeit und tun zu können, wozu man gerade Lust hat, nicht heiraten und schon gar keine Kinder bekommen, keine Verpflichtungen eingehen, das ist La dolce vita.
Egoismus ist nicht dasselbe wie Individualismus. Historisch geht der Egoismus dem Individualismus voraus. Im Alten Testament findet sich das berühmte Gebot „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (3. Mose 19, 18), das Selbstliebe nicht verwirft, ja die Nächstenliebe auf die Selbstliebe stützt.
Wenn das Christentum dieses Gebot verschärft, nämlich „Liebet eure Feinde“ (Matthäus 5, 44), bleibt von der Selbstliebe nicht mehr viel übrig. Nichts mehr ist von einem selbstbewussten Egoismus zu sehen, wenn die Kirchenväter um 400 von den Gläubigen absoluten Gehorsam und die Beichte auch aller sündhaften Gedanken, nicht nur der Taten fordern: Das Ende des Egoismus!
Vom Individualisten Leonardo zum kapitalistischen Egoismus
Der Individualismus entsteht erst in der Renaissance: Ziel des Menschen ist seine allseitige Bildung und die Entfaltung seiner Fähigkeiten. Das verkörpert Leonardo da Vinci (1452-1519), uneheliches Kind aus bürgerlichen, nicht adligen Verhältnissen. Das Selbst erhält jetzt eine eigene Note, wodurch sich der Mensch aus den Glaubenszwängen zu befreien beginnt. Leonardo war Atheist und homosexuell. „Was die Menschen Liebe nennen, ist in Wirklichkeit die immer gleiche Schmierenkomödie der Natur“2, davon geht Leonardo nach Volker Reinhard aus. Mit diesem Individualismus wird der antike Egoismus in gemäßigter Form rehabilitiert.
Seinen Höhepunkt erreicht der egoistische Individualismus, wenn John Locke (1632-1704), dem Menschen als Individuum unveräußerliche natürliche Rechte attestiert. Das wichtigste davon ist das Recht auf Eigentum. Der Staat hat primär den Zweck, dieses zu schützen. Im Calvinismus gilt Reichtum sogar als Zeichen der göttlichen Gnade. Klartext schreibt Bernard de Mandeville (1670-1733), wenn er den ökonomischen Egoismus zwar als privates Laster bezeichnet, dieses aber zu öffentlichem Nutzen führe, also das Allgemeinwohl fördere.
Religiös konservative Kritik am Individualisten: Tocqueville
Damit wird der Grundstein zu einer heftigen Kritik am Individualismus gelegt, wenn der Liberalismus den Kapitalismus zur politischen Ökonomie des Bürgertums erhebt. Die schärfsten Kritiker des liberalen Individualismus entstammen zunächst dem religiös monarchischen Lager. Einer der Hauptvertreter ist der französische Politiker und politische Philosoph Alexis de Tocqueville (1805-1859).
So schreibt er 1835 in Über die Demokratie in Amerika: „Der Arme“ – verglichen mit dem Adel zählen dazu auch die Bürger – „hat die meisten Vorurteile seiner Vorfahren beibehalten, aber ohne ihren Glauben, ihre Unwissenheit ohne ihre Tugend; er hat die Lehre vom Privatinteresse zur Richtlinie seines Handelns gemacht, ohne ihre wissenschaftliche Grundlage zu kennen, und sein Egoismus ist ebenso bar aller Bildung, wie es einst seine Ergebenheit war.“ (S. 30) Ein derartiger Individualismus, wenn die Menschen ihren Glauben wie ihre Moral aufgegeben haben, verfolgt allein materielle Vorteile ohne Rücksicht auf andere und damit ohne Rücksicht auf den Staat.
Nietzsche: „Wer will“ „noch gehorchen?“
Hat der nur zwei Generationen jüngere Nietzsche knapp 50 Jahre später abgeschrieben? In seinem Corpus taucht Tocqueville zweimal auf, und zwar lobend.3 Denn Also sprach Zarathustra: „Wer will noch regieren? Wer noch gehorchen? Beides ist zu beschwerlich. Kein Hirt und Eine Heerde! Jeder will das Gleiche, Jeder ist gleich“4. Auch für Nietzsche kümmern sich die meisten Bürger nur noch um ihre privaten Interessen und sehen es gar nicht gerne, wenn sich ihrerseits Staat und Gesellschaft dabei einmischen.
So will das Bürgertum gar nicht regieren, überlässt das lieber dem Adel. Ende des 19. Jahrhunderts zweifeln Liberale wie der fleißige Nietzsche-Leser Max Weber (1864-1920) daran, dass das Bürgertum dazu überhaupt in der Lage ist, hat es dies nie gelernt, herrschte bis zur Französischen Revolution fast überall der Adel. Weil sich das Bürgertum nur für die Wirtschaft und den individuellen Vorteil interessiert, hat es keinen Blick für das Ganze. Wie kann es sich dann um das Gemeinwesen und das Allgemeinwohl kümmern? Der König dagegen – so Tocqueville – hatte sich genau darum noch gekümmert.
Eine solche Klage findet sich auch heute und fast in allen politischen Lagern: Liberalismus ist extrem unpopulär, Individualismus um so mehr und er wird des Egoismus bezichtigt. Beide werden gemeinsam dafür verantwortlich gemacht, dass sich die Menschen nicht mehr politisch engagieren und stattdessen ins Privatleben zurückziehen, dass sie Staat oder Gesellschaft nicht mehr dienen, sondern nur ihre Vorteile daraus ziehen wollen – gar den Kriegsdienst verweigern.
Nietzsche teilt Tocquevilles Kritik am Individualismus, nicht aber dessen Orientierung am Gemeinwohl, das Nietzsche in Frage stellt, während es bei Tocqueville im Vordergrund steht. Für Nietzsche ist das Gemeinwohl eine bürgerliche Illusion. Wie heißt es doch im Nachlass 1887/88: „‚Das Wohl des Allgemeinen fordert die Hingabe des Einzelnen’ . . . aber siehe da, es giebt kein solches Allgemeines!“5
Wertezerfall und der „letzte Mensch“
Tocqueville bemerkt dagegen nicht nur, dass es natürlich ein Gemeinwohl gibt, sondern dass just die Demokratie das Engagement der Menschen für das Allgemeinwohl besonders nötig hat, wie er es 1831 auf seiner Reise durch die USA beobachtet hatte. Denn gerade zur Demokratie aber gehören diverse Gemeinsamkeiten der Bürger – Frauen hatten noch gar keine Bürgerrechte –, die er in Frankreich vermisst. Er schreibt:
Es scheint, als habe man heute das natürliche Band zerrissen, das die Meinungen mit den Neigungen, das Tun mit dem Denken verbindet; der Einklang, der sich zu allen Zeiten zwischen den Gefühlen und den Vorstellungen des Menschen wahrnehmen ließ, scheint zerstört zu sein, und man ist fast geneigt zu sagen, dass alle Gesetze moralischer Verantwortlichkeit aufgehoben sind.6
Bis heute klagt man in religiösen, konservativen und rechten Kreisen über den Zerfall gemeinsamer sittlicher Werte und fordert eine „geistig-moralische Wende“. Tocqueville liefert als einer der ersten dazu die Argumente. Selber ungläubig, kritisiert er trotzdem die verbreitete Ungläubigkeit, da für ihn der gemeinsame religiöse Glaube für jeden Staat stabilisierend wirkt. Wenn die Leute aber nicht mehr religiös sind, dann verbindet sie ein solches Band nicht mehr.
Eine ähnliche Klage, die freilich in eine andere Richtung abdriftet, findet sich auch bei Nietzsche, wenn er die Masse seiner Zeitgenossen als „letzte Menschen“ bezeichnet, weil sie nur noch materialistische Interessen verfolgen. Nietzsche schreibt: „Seht! Ich zeige euch den letzten Menschen. ‚Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?‘ – so fragt der letzte Mensch und blinzelt. Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der Alles klein macht“7, und einem Massenindividualismus huldigt.
Doch während Tocqueville die Wiederkehr religiöser Werte beschwört, will Nietzsche diese hinter sich lassen, fordert aber neue ethische Werte, die es zu erfinden gelte. Das ist für Nietzsche denn auch nicht erst die Aufgabe des Übermenschen, sondern derjenigen, die seiner Lehre folgen und diese verkünden sollen. Hier trennen sich die Wege Tocquevilles und Nietzsches. Denn Tocqueville hält die traditionellen Werte eigentlich für richtig, während neue Werte, die die Menschen selber erfinden, Ausdruck von Individualismus sind.
Doch gibt es noch weitere Gemeinsamkeiten zwischen Tocqueville und Nietzsche. Denn auch dieser lässt längst nicht alle Traditionen einfach hinter sich. Tocqueville macht den Individualismus dafür verantwortlich, dass sich die Familienbande auflösen, weil es auch innerhalb von Familien nur noch ums Geld geht und die Bereitschaft sinkt, für die Familie Opfer zu bringen.
Dagegen legt Nietzsche seine Kritik von vornherein breiter an. Wo Tocqueville primär den Individualismus, nicht den Liberalismus per se, da er gewisse liberale Grundannahmen teilt, verantwortlich macht, kritisiert Nietzsche den Liberalismus selbst, was den Individualismus der „letzten Menschen“ miteinbezieht, nicht aber jenen der Verkünder des Übermenschen, die von dem, was er im folgenden Zitat schreibt, nicht berührt werden:
Damit es Institutionen giebt, muss es eine Art Wille, Instinkt, Imperativ geben, antiliberal bis zur Bosheit: den Willen zur Traditionen, zur Autorität, zur Verantwortlichkeit auf Jahrhunderte hinaus, zur Solidarität von Geschlechter-Ketten vorwärts und rückwärts in infinitum.8
Das ist freilich nicht mehr der Fall. So beklagt auch Nietzsche den Niedergang der Institution der Familie durch den bürgerlichen Individualismus ähnlich wie Tocqueville. Andererseits ist er auch Kritiker der Familie. Wie erzählt doch Zarathustra: „So sprach mir ein Weib: ‚wohl brach ich die Ehe, aber zuerst brach die Ehe – mich!‘“9
Die freie Meinungsäußerung als Schwächung des Staates
Der Individualismus führt für Tocqueville außerdem dazu, dass sich die Menschen einbilden, über alles und jedes selber Urteile fällen zu können. Das fördert aber gegenseitiges Misstrauen. In der Öffentlichkeit werden keine Autoritäten mehr anerkannt. Damit antizipiert bereits Tocqueville für Sarah Strömel die Lage der Demokratien heute. Sie schreibt:
Dieses profunde Misstrauen in die Erkenntnisse anderer, seien sie noch so etablierte oder ausgewiesene Experten und auch der generelle Vertrauensmangel gegenüber anderen, gefährden den Zusammenhalt in der Demokratie. Die maßlose Selbstüberschätzung, die damit einhergeht, macht die Individuen zusätzlich blind für die eigene Ignoranz.10
Bereits 1872 kritisiert Nietzsche die Bildungsanstalten auf ähnliche Weise, sie würden die Menschen dazu erziehen, eine eigene Meinung zu haben und damit zur Selbstüberschätzung beitragen, wie es Strömel moniert. Er schreibt:
Hier wird jeder ohne Weiteres als ein litteraturfähiges Wesen betrachtet, das über die ernstesten Dinge und Personen eigne Meinungen haben dürfte, während eine rechte Erziehung gerade nur darauf hin mit allem Eifer streben wird, den lächerlichen Anspruch auf Selbständigkeit des Urteils zu unterdrücken und den jungen Menschen an einen strengen Gehorsam unter dem Scepter des Genius zu gewöhnen.11
Erziehung sollte dazu beitragen, dass man Autoritäten, Nietzsches geniale Menschen, und deren Meinungsführerschaft anerkennt und deren Auffassung übernimmt, ohne diese zu hinterfragen. So radikalisiert Nietzsche die Einschätzung von Tocqueville noch, wenn er sich 1886 über „die Einführung des parlamentarischen Blödsinns, hinzugerechnet die Verpflichtung für Jedermann, zum Frühstück seine Zeitung zu lesen“12, beklagt.
Hinsichtlich der Demokratie zeigt sich Tocqueville gespalten, neigt er doch zum Monarchismus. Anders als Nietzsche erkennt er aber die Demokratie an, die sich im zeitgenössischen Staat ausgebreitet hat. Für Tocqueville ist eine gemeinsame Weltauffassung für die Demokratie jedenfalls unabdingbar. In der absolutistischen Monarchie vor der Französischen Revolution leistete das der Katholizismus. Ganz anders sieht das Nietzsche auch nicht. Er schreibt 1888:
Es gibt keine andre Alternative für Götter: entweder sind sie der Wille zur Macht – und so lange werden sie Volksgötter sein – oder aber die Ohnmacht zur Macht – und dann werden sie notwendig gut.13
Dadurch verliert die Religion ihre leitende Kraft, kann sie den Glauben und oberste ethische Werte nicht mehr allgemein durchsetzen. Søren Kierkegaard kritisiert die Kirchen 1850, dass sie einen lieben Gott verkünden, der doch nur ein strafender Gott sein kann. Nietzsche sieht das ähnlich, während Tocqueville zwar einen Glaubensverlust beklagt, noch nicht aber im Sinn von Kierkegaard und Nietzsche die Verwandlung des strafenden Gottes in einen barmherzigen.
Von der Monarchie zur Demokratie
Tocqueville stellt fest, dass sich die allgemeine Lage im Ancien Régime ständig verbesserte. Aber um so mehr wuchs die Unzufriedenheit. „Reform frustriert und macht rebellisch“, schreibt Karlfriedrich Herb und er fügt hinzu, dass Tocqueville bemerkt, „wie der Abbau gesellschaftlicher Ungleichheit das Unbehagen gegenüber der verbleibenden Ungleichheit steigert.“14 So ist nach Herb das „Ancien Régime“ für Tocqueville „eine Revolution vor der Revolution.“15 Eigentlich hat die Monarchie das Regieren besser verstanden, vor allem war sie freundlicher gegenüber den Untertanen als die Demokratie.
Denn in der Monarchie war die Macht des Königs erheblich beschränkter als in der Demokratie und zwar durch Tradition, den mitregierenden Adel und durch die Institutionen. So konstatiert Tocqueville: „Kein Monarch ist so unumschränkt, dass er alle Kräfte der Gesellschaft in seiner Hand vereinigen und allen Widerstand so überwinden könnte, wie es eine Mehrheit mit dem Recht der Gesetzgebung und Gesetzesvollziehung kann.“16 In demokratischen Staaten gibt es zwar diverse Formen der Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. Doch hat sich die Gewaltenteilung höchstens hinsichtlich der Judikative und auch nur teilweise durchgesetzt. In den USA, in Ungarn und Polen versucht man gar, die Autonomie der Justiz auszuhebeln.
In seiner später Schrift L’Ancien Régime et la Révolution aus dem Jahr 1856 schätzt Tocqueville die demokratischen Institutionen, während er den Bürgern misstraut. So zweifelt Tocqueville nach Herb auch daran, dass sich die Demokratie durchsetzen wird. Herb schreibt: „Ein liberales Ende der Geschichte hält Tocqueville für illusorisch.“17 Daher kann der Traum von Francis Fukuyama 1989 nicht in Erfüllung gehen, dass nach dem Ende der Sowjetunion die Welt demokratisch wird; denn so Fukuyama: „Der liberale Staat ist notwendig universal“18. Zur Zeit sieht es in der Tat nicht mehr danach aus. Die demokratischen Systeme stehen heute eher unter Druck. Für Nietzsche wäre das wahrscheinlich kein Problem. Tocqueville dagegen prophezeit eine solche Entwicklung, die er bedauert hätte.
Von der Demokratie zur Diktatur
Eine Gefahr sowohl für die Monarchie als auch für die Demokratie sieht Tocqueville in der Zentralisierung der Staaten. Er schreibt: „Ich vermag mir für meinen Teil nicht vorzustellen, dass eine Nation ohne starke Regierungszentralisierung leben oder gedeihen kann. Aber ich glaube, dass eine zentralisierte Verwaltung zu nichts anderem taugt, als die ihr unterworfenen Völker zu schwächen, denn sie vermindert in ihnen ohne Unterlass den Bürgergeist“19 und verschärft dadurch den Rückzug ins Private.
Ohne Zentralisierung und Bürokratisierung ist kein Staat zu machen. Doch beide engen die Spielräume der Monarchie wie der Demokratie ein. Das enttäuscht die Bürger, die sich nicht mehr politisch engagieren. So erleben sie sich als vereinzelte Individuen. Man könnte dabei an die heutige Volksrepublik China denken.
Dagegen sind für Tocqueville in der Monarchie alle ungleich, aber in ein Netz eingebunden, das ihnen Halt gibt und Sinn verleiht. Für Nietzsche gilt eine ähnliche, aber noch viel radikalere Ablehnung der Gleichheit. Er schreibt 1888:
Die Lehre von der Gleichheit! . . . Aber es giebt gar kein giftigeres Gift: denn sie scheint von der Gerechtigkeit selbst gepredigt, während sie das Ende der Gerechtigkeit ist . . . „Den Gleichen Gleiches, den Ungleichen Ungleiches – das wäre die wahre Rede der Gerechtigkeit: und, was daraus folgt, Ungleiches niemals gleich machen.“20
Auch für Nietzsche individualisiert die Gleichheit die Menschen mit der Folge, dass sie keine Autoritäten mehr anerkennen. Nur dass Nietzsche nicht den Schaden bedauert, den die Demokratie dabei nimmt. Vielmehr eröffnet sich dadurch die Chance, den Weg zu einer Monarchie zurückzufinden, die er sich freilich von einem genialen König geführt wünscht, den er gegen Ende seines wachen Lebens 1888 in Wilhelm II. nicht erkennen kann.
Nietzsches Tänzer als individualistische Elite
Aber es gibt noch einen deutlichen Unterschied zu Tocqueville. Nietzsche ist kein schlichter Gegner von Individualismus und Egoismus wie Tocqueville. Nietzsche sieht das differenzierter. Ja, er lobt sogar den Egoismus, den er individualistisch ausweitet, was man heute vor allem in der Medienwelt findet. Also sprach Zarathustra:
Und damals geschah es auch, – und wahrlich, es geschah zum ersten Male! – dass sein Wort die Selbstsucht selig pries, die heile, gesunde Selbstsucht, die aus mächtiger Seele quillt: – aus mächtiger Seele, zu welcher der hohe Leib gehört, der schöne, sieghafte, erquickliche, um den herum jedwedes Ding Spiegel wird: der geschmeidige überredende Leib, der Tänzer, dessen Gleichnis und Auszug die selbst-lustige Seele ist. Solcher Leiber und Seelen Selbst-Lust heißt sich selber: „Tugend.“21
Ergo: Let’s Dance (RTL)? Aber Frauen meint Nietzsche damit nicht. Es ist noch nicht die Zeit von Marilyn Monroe oder Claudia Schiffer – zwei von vielen Superschönheiten unter den Film- und Modelstars. Aber ob bei Nietzsche ‚der schöne Leib des Tänzers‘ oder die extensive Sexyness in der RTL-Tanzshow, beides setzt voraus, dass man den Körper schminkt und stylt, wiewohl sich für Nietzsche dergleichen eher der Lebendigkeit verdankt.
Trotzdem wäre das für den konservativen Tocqueville wahrscheinlich außerhalb dessen, was er anerkennt – wie die Konservativen in den 1980er Jahren eine geistig-moralische Wende forderten. Aber soweit konnte Tocqueville noch nicht voraussehen. Nietzsche dagegen ist dafür offener.
Schönheit präsentiert das Individuum als ein besonderes, das sich von anderen nicht bloß unterscheidet, sondern auch noch herausragt. Hier begegnen sich Individualismus und Egoismus bzw. Selbstsucht. Sich um die eigene Schönheit zu bemühen, realisiert den Egoismus im Individualismus. So schreibt Jean Baudrillard:
Die Kirchenväter haben das gut verstanden, da sie es als etwas gegeißelt haben, das des Teufels ist: „Sich mit seinem Körper beschäftigen, ihn pflegen, ihn schminken, das bedeutet, sich zum Rivalen Gottes aufzuwerfen und die Schöpfung anzufechten.“22
Damit hätte Nietzsche kein Problem. Doch den medialen Klamauk einer Freitagabendtanzshow würde er dem Ambiente der „letzten Menschen“ zuschreiben. Aber es geht Nietzsche nicht nur um die schöne Seele, sondern auch um die schönen Körper, die sich heute weniger der Natur als Techniken verdanken. Mit ihrem Individualismus und Egoismus gehören die Verkünder seiner Lehre, zu denen heute natürlich auch Verkünderinnen zählen, jenseits des medialen Marktes denn auch eher einer kleinen Elite an.
Nachwort: der überall unbeliebte Individualismus
Tocqueville würde Nietzsches Gefolge dagegen dem unpolitischen Individualismus zuschreiben, der eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Dabei hätte er viele Fürsprecher. Besonders kriegerische Staaten betonen gemeinschaftsorientierte Werte, wahrlich nicht nur Russland mit der kinderreichen Familie. Das nationalsozialistisch beherrschte Deutschland vergab das Mutterkreuz in Bronze für vier oder fünf Kinder für deren arische und sittlich einwandfrei lebende Mutter. Gemäß ihrem Grundsatzprogramm will die Alternative für Deutschland die Geburtenrate durch finanzielle Anreize erhöhen. So gerät Tocqueville in eine unerfreuliche Nachbarschaft, von der sich Nietzsche durch seine Anhängerschaft befreit und damit auch von einer vergangenen Lesart seiner Werke als Nazi-Philosoph.
Quellen
Baudrillard, Jean: Von der Verführung (1979). München 1992.
Fukuyama, Francis: Das Ende der Geschichte – Wo stehen wir? München 1992.
Herb, Karlfriedrich: Alexis de Tocqueville, Der alte Staat und die Revolution (1856); in: Manfred Brocker (Hrsg.): Geschichte des politischen Denkens. Das 19. Jahrhundert. Berlin 2021.
Reinhardt, Volker: Leonardo da Vinci – Das Auge der Welt – Eine Biographie. München 2018.
Strömel, Sarah Rebecca: Tocqueville und der Individualismus in der Demokratie. Wiesbaden 2023.
Tocqueville. Alexis de: Der alte Staat und die Revolution (1856). München 1989.
Ders.: Über die Demokratie in Amerika (1835/40). Stuttgart 2021.
Fußnoten
1: Götzen-Dämmerung, Streifzüge, 39.
2: Leonardo da Vinci, S. 272.
3: Vgl. diese Stelle im Nachlass und jenen Brief an Overbeck.
4: Also sprach Zarathustra, Vorrede, 5.
5: Nachgelassene Fragmente 1887/88, Nr. 11[99].
6: Über die Demokratie in Amerika, S. 31.
7: Also sprach Zarathustra, Vorrede, 5.
8: Götzen-Dämmerung, Streifzüge, 39.
9: Also sprach Zarathustra, Von alten und neuen Tafeln, 24.
10: Tocqueville und der Individualismus in der Demokratie, S. 97.
11: Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten, Vortrag 2.
12: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 208.
14: Alexis de Tocqueville, Der alte Staat und die Revolution, S. 455.
15: Ebd., S. 450.
16: Über die Demokratie in Amerika, S. 180.
17: Alexis de Tocqueville, Der alte Staat und die Revolution, S. 446.
18: Das Ende der Geschichte – Wo stehen wir?, S. 280.
19: Über die Demokratie in Amerika, S. 76.
20: Götzen-Dämmerung, Streifzüge, 48.
21: Also sprach Zarathustra, Von den drei Bösen, 2.
22: Von der Verführung, S. 128.
Warum sich viele nicht mehr für die Demokratie engagieren!
Individualismus als politische und soziale Gefahr bei Tocqueville und Nietzsche – aber auch als Chance
Individualismus, gar Egoismus sind in allen politischen, religiösen und sozialen Lagern verpönt. Sie werden dem Liberalismus und dem Kapitalismus zugeschrieben. Solche Menschen setzen sich nicht für andere ein, engagieren sich nicht politisch oder für die Umwelt. Sie huldigen auch keinem gemeinsamen Weltverständnis und verhalten sich dadurch verantwortungslos. Die Nietzscheanerin lässt sich von solchen Verdikten nicht beeindrucken. Sie tanzt – nicht nur!
Nietzsche und die intellektuelle Rechte
Ein Dialog mit Robert Hugo Ziegler
Nietzsche und die intellektuelle Rechte
Ein Dialog mit Robert Hugo Ziegler


Nietzsche wurde von rechten Theoretikern und Politikern immer wieder zur Galionsfigur erhoben. Von Mussolini und Hitler bis hin zur AfD – immer wieder wird Nietzsche in Beschlag genommen, wenn es darum geht, der modernen Gesellschaft eine radikale reaktionäre Alternative entgegenzustellen. Besonders faszinierte Nietzsche die intellektuelle Rechte, etwa Autoren wie Ernst Jünger, Carl Schmitt und Martin Heidegger, die in den 20er Jahren ein kulturelles Vorfeld des aufziehenden Nationalsozialismus bildeten, auch wenn sie sich später von ihm teilweise distanzierten. Oft spricht man auch von der „Konservativen Revolution“1.
Was entnehmen diese Autoren Nietzsche und inwiefern lesen sie ihn einseitig und übersehen andere Potentiale in seinem Werk? Unser Autor Paul Stephan sprach darüber mit dem Philosophen Robert Hugo Ziegler.
I. Mythenmacher
Paul Stephan: Sehr geehrter Herr Professor Ziegler, Sie haben im vergangenen Jahr die umfangreiche Studie Kritik des reaktionären Denkens publiziert, die erfreulicherweise auf der Verlagsseite kostenlos heruntergeladen werden kann (Link). Sie entwickeln dort nicht nur eine allgemeine Theorie reaktionären Denkens, sondern stellen auch einige seiner Klassiker vor. Neben „üblichen Verdächtigen“ wie Ernst Jünger (1895–1998), Carl Schmitt (1888–1985) oder Martin Heidegger (1889–1976) widmen Sie auch Nietzsche ein eigenes Kapitel. Das mag manche überraschen, andere weniger. Wie kommen Sie dazu, Nietzsche zu den Vertretern eines reaktionären Denkens zu rechnen?
Robert Ziegler: In der Tat würde ich Nietzsche nicht zu den reaktionären Autor*innen im engen Sinn rechnen. Nietzsche taucht in meiner Rekonstruktion als wichtiger Stichwortgeber und Vorbereiter für das reaktionäre Denken auf. Das lässt sich auf mehreren Ebenen nachweisen: Bekannt sind ja die zahlreichen und wortgewaltigen Invektiven, die Nietzsche gegen die Moderne, gegen Frauen, gegen alles, was nach Demokratie oder Egalitarismus riecht, gerichtet hat. Zum Theorieinventar späterer rechter Autoren gehört dann vor allem die Entgegensetzung der großen, starken Einzelnen und der schwachen, geistlosen Masse, die geführt werden muss und will – ein Motiv, dass von Nietzsche sehr regelmäßig bedient wird. Nietzsches radikaler Individualismus, der sich als Kampf gegen ganze Epochen und ihre Vorurteile versteht, lädt zu einer heroisierenden Selbstinszenierung ein, an der sich viele Spätere berauscht haben. Auch einzelne Themen wie die Nihilismus-Diagnose hatten und haben im rechten Denken Konjunktur.
Das alles ist recht offenkundig und bekannt. Folgenreicher scheint mir aber ein anderer Aspekt: Nietzsche kommt immer wieder, besonders konzentriert und prominent in Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne (Link), auf den Gedanken zu sprechen, dass, was wir Wahrheit nennen, das Produkt sprachlicher Interpretationen von Wirklichkeit ist. Damit hat Nietzsche einerseits eine zutiefst verunsichernde Diagnose gestellt, für die er andererseits einen möglichen Ausweg andeutet: Wenn alle Wahrheit ohnehin „Lüge“ oder Mythos ist, Produkt der Sprache mehr als unserer Erkenntnisbemühungen, noch dazu geleitet von vitalen Bedürfnissen – was hindert uns daran, die Bodenlosigkeit dieser Situation durch die Erfindung möglichst eindrücklicher und intensiver Mythen zu überwinden? Da ich die Reaktion primär als eine literarische Strategie begreife, die mit möglichst starken Mitteln einer ontologischen Unsicherheit zu begegnen sucht, lässt sich im Rückblick sagen, dass die Methode der Reaktion durch Nietzsches diesbezügliche Einlassungen geadelt wird.
PS: Man soll also aus dieser Sicht den Herausforderungen der Moderne durch die Kreation neuer Mythen begegnen? Faszination an die Stelle von Befreiung treten lassen? Oder genauer: In der Faszination eine Form der Pseudobefreiung von diesen Herausforderungen erleben? Diese Interpretation liegt aus meiner Sicht nahe, auch wenn sich Nietzsche oft als Aufklärer und „Mythenzerhämmerer“ inszeniert. Es scheint ihm ja eher darum zu gehen, die tradierten, unglaubwürdig gewordenen Mythen zu zerstören und an ihre Stelle neue treten zu lassen wie den „Willen zur Macht“, den „Übermenschen“ und die „ewige Wiederkunft“. Auch die progressiven Ideen der modernen Emanzipationsbewegungen stellen sich aus dieser Sicht als Mythen dar, allerdings „alte[] Weiber“2, keine lebensbejahenden. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt: Ist die Kraft des Mythologischen denn notwendig eine reaktionäre Kraft? Hat Nietzsche nicht vielleicht sogar recht damit, dass auch die linken Bestrebungen ihre Energie aus bestimmten Mythen gewinnen? Sogar bei Friedrich Engels (1820–1895) etwa wird eine Parallele zwischen der Arbeiterbewegung und dem Urchristentum hergestellt3 und er interessiert sich – wie interessanterweise auch Nietzsche – sehr für den von Nietzsches Baseler Kollegen Johann Jakob Bachofen (1815–1887) entdeckten bzw., kritisch gesagt, erfundenen Mythos vom Urmatriarchat4. Und man könnte hier eine Unzahl weiterer Beispiele anführen.
RZ: Ich würde die Frage in zwei auseinanderlegen wollen. Zum einen bin ich in der Tat unsicher, ob es so etwas wie „linke Mythen“ geben kann. Es gibt, das ist wahr, immer die Versuchung, in Urzeiten und vor allem am erhofften Ende der Geschichte Gesellschaftsformen zu imaginieren, in denen die Gegensätze, Widersprüche und Kämpfe endlich zu einem Ende gekommen sind. Doch ob die Utopie den emanzipatorischen Bewegungen gutgetan hat, scheint mir nicht ausgemacht. Was die Geschichtsphilosophie angeht, halte ich die Warnungen Walter Benjamins (1892–1940) vor der Idee des Fortschritts für schwer zu ignorieren.
Zum anderen aber, um auf die reaktionären Denker zurückzukommen, hat die Literarisierung von Politik dort eine ganz charakteristische Gestalt: Sie ist erstens undurchschaut. Autoren wie Jünger oder Schmitt halten ihre Äußerungen gerade nicht für Konstrukte, Interpretationen oder neue Mythen, sondern im Gegenteil für die Zertrümmerung aller Illusionen und die Präsentation der nackten Wahrheit. Dass dieses theoretische Großreinemachen einen gewaltsamen Zug schon auf der Theorieebene hat, macht dabei offenkundig einen wichtigen Aspekt des Genusses aus. Zweitens nämlich kreisen reaktionäre Texte stets um die Motive von Kampf, Krieg, Feindschaft, Blut, Gewalt, Entscheidung, Tod. In der unablässigen (und oft ermüdenden) Evokation der Wirklichkeit als gnadenlosem Kampf versichert sich die Reaktion der übergeschichtlichen Wahrheit – einer Wahrheit, die entschieden antizivilisatorisch ist und primär durch die literarische Inszenierung Kraft gewinnt.
Was die Reaktion nun aus Nietzsche entnehmen konnte, wenn man ihn entsprechend las, war, dass man mit dem nötigen rhetorischen Nachdruck alles zur Wahrheit erheben konnte. Die Reaktion bedient sich also sowohl rhetorisch als auch motivisch – Nietzsche hatte bekanntlich ebenfalls eine Schwäche für bellizistische Terminologie, auch wenn sie oft metaphorisch verwendet wird – als auch methodisch bei Nietzsche.
Mein Zweifel daran, dass man aus linker Perspektive ungestraft Mythen stricken kann, lässt sich am Beispiel von Georges Sorel (1847–1922) verdeutlichen: Sorel stand politisch „eigentlich“ dem Syndikalismus nahe, ließ sich aber mehrfach von offen rechtsextremen Bewegungen und Organisationen faszinieren. Seine Überlegungen Über die Gewalt propagieren relativ offen die Strategie, mithilfe alter oder neuer Kampfesmythen Massenbewegungen zu mobilisieren. Hier ist die Strategie also klar ausgesprochen, und zugleich wird ihre Schwachstelle deutlich: Mythenbildung, Mobilisierung und gewaltsame Auseinandersetzung drohen zum eigentlichen Zweck zu werden. Inhalte sind dann relativ beliebig, eine konsistente linke Position lässt sich jedenfalls damit nicht durchhalten. Es überrascht dann wenig, dass sich Schmitt recht positiv auf Sorel bezieht.
PS: Ja, wie auch Mussolini (1883–1945), der ja auch ein großer Bewunderer Nietzsches gewesen ist.5 – Aber vielleicht gehen wir einen Schritt zurück an dieser Stelle. Eine große Stärke Ihrer Studie besteht ja darin, dass Sie den Begriff der „Reaktion“ philosophisch zu definieren und ihn so einer gewissen Beliebigkeit, mit der er bisweilen gebraucht wird, zu entreißen versuchen. Es wurden bisher einige wichtige Merkmale Ihres Begriffs des „reaktionären Denkens“ deutlich. Es handelt sich um die literarische Strategie der Konstruktion neuer Mythen – vor allem Mythen der Gewalt, des Krieges, vielleicht auch der Männlichkeit –, mit deren affektiver Kraft emanzipatorische Ideen untergraben und an ihrer Stelle neue „Wahrheiten“ etabliert werden sollen. Wobei es sich nicht um eine bewusste Strategie im Sinne einer zynischen Manipulation handelt. Ist das Ihres Erachtens bereits das Wesen reaktionären Denkens oder fehlt da noch ein wichtiges Element?
II. Die rote Pille
RZ: So wie ich reaktionäres Denken verstehe, reicht es nicht, seine Elemente zu verzeichnen. Vielmehr muss es als eine ganz spezifische Bewegung begriffen werden: Mir ist aufgefallen, dass die reaktionären Autor*innen immer wieder einen ontologischen Horror artikulieren. Sie ahnen oder wissen sogar, dass das Wirkliche vielleicht gar nicht im engen Sinn ist. Was sie umtreibt, ist die Möglichkeit einer umfassenden Unwirklichkeit. Das kann ganz philosophisch daherkommen, wie Heideggers „Uneigentlichkeit“, oder offen politisch, wie Schmitts Abfertigung des Parlamentarismus als einer leeren Form, die nur noch nicht mitbekommen hat, dass sie längst tot ist, oder irgendwo dazwischen, wie bei Jünger, bei dem wohl der „Arbeiter“ eine überzeitliche „Gestalt“ ist, nicht aber der Bürger: Das Bürgerliche existiert nicht im vollen Sinn. Bei Ayn Rand (1905–1982) schließlich sind es nur die großen Einzelnen, die wahrhaft sind; alle anderen werden von der Gewissheit ihres Nichtseins heimgesucht.
Die extremen Rechten bemühen bis heute ganz ähnliche Motive: So gibt es die Rede von einem „Interregnum“, in dem wir angeblich leben, also einer bloßen Zwischenphase zwischen zwei wahrhaften, legitimen Reichen. Oder man erklärt, dass dies ja wohl nicht mehr Deutschland sei. Wenn man solche und ähnliche Phrasen abtut, macht man es sich zu leicht. Ich schlage deshalb vor, sie ganz wörtlich zu verstehen. Dann begreift man auch, weshalb das reaktionäre und rechte Denken so gut anschlussfähig ist für Verschwörungstheorien aller Art und jedweder Absurdität: Sie teilen ja die Grundvoraussetzung, dass das Erscheinende nicht volle Wirklichkeit beanspruchen kann.
Freilich, wenn man sich einmal in diese Lage manövriert hat, kommt man nicht mehr gut aus ihr heraus: Alle Hilfe im Realen muss verdächtig werden, da dieses selbst ja suspekt ist. Es bleibt letztlich nur eine literarische Strategie: eine Versicherung des schwindenden Seins durch die ästhetische Evokation. Da tatsächlich das Sein als solches unsicher wird, helfen nur noch die stärksten Gegenmittel, deshalb bedient sich der reaktionäre Diskurs intuitiv bei solchen Ausdrucksformen, die den Affekt des Erhabenen herstellen. Reaktionäres Denken ist also die Bewegung, die von dem Horror des Seinsverlustes mit den Mitteln der literarischen (Auto-)Suggestion in den Affekt des Erhabenen ausweicht.
Ein Vorteil des Begriffs des Reaktionären ist gerade, dass er im Deutschen kaum eine strenge Bestimmung hat. Dadurch ist es möglich, ihm eine präzise philosophische Bedeutung zu geben, die sich gewissermaßen im vorpolitischen Feld bewegt. Denn reaktionäres Denken unterhält deutliche Affinität zu rechter und rechtsextremer Politik und Ideologie, ist aber mit ihnen nicht identisch.
III. Macht – Nietzsche vs. Spinoza
PS: Besonders „wegweisend“ in dieser Hinsicht ist aus Ihrer Sicht ja Nietzsches Konzeption des „Willens zur Macht“ als Inbegriff der „wahren Wirklichkeit“ gegenüber den Scheinrealitäten der Sklavenmoral, der entfremdeten Welt des Nihilismus. Haben wir es dabei womöglich mit einem Modell reaktionären Denkens zu tun? Oder lässt er sich auch anders interpretieren?
RZ: Bekanntlich wurde er gerne und oft so interpretiert: als Freibrief für theoretische wie praktische Rücksichtslosigkeit. Man konnte dafür in der Tat auch Stellen bei Nietzsche finden; mir scheint, dass er selbst sich nicht ganz klar war, wie er den Willen zur Macht verstanden wissen wollte. Denn man kann ihm auch eine ganz andere Deutung geben: An vielen Stellen dekonstruiert Nietzsche die Vorstellung eines autonomen Handlungssubjekts und die Hypostasierung eines „Willens“. Stattdessen stellt sich die Wirklichkeit eher als ein unendliches Gewebe nicht Ich-hafter Zentren oder Knoten von Mächtigkeit dar, die miteinander in ununterbrochener Interaktion stehen. Unter „Macht“ kann man dann nicht sinnvoll Herrschaft oder Unterwerfung verstehen („potestas“/„pouvoir“), sondern gewissermaßen einen Wirkungskoeffizienten, der zugleich Wirklichkeit ist und schafft („potentia“/„puissance“). Wählt man diesen Weg, dann ist der „Wille zur Macht“ deutlich näher an Spinoza (1632–1677) als am Faschismus.
PS: Statt „Wille zur Macht“ also „Wille zum Können“ oder auch „Wille zur Wirklichkeit“? Folgt aus dieser „spinozistischen“ Lesart des „Willens zur Macht“ für Sie eine mögliche nicht- oder sogar antifaschistische Interpretation von Nietzsches gesamter Philosophie?
RZ: Ich fürchte, es gibt keine ganz geraden Wege von der Metaphysik zur Politik und umgekehrt; ebenso sollte man der Versuchung widerstehen, allzu eindeutige (v.a. politische) Kategorisierungen vorzunehmen. Gleichwohl führt die angedeutete Lesart des „Willens zur Macht“ zu einer Sicht auf das Wirkliche, die sich immer wieder ausdrücklich bei Nietzsche findet (und die ihn im Übrigen wieder mit Spinoza verbindet): In dieser Sicht herrscht ein absoluter Primat der Positivität im Sein. Wirkliches ist, und als solches bekräftigt es sich unablässig. Alle Negativitäten – egal ob es sich um das Ressentiment oder die Interpretation des Seins als Kampf und Krieg handelt – siedeln sich auf einer nachgeordneten Ebene an, die vor allem von den Erwartungen, Illusionen oder „Vergiftungen“ der Interpretierenden abhängen. Nietzsche formuliert dabei geradezu das Programm eines nicht-reaktionären Erhabenen, nämlich eines, das auf Grausamkeit verzichten kann:
Es gibt der erhabnen Dinge genug, als dass man die Erhabenheit dort aufzusuchen hätte, wo sie mit der Grausamkeit in Schwesterschaft lebt; und mein Ehrgeiz würde zudem kein Genügen daran finden, wenn ich mich zum sublimen Folterknecht machen wollte.6
Hier sehe ich jedenfalls keine unmittelbare Andockstelle für faschistisches Denken mehr.
PS: Um uns zu meiner Ausgangsfrage zurückzuführen: Wäre ein solches „nicht-reaktionäres Erhabenes“ dann vielleicht doch wieder mit einem emanzipatorischen Mythos, vielleicht besser: einer Utopie, der Positivität verbindbar? Der von Nietzsche freilich nicht sehr geschätzte französische Poet Charles Baudelaire (1821–1867) sprach in einem seiner Gedichte seiner Geliebten eine „Einladung zur Reise“ aus in ein Land, in dem gilt: „Dort ist nur Schönheit und Genuß, [/] Ordnung, Stille, Überfluss.“ – Sollten wir dieser Versuchung nicht doch Folge leisten? Könnten die Konzepte des „Willens zur Macht“ und des „Übermenschen“ vielleicht auch der Sehnsucht nach einem solchen befriedeten Nicht-Ort Ausdruck verleihen und als solche den emanzipatorischen Kampf beflügeln? Oder wären Sie da vorsichtiger?
RZ: Vielleicht sind solche „Mythen“ sinnvoll und berechtigt in einem strategischen Sinn: als Utopien, die die Kräfte mobilisieren und bündeln können, um dem Status quo wenigstens hier und da etwas abzuringen. Von einer rein philosophischen Warte aus jedoch kann ich sie, so sehr sie mich anrühren, nicht mehr teilen – was durchaus Anlass für die professionelle Melancholie ist, die mit der Philosophie oft einherzugehen scheint. Nicht nur halte ich die geschichtsphilosophischen Voraussetzungen, wie erwähnt, für bloße Kinder des Wunsches: So etwas wie einen Fortschritt gibt es höchstens in begrenzten Bereichen und für gewisse Zeitabschnitte. Doch solche Utopien scheinen mir auch eine Dimension menschlichen Lebens zu ignorieren, die etwa bei Nietzsche eine große Rolle spielt: das Tragische. Wir sind unzähligen Zufällen und Schicksalen ausgesetzt, unsere körperliche und seelische Organisation macht uns anfällig nicht nur für Krankheiten, sondern auch für die immergleichen zwischenmenschlichen Konflikte, deren Monotonie über die Jahrhunderte hinweg sie nicht weniger schmerzlich in jedem Fall werden lässt. Natur weist uns allenthalben Grenzen auf, die zwar nie scharf identifiziert werden können, deren Überschreitung sich aber oft rächt. Man kann das auch so ausdrücken: Wenn es die moderne Idee der Politik mit dem Unterfangen zu tun hat, die Bedingungen des Lebens und Zusammenlebens zu verändern und zu verbessern, dann gehört es zur philosophischen Aufrichtigkeit, dass nicht alles politisch sein kann, weil einfach nicht alles manipuliert werden kann. Es gibt freilich Hoffnung: Sie besteht in dem (je nach Geschmack) aufreibenden oder reizvollen Umstand, dass sich nie im Voraus sagen lässt, was veränderbar ist und was nicht. Man muss es wohl doch immer aufs Neue ausprobieren.
PS: Professor Ziegler, ich danke Ihnen herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch.
RZ: Ich danke Ihnen!
Robert Hugo Ziegler lehrt Philosophie in Würzburg. Er ist Autor mehrerer Bücher zu politischer Philosophie, Metaphysik, Naturphilosophie und zur Geschichte der Philosophie. Zuletzt erschienen im Jahr 2024 Kritik des reaktionären Denkens, Von der Natur und Spinoza und das Flirren der Natur.
Fußnoten
1: Dieser Begriff ist allerdings nicht unumstritten, da er nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Ernst-Jünger-Schüler Armin Mohler mit der Intention geprägt wurde, deren Vertreter von ihrer Verstrickung in den NS bzw. den Faschismus reinzuwaschen.
2: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 377.
3: Vgl. insb. seinen Artikel Über die Geschichte des Urchristentums (Link).
4: Vgl. die Schrift Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats (Link).
5: Vgl. hierzu etwa auch Luca Guerreschi: „Die Philosophie der Kraft“. Mussolini liest Nietzsche. In: Martin A. Ruehl & Corinna Schubert (Hg.): Nietzsches Perspektiven des Politischen. Berlin & Boston 2022, S. 287–298.
Nietzsche und die intellektuelle Rechte
Ein Dialog mit Robert Hugo Ziegler
Nietzsche wurde von rechten Theoretikern und Politikern immer wieder zur Galionsfigur erhoben. Von Mussolini und Hitler bis hin zur AfD – immer wieder wird Nietzsche in Beschlag genommen, wenn es darum geht, der modernen Gesellschaft eine radikale reaktionäre Alternative entgegenzustellen. Besonders faszinierte Nietzsche die intellektuelle Rechte, etwa Autoren wie Ernst Jünger, Carl Schmitt und Martin Heidegger, die in den 20er Jahren ein kulturelles Vorfeld des aufziehenden Nationalsozialismus bildeten, auch wenn sie sich später von ihm teilweise distanzierten. Oft spricht man auch von der „Konservativen Revolution“1.
Was entnehmen diese Autoren Nietzsche und inwiefern lesen sie ihn einseitig und übersehen andere Potentiale in seinem Werk? Unser Autor Paul Stephan sprach darüber mit dem Philosophen Robert Hugo Ziegler.
Dionysos ohne Eros
War Nietzsche ein Incel?
Dionysos ohne Eros
War Nietzsche ein Incel?

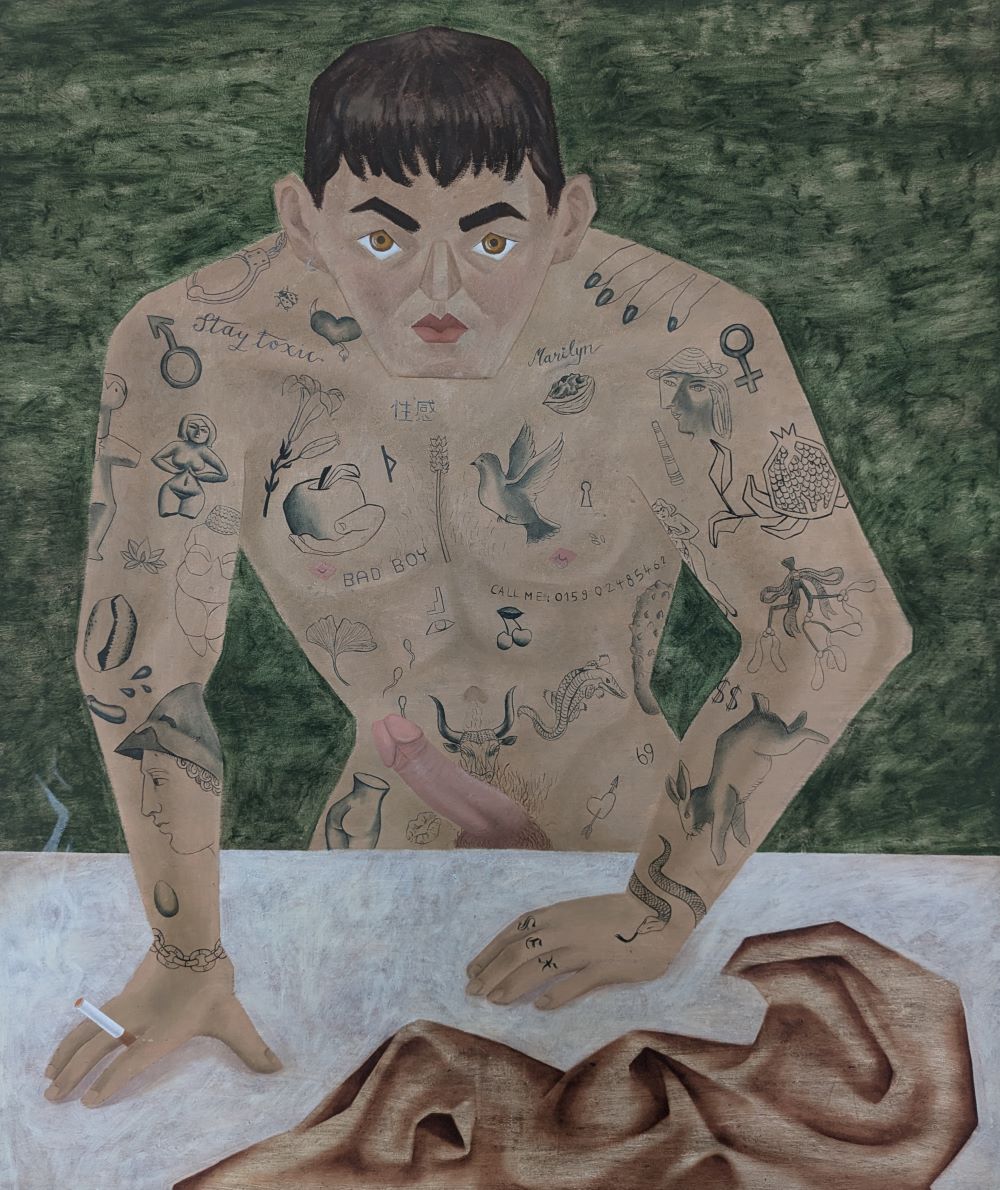
Dass sich Nietzsche schwer mit Frauen tat, ist allgemein bekannt. Um seine sexuelle Orientierung und Aktivität ranken sich bis heute Rätsel und Spekulationen. Immer wieder inspirierte diese Frage Künstlerinnen und Künstler zu provokant-spöttischen Darstellungen. Lässt er sich womöglich als „Incel“ bezeichnen? Als unfreiwilliger Junggeselle, im Sinne der heutigen Debatte um die frauenfeindliche „Incel-Bewegung“? Christian Saehrendt geht dieser Frage nach und versucht Licht ins Dunkel um Nietzsches kompliziertes Verhältnis zum „anderen Geschlecht“ zu bringen.
I. Warum lebte Nietzsche asketisch?
„Nietzsche und die körperliche Liebe“ – diese Überschrift würde wohl das dünnste Kapitel im dicken Buch seiner Lebensgeschichte zieren. Er war ledig und lebte niemals in einer Partnerschaft. Es ist weder belegt, ob er homosexuell oder asexuell war, und ob er überhaupt jemals Geschlechtsverkehr hatte. Die angebliche Syphilis-Infektion, die als Beweis für mindestens einen einzigen vollzogenen Akt dienen könnte, wird aus heutiger Sicht angezweifelt. Seine Schwester Elisabeth schrieb über Friedrichs Liebesleben:
Seine Schwärmerei erhob sich nie über eine gemäßigte, poetisch-angehauchte, herzliche Zuneigung. Wie denn überhaupt die große Passion, die vulgäre Liebe dem ganzen Leben meines Bruders vollständig fern geblieben ist. Seine ganze Leidenschaft lag in der Welt der Erkenntnis …1
Lebte Nietzsche aus freien Stücken wie ein Mönch? Oder würde man ihn zu den unfreiwillig zölibatär lebenden Männern zählen, von denen heute zehntausende als „Incels“ (involuntary celibate) eine frauenfeindliche Bewegung bilden, welche vor allem online aktiv ist, aber auch schon Mörder und Amokläufer hervorgebracht hat. Allein in den USA und Kanada wurden von ihnen seit 2014 fünfzig Menschen, vor allem Frauen, getötet. Auch der Attentäter von Halle, der bei seinem antisemitischen Anschlag 2019 zwei Menschen erschoss, hatte Bezug zur Incel-Szene. In der Vorstellungswelt von Incels sind die Männer in drei Klassen aufgeteilt: attraktive „Alphas“, durchschnittliche „Normies“ und als Verlierergruppe die Incels, die bei der Partnerinnensuche leer ausgehen. Diese jungen Männer haben ein traditionelles Bild von Männlichkeit, machen aber zugleich die Erfahrung, dem eigenen Ideal nicht zu genügen. Sie hassen sich selbst und vor allem die Frauen dafür, dass sie ihnen nicht gefügig sind. Rechtsextremisten, Influencer und kommerzielle Pick-up-Artists bewirtschaften diese negative Identität und beuten die Incels aus. Ihnen wird eingeredet, sie seien Opfer einer allzu liberalisierten Gesellschaft, die Frauen übergroße Freiheiten lässt und dass Männer eine Art Grundrecht auf Sex hätten, welches ihnen „durch das System“ verwehrt werde.2

II. Frauen und „Weiber“ in Nietzsches Werk
Ungeachtet mangelnder Praxis in Liebesdingen und Partnerschaft gab sich Nietzsche in seinen Schriften gelegentlich den Anstrich eines Frauenkenners. Hier fällt vor allem eine Passage von Ecce homo, „Warum ich so gute Bücher schreibe“ (Link) auf, in der mehrere Aspekte der weiblichen Identität, Emanzipation und Sexualität zur Sprache kommen, die z. T. die gängigen sexistischen und biologistischen Ansichten des 19. Jahrhunderts spiegeln und zugleich zur heutigen Incel-Ideologie passen würden. So verwundert es nicht, dass Nietzsche in diversen Online-Foren wie Reddit oder Quora als „Pate aller heutigen Incels“ missverstanden wird.3 Die folgende Zitate Nietzsches sind allesamt dem erwähnten Ecce homo-Textabschnitt entnommen. Das erste erscheint wie eine hochstaplerische Kompensation im Kontext einer Selbstidentifikation mit Dionysos:
Darf ich anbei die Vermuthung wagen, daß ich die Weiblein kenne? Das gehört zu meiner dionysischen Mitgift. Wer weiss? vielleicht bin ich der erste Psycholog des Ewig-Weiblichen. Sie lieben mich Alle[.]
Bemerkenswert ist, dass Nietzsche im Kontext seines Frauenbildes in einem Punkt sehr fortschrittlich zu sein schien: Er billigte den Frauen zu, ein Recht auf vollen Genuss beim Geschlechtsverkehr zu haben – damals eine unerhört „unmoralische“ Position:
[D]ie Predigt der Keuschheit ist eine öffentliche Aufreizung zur Widernatur. Jede Verachtung des geschlechtlichen Lebens, jede Verunreinigung desselben durch den Begriff „unrein“ ist das Verbrechen selbst am Leben, – ist die eigentliche Sünde wider den heiligen Geist des Lebens.
Laut Nietzsche steht dabei allerdings der biologische Zweck der Reproduktion im Vordergrund. Frauen dürfe das erotische Verlangen nicht abgeschlagen werden, weil die Fortpflanzung ihr eigentlicher Lebenszweck sei und sie vieles andere (etwa Studieren, Schreiben, Kultur) nur davon ablenke. Diese Ablenkung führe zu krankhaften und unglücklichen Zuständen, wobei nur eine Therapie helfe: „Hat man meine Antwort auf die Frage gehört, wie man ein Weib kurirt – ‚erlöst‘? Man macht ihm ein Kind.“
In diesem Kontext pathologisiert Nietzsche auch alle Emanzipationsbestrebungen:
Der Kampf um gleiche Rechte ist sogar ein Symptom von Krankheit: jeder Arzt weiss das. – Das Weib, je mehr Weib es ist, wehrt sich ja mit Händen und Füssen gegen Rechte überhaupt: der Naturzustand, der ewige Krieg zwischen den Geschlechtern gibt ihm ja bei weitem den ersten Rang.
Nietzsche sieht die Frauen im Geschlechterkrieg des Naturzustandes also im Vorteil, weswegen er den Einsatz der Frauenrechtlerinnen für paradox und selbstzerstörerisch hält. Rechtlich geregelte Emanzipation sei etwas Widernatürliches: „‚Emancipation des Weibes‘ – das ist der Instinkthass des missrathenen, das heisst gebäruntüchtigen Weibes gegen das wohlgeratene – der Kampf gegen den ‚Mann‘ ist immer nur Mittel“. Fast schon resignierend fasst Nietzsche zusammen: „Das Weib ist unsäglich viel böser als der Mann, auch klüger; Güte am Weibe ist schon eine Form der Entartung.“
Indem Nietzsche die raubtierhafte Gefährlichkeit, Bosheit und Überlegenheit der Frau betont, liefert er en passant eine Erklärung für seine Bindungslosigkeit:
Zum Glück bin ich nicht Willens, mich zerreissen zu lassen: das vollkommne Weib zerreisst, wenn es liebt… Ich kenne diese liebenswürdigen Mänaden… Ah, was für ein gefährliches, schleichendes, unterirdisches kleines Raubthier!
Während Dionysos im 19. Jahrhundert oftmals positiv dargestellt wurde, obwohl er auch mit Charakterzügen beschrieben wurde, die in jener Epoche als typisch weiblich galten, sind seine weiblichen Begleiterinnen, die Bakchai oder Mänaden, überwiegend als wahnsinnig und überspannt charakterisiert worden. Diese nachträgliche Abwertung des altgriechischen Mänadenkultes ist als zeittypischer Ausdruck von Misogynie zu betrachten.4 Nietzsche bildet dabei keine Ausnahme. Versinnbildlicht durch die Mänaden, sieht er die Frau als Wesen, das von sexuellen Obsessionen beherrscht wird: „Die ungeheure Erwartung in Betreff der Geschlechtsliebe verdirbt den Frauen das Auge für alle fernen Perspektiven“, schrieb er der von ihm verehrten Lou Andreas-Salomé.5
In Jenseits von Gut und Böse fasst er noch einmal zusammen, warum Frauen für Männer eigentlich viel zu gefährlich seien:
Was am Weib Respekt und oft genug Furcht einflösst, ist seine Natur, die natürlicher ist als die des Mannes, seine echte, raubtierhafte, listige Geschmeidigkeit, seine Tigerkralle unter dem Handschuh, seine Naivität im Egoismus, seine Unerziehbarkeit und innerliche Wildheit, das Unfassliche, Weite, Schweifende seiner Begierden und Tugenden.6
In einer interessanten Analogie in der Vorrede von Jenseits von Gut und Böse setzt Nietzsche die Wahrheit mit dem Weiblichen gleich und schildert die Unfähigkeit der Philosophen, sich dieser zu nähern, sie zu umwerben und zu erobern:
Vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist – ist der Verdacht nicht gegründet, dass alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? Dass der schauerliche Ernst, die linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen? Gewiss ist, dass sie sich nicht hat einnehmen lassen.
Ob in der Spottfigur des „linkisch-aufdringlichen“ und zugleich „schauerlich-ernsten“ Dogmatikers auch ein wenig Selbstironie enthalten war?

III. Nietzsches Beziehungen zu Frauen
In der biografischen Forschung wurden verschiedene Gründe für Nietzsches fehlendes Liebesleben genannt. Bereits vor fast 100 Jahren spekulierte Helmuth W. Brann in seinem Buch Nietzsche und die Frauen über Nietzsches fehlendes Sexappeal und seine sich daraus ergebende Frustration.7 Adorno stellte in den Minima Moralia verwundert fest, dass Nietzsche „das Bild weiblicher Natur ungeprüft und unerfahren von der christlichen Zivilisation übernahm, der er sonst so gründlich mißtraute.“8 Martin Vogel charakterisierte Nietzsche als „erotisch schwachbegabt“. Sein Frauenbild sei von „erschreckender Dürftigkeit und Unselbständigkeit“9 gewesen. Laut Pia Volz habe Nietzsche seine „schizoid-narzisstische Beziehungsstörung zum heroischen Einsamkeitsgestus idealisiert“10 und in der Figur des Zarathustra manifestiert.
Nietzsche hatte einige ältere Freundinnen wie Malwida von Meysenbug, Zina von Mansurov oder Marie Baumgärtner – die Mutter eines seiner Studenten. Nietzsche hielt dreimal um die Hand einer jungen Frau an. Zudem pflegte er Umgang mit jüngeren Studentinnen, Musikliebhaberinnen und Leserinnen seiner Werke. Im Widerspruch zu seinen schriftlichen Äußerungen über die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die stark von den diskriminierend-biologistischen Vorstellungen seiner Zeit geprägt waren, pflegte Nietzsche Bekanntschaften und Freundschaften mit schreibenden und philosophierenden Frauen. Die 1848er-Revolutionärin und Wagnerianerin von Meysenbug, die Nietzsche gegenüber Dritten als „beste[] Freundin der Welt“11 titulierte, darf sogar als Vordenkerin der Frauenemanzipation gelten, welche Nietzsche ja vehement ablehnte. Zudem war Nietzsche mit einigen lesbischen Frauen bekannt, neben der Schweizer Feministin Meta von Salis waren dies die damalige Medizinstudentin Clara Willdenow und die Philosophin Helene von Druskowitz. Seine reaktionären Ansichten über Frauenrechte schienen für jene kein Hinderungsgrund für eine Freundschaft zu sein, bis auf von Druskowitz, die sich 1886 vehement von Nietzsche distanzierte und mit ihm publizistisch „abrechnete“.12
„Nietzsche war der Typ des Muttersöhnchens“, stellte Vogel fest, „auch noch in seiner Studenten- und Professorenzeit suchte er sich vornehmlich das Wohlwollen älterer erfahrener Frauen zu versichern“13, beispielsweise Sophie Ritschl, die Gattin seines Lehrers in Leipzig, Ottilie Brockhaus, die Schwester Richard Wagners, und, wie erwähnt, Malwida von Meysenbug. Mit der 28 Jahre älteren Malwida verbrachte Nietzsche auch den 1876 von der Universität Basel bewilligten Urlaub. „Bei älteren Damen fiel dann meistens auch der letzte Überrest schüchterner Furchtsamkeit weg und Nietzsche bewegte sich in völlig zwangloser Sicherheit und plötzlich aufgeschlossener Gewandtheit.“14
Im Frühjahr 1876 hielt Nietzsche um die Hand der in Genf weilenden jungen Russin Mathilde Trampedach an, die er nur dreimal zuvor getroffen hatte. Trampedach nahm in Genf Klavierstunden bei dem Komponisten Hugo de Senger – und hatte sich in ihn verliebt (was Nietzsche möglicherweise nicht bekannt war). Den Heiratsantrag schickte ihr Nietzsche in Absprache mit de Senger am 11. April 1876 schriftlich.15 Trampedach lehnte höflich ab (und heiratete bald darauf de Senger), während sich Nietzsche per Brief am 15. April für seinen Vorstoß wortreich entschuldigte (Link). Wenige Wochen danach verliebte er sich in Bayreuth in die junge Musikliebhaberin Louise Ott, die allerdings bereits mit einem Bankier verheiratet und Mutter war.16
Bei Nietzsches Heiratsplänen jener Jahre hat sicher auch der Gedanke der wirtschaftlichen Absicherung eine Rolle gespielt, die nach der Aufgabe seiner Basler Professur umso dringlicher geworden war. In einem Brief an seine Schwester vom 25. April 1877 schildert er einen Plan, den er gemeinsam mit Malwida ersonnen hatte: „die Verheirathung mit einer zu mir passenden, aber nothwendig vermögenden Frau“ würde es ihm ermöglichen, die gesundheitlich belastende Lehrtätigkeit aufzugeben und „mit dieser (Frau) würde ich dann die nächsten Jahre in Rom leben […] den geistigen Qualitäten nach finde ich immer Nat[alie] Herzen am besten geeignet.“ (Link) Die Schwestern Natalie und Olga Herzen, Exilrussinnen, hatte er bereits 1872 mit Malwida in Bayreuth kennengelernt. Der gemeinsame Musikgeschmack verband, und Nietzsche hatte anfänglich Olga Herzen im Blick.17 Später verlagerte sich sein Interesse auf Natalie. Zu ernsteren Avancen kam es jedoch nie. 1877 schrieb Nietzsche Malwida: „Bis zum Herbst habe ich nun noch die schöne Aufgabe, mir ein Weib zu gewinnen, und wenn ich sie [sic] von der Gasse nehmen müsste,“18 gab sich aber zugleich gegenüber seiner Schwester pessimistisch: „Die Verheirathung, sehr wünschenswerth zwar – ist doch die unwahrscheinlichste Sache, das weiss ich sehr deutlich!“19 Im Spätsommer klopft er in dieser Sache wieder bei Malwida an: „Haben Sie das Feenweibchen gefunden, welches mich von der Säule, an welche ich angeschmiedet bin, losmacht?“20
Im Frühjahr 1882 liess Nietzsche der deutsch-russischen Philosophiestudentin Lou Andreas-Salomé durch Paul Reé in Italien einen Heiratsantrag zukommen, ohne zu wissen, dass dieser selbst bereits in Sachen Eheschließung bei ihr vorstellig geworden war. Am 13. Mai 1882 wiederholte Nietzsche den Antrag bei einem weiteren Treffen in Luzern. Lou schlug beide Anträge aus und lebte anschließend mit Reé zusammen, was Nietzsche enttäuschte. Allerdings erweckte er im Nachhinein im Gespräch mit Ida Overbeck den Eindruck, als ob sein Antrag von Lou geradezu abgelehnt werden sollte, und nur pro forma aus moralisch-gesellschaftlichen Gründen erfolgt war.21 Nach Ablehnung seines Heiratsantrages hatte Nietzsche Rée und Lou in Luzern zu einer inszenierten Fotografie überredet, in der die beiden Männer vor den Fotostudiokulissen einen Wagen mit der peitschenschwingenden Lou ziehen, wobei sowohl der Wagen als auch die Peitsche lächerlich klein geraten waren, was der Szene einen komisch-ironischen Ausdruck verlieh. Kurz darauf verwendete Nietzsche das Peitschenmotiv im 1883 erschienenen ersten Teil des Zarathustra: „Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!“22 – es sollte bis heute eines seiner bekanntesten Zitate werden. Jahre später, lange nach dem Bruch Nietzsches mit Wagner, reiste Lou nach Bayreuth und zeigte einmal die Peitschen-Fotographie als Kuriosität herum, was Nietzsches Schwester überhaupt nicht behagte.23
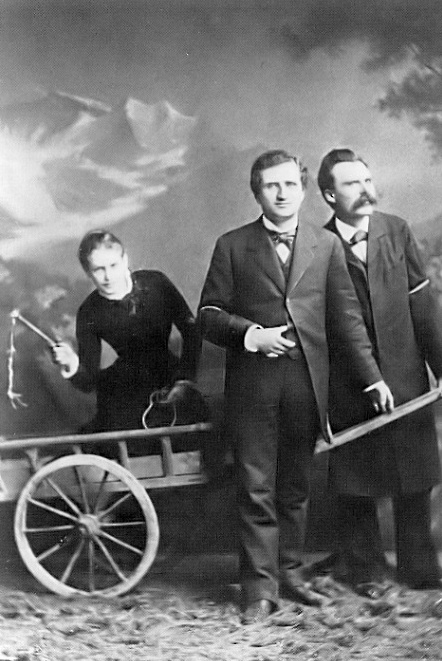
Malwida verlor das Projekt von Nietzsches Verheiratung offenbar auch in den folgenden Jahren nicht aus den Augen und machte ihn immer wieder mit jungen Frauen bekannt. 1884 lernte er in Nizza Resa von Schirnhofer kennen. Schirnhofer, zehn Jahre jünger als Nietzsche und Philosophiestudentin in Zürich, wurde offenbar von Malwida als passende Heiratskandidatin für ihn angesehen, doch kam keine Verbindung der beiden zustande.
„Was machen denn alle die jungen oder weniger jungen Mädchen, mit denen bekannt zu sein ich Ihrer Freundschaft verdanke (lauter kleine verrückte Thiere, unter uns gesagt)?“ fragte er noch Ende Februar 1887 in einem Brief an Malwida (Link) und beklagte sich, dass seine jüngere Frauenbekanntschaften schon lange nichts mehr von sich hören ließen.
In den Fällen Trampedach und Andreas-Salomé stellt sich die Frage, ob Nietzsche überhaupt ernsthaft an Heirat dachte, denn in beiden Fällen involvierte er direkte Konkurrenten und hatte dann ihnen gegenüber das Nachsehen. Es scheint fast, als habe er gewünscht, dass die Anträge abgelehnt würden. Auffällig ist auch, dass Nietzsche mehrfach die Rolle als asexuell-platonischer „Dritter im Bunde“ wählte, so bei Franz und Ida Overbeck, eben auch bei Paul Rée und Lou sowie bei Cosima und Richard Wagner. Auf diese Weise konnte er einer engeren Bindung entgehen und sich jederzeit aus dieser Konstellation verabschieden. In das Vermeidungsmuster passt auch Nietzsches Neigung sich mit lesbischen Frauen zu befreunden, weil von diesen keine „Gefahr“ in Sachen Sex und Partnerschaft ausging. Summa summarum hat man den Eindruck, dass Nietzsches Heiratsambitionen über Jahre hinweg wenig stringent und möglicherweise gar nicht innerlich gewollt waren. Lebte er vielleicht sogar gerne allein und asketisch? In der dritten Abhandlung der Genealogie der Moral befasst sich Nietzsche kritisch bis spöttisch mit den sozialen Funktionen asketischer Ideale, gibt aber auch zu bedenken: „Ein gewisser Ascetismus, wir sahen es, eine harte und heitere Entsagsamkeit besten Willens gehört zu den günstigen Bedingungen höchster Geistigkeit“24. Letztlich bleibt offen, ob Nietzsche bewusst asketisch lebte und eigentlich gar keine Partnerinnen brauchte, oder ob er aus der Not eine Tugend machte.
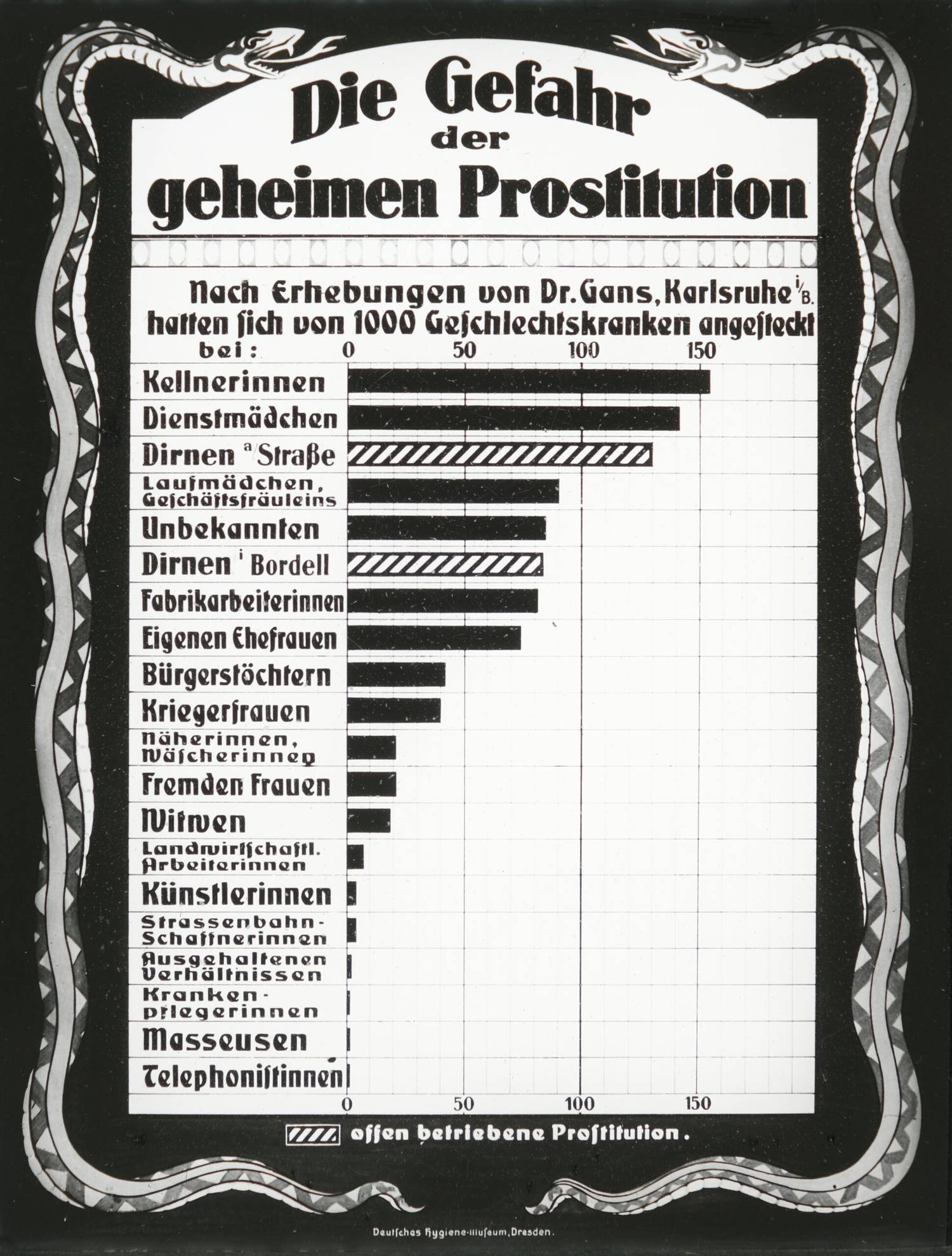
IV. Ist Nietzsches Syphilis-Erkrankung der Grund für seine zölibatäre Lebensweise?
Am Ende soll noch der Frage nachgegangen werden, ob Nietzsches Erkrankung der Grund für seine zölibatäre Lebensweise gewesen sein könnte. Im 19. Jahrhundert gab es Fälle, in denen mit Syphilis infizierte bürgerliche Männer aus moralischem Verantwortungsgefühl heraus ledig blieben, da sie Ehefrau und Kinder nicht dem Risiko der Ansteckung aussetzen wollten. Ob Nietzsche aus diesem Grund eine Heirat eigentlich ausschloss, es aber nicht gegenüber Dritten erklären konnte? Nietzsche soll in seiner Leipziger Zeit wegen einer syphilitischen Erkrankung („Lues“) in ärztlicher Behandlung gewesen sein, allerdings wurde damals auch Tripper mit diesem Begriff diagnostiziert, bis 1879 der Gonorrhoe-Erreger nachgewiesen wurde.25 1875 wurde bei Nietzsche erstmals eine chronische Chorioretinitis festgestellt, die in manchem Fällen als Spätfolge von Syphilis auftritt und als Hinweis dafür gedeutet wurde, dass er sich damit während seiner Studienzeit in Leipzig angesteckt hatte.26 Im Falle einer tatsächlichen Syphilis-Infektion stellte sich die Frage, warum er die Diagnose und Symptomatik in keinem seiner Briefe erwähnte, obwohl er doch sonst detailliert über jegliche gesundheitliche Zustände und Probleme informierte. Möglicherweise war die Scham zu groß. Das Thema Syphilis war im 19. Jahrhundert moralisch belastet und gesellschaftlich stigmatisiert. Die Krankheit galt zunächst als Begleiterscheinung der Prostitution und als „Strafe“ für „sündige“ Sexarbeiterinnen und Ehebrecher, wurde aber dann im Laufe des Jahrhunderts unter nunmehr wissenschaftlichen Aspekten mehr und mehr als Gefahr für Ehe und Familie, mithin für die „Volksgesundheit“ angesehen. Zwar entlastete die um 1875 aufkommende These von der Vererbbarkeit der Krankheit die Infizierten auf der moralischen Ebene, doch die Schrecken der als Spätfolge diagnostizierten „progressiven Paralyse“ und der Unbehandelbarkeit der Krankheit blieben gegenwärtig und sorgten für eine starke Präsenz der Seuche in Wissenschaft und Kultur.27 Die Syphilisphobie unterwanderte auch die ab 1880 aufkommende Diagnose der „Neurasthenie“, eines vielschichtigen, psychosomatischen Nervositätszustandes, dessen Symptome fatalerweise zum Frühstadium der progressiven Paralyse passten und die Syphilisphobie noch weiter steigerten. In jedem Fall galt Syphilis Ende des 19. Jahrhunderts als eine Krankheit, die als gesellschaftliche Verfallserscheinung und als Gefahr für die „Volksgesundheit“ gedeutet wurde. Bürgerliche Männer reagierten auf eine Diagnose nicht selten panisch, gelegentlich sogar mit Selbstmord,28 für eine bürgerliche Ehe sahen sie sich oftmals nicht mehr geeignet.
Letztlich wurde Nietzsches Symptomatik nie aufgeklärt. Vermutet wurden in der klinischen Behandlung und biografischen Forschung u. a. eine Chloralhydrat-Vergiftung, geistige Überarbeitung, Schizophrenie, Epilepsie, Demenz, Manie und Depression. Lange Zeit dominierte die Diagnose seiner behandelnden Ärzte, die 1889 eine „progressive Paralyse“ als Spätfolge von Syphilis feststellten. In den letzten Jahrzehnten wurde dies zunehmend in Zweifel gezogen und es sind neue Diagnosen und Theorien (soweit das posthum überhaupt möglich ist) hinzugekommen, etwa ein Hirntumor im Augennerv, das CADASIL-Syndrom oder das MELAS-Syndrom.29
So lässt sich die Frage, warum Nietzsche zeitlebens ledig und keusch blieb, nicht abschließend beantworten. Sein Verhältnis zu Frauen hatte keine körperliche Dimension, dafür aber vielschichtige geistige Aspekte. Als Pate der heutigen Incel-Bewegung dürfte er kaum dienen, dafür waren sein Weltbild wie auch sein Selbstbild zu differenziert. Er gab niemandem die Schuld für seine Einsamkeit. Paradox wirkt heute, dass er die üblichen sexistischen Einstellungen des 19. Jahrhunderts übernahm – dass etwa die Fortpflanzung der eigentliche Lebenszweck der Frau sei – und sich doch gerade nach der Anerkennung durch eine intelligente und gebildete Frau sehnte: „Gegen die Männerkrankheit der Selbstverachtung hilft es am sichersten, von einem klugen Weib geliebt zu werden.“30
Angabe zum Artikelbild
Salwa Wittwer (Leipzig): Stay Toxic. Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm, 2024. Im Besitz der Künstlerin.
Literatur
Adorno, Theodor W.: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben (1951). Frankfurt a. M. 1978.
Brann, Helmuth Walter: Nietzsche und die Frauen. Leipzig 1931.
Diethe, Carol: Frauen. In: Henning Ottmann (Hg.): Nietzsche Handbuch. Stuttgart 2000, S. 50–56.
Dies.: Vergiss die Peitsche. Nietzsche und die Frauen. Hamburg 2000.
Förster-Nietzsche, Elisabeth: Das Leben Friedrich Nietzsches, Bd. 1. Leipzig 1895.
Kirakosian, Racha: Berauscht der Sinne beraubt. Eine Geschichte der Ekstase, Berlin 2025.
Niemeyer, Christian: Nietzsches Syphilis – und die der Anderen. Baden-Baden 2020.
Radkau, Joachim: Malwida von Meysenbug. Revolutionärin, Dichterin, Freundin: Eine Frau im 19. Jahrhundert. S. 360.
Schonlau, Anja: Syphilis in der Literatur. Über Ästhetik, Moral, Genie und Medizin (1880-2000). Würzburg 2005.
Tényi, Tamás: The madness of Dionysus – six hypotheses on the illness of Nietzsche. In: Psychiatria Hungaria 27/6 (2012), S. 420-425 (Link).
Vogel, Martin: Apollinisch und Dionysisch. Geschichte eines genialen Irrtums. Regensburg 1966.
Volz, Pia: Nietzsches Krankheit. In: Henning Ottmann (Hg.): Nietzsche Handbuch. Stuttgart 2000, S. 57 f.
Fußnoten
1: Elisabeth Förster-Nietzsche, Das Leben Friedrich Nietzsches, Bd. 1, S. 180.
2: Vgl. https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/516447/incels/ (abgerufen am 08.08.2025).
3: Vgl. https://a-part-time-nihilist.quora.com/https-www-quora-com-Was-Friedrich-Nietzsche-an-incel-answer-Susanna-Viljanen (abgerufen am 07.07.2025).
4: Vgl. Racha Kirakosian, Berauscht der Sinne beraubt, S. 149.
6: Aph. 239.
7: Vgl. S. 23.
8: Nr. 59; S. 120.
9: Martin Vogel, Apollinisch und Dionysisch, S. 294 f.
10: Nietzsches Krankheit, S. 57.
11: Bf. an Carl Gersdorff v. 26. 5. 1876.
12: Für einen exzellenten Überblick zu Nietzsches vielfältige Beziehungen zu Frauen vgl. auch die einschlägige Monographie Vergiss die Peitsche von Carol Diethe.
13: Apollinisch und Dionysisch, S. 295.
14: Brann, Nietzsche und die Frauen, S. 175.
15: Vgl. Bf. v. 11. 4. 1876.
16: Vgl. Diethe, Frauen, S. 56.
17: Vgl. Joachim Radkau, Malwida von Meysenbug, S. 360.
18: Bf. v. 1. 7. 1877.
19: Bf. v. 2. 6. 1877.
20: Bf. v. 3. 9. 1877.
21: Vgl. Brann, Nietzsche und die Frauen, S. 151.
22: Also sprach Zarathustra, Von alten und jungen Weiblein.
23: Vgl. Diethe, Frauen, S. 50 f.
24: Zur Genealogie der Moral, Abs. III, 9.
25: Vgl. Vogel, Apollinisch und Dionysisch, S. 315.
26: Vgl. Volz, Nietzsches Krankheit, S. 57.
27: Vgl. Anja Schonlau, Syphilis in der Literatur, S. 84.
28: Vgl. ebd., S. 101.
29: Vgl. Tamás Tényi, The madness of Dionysus. Der Nietzsche-Forscher Christian Niemeyer versuchte jüngst, die „Syphilis-These“ zu rehabilitieren (vgl. Nietzsches Syphilis).
Dionysos ohne Eros
War Nietzsche ein Incel?
Dass sich Nietzsche schwer mit Frauen tat, ist allgemein bekannt. Um seine sexuelle Orientierung und Aktivität ranken sich bis heute Rätsel und Spekulationen. Immer wieder inspirierte diese Frage Künstlerinnen und Künstler zu provokant-spöttischen Darstellungen. Lässt er sich womöglich als „Incel“ bezeichnen? Als unfreiwilliger Junggeselle, im Sinne der heutigen Debatte um die frauenfeindliche „Incel-Bewegung“? Christian Saehrendt geht dieser Frage nach und versucht Licht ins Dunkel um Nietzsches kompliziertes Verhältnis zum „anderen Geschlecht“ zu bringen.
Kann KI einen tanzenden Stern gebären?
Von Spatzen, Kanonen und Lockvögeln
Kann KI einen tanzenden Stern gebären?
Von Spatzen, Kanonen und Lockvögeln
.jpg)
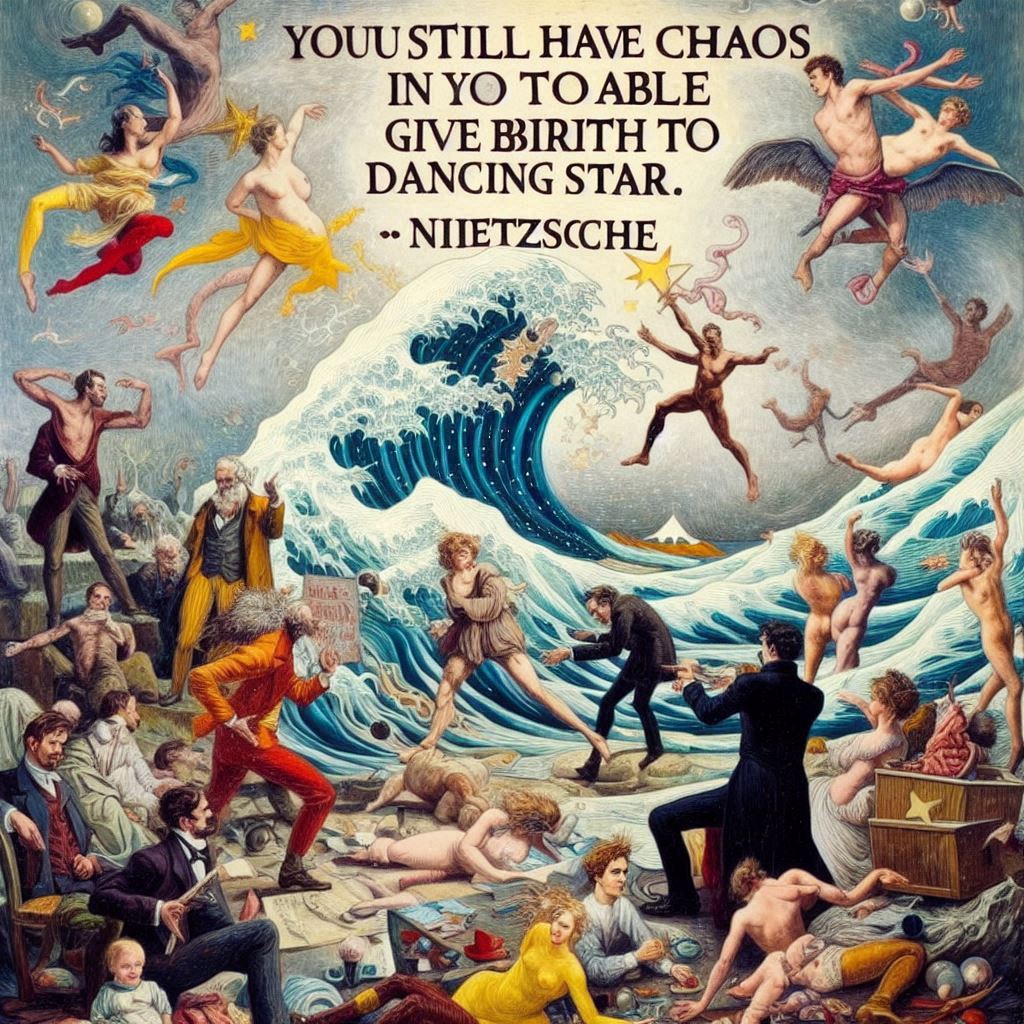
Wie schon vor einem Jahr (Link) ergänzt unser Autor Paul Stephan auch seinen diesjährigen „Dialog“ mit ChatGPT (Link) um einen Kommentar zum aktuellen Stand der Entwicklung der „Künstlichen Intelligenz“. Seine Einschätzung fällt etwas nüchterner aus – doch seinen grundsätzlichen Technikoptimismus möchte er sich nicht nehmen lassen. Pessimismus und naiven Hype, der gerade offensichtlich geschürt wird, um sicherzustellen, dass sich die Milliardeninvestionen in KI auch amortisieren, möchte er gleichermaßen vermeiden.
Die Bilder zu diesem Artikel ließen wir von verschiedenen KI-Tools zu folgendem Prompt generieren: „Erstelle mir bitte ein Bild zu dem Aphorismus ‚Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können‘ von Nietzsche“, eines von ChatGPT „Lieblingszitaten“ des Philosophen aus Also sprach Zarathustra (Link). Das Artikelbild stammt von Microsoft AI.

I. „Nichts als Mimikry“
Vor einem Jahr führte ich für diesen Blog einen experimentellen Dialog mit ChatGPT über Nietzsches Philosophie durch (Link); in diesem habe ich das Experiment wiederholt (Link). Das Ergebnis war nicht gerade berauschend. Nach wie vor reproduziert ChatGPT Allgemeinplätze und Wikipedia-Wissen und versagt bei einfachsten Detailnachfragen. Was es vor allem nicht kann, was aber die Grundvoraussetzung geisteswissenschaftlichen Arbeitens ist: Gut mit Literatur umgehen. Da werden Zitate vollkommen falsch zugeordnet und Quellen erfunden, ohne mit der ohnehin nicht vorhandenen Wimper zu zucken. Es gilt, was Werner Herzog über das digitale Experiment The Infinite Conversation, einen von KI geführten fiktiven Dialog zwischen ihm selbst und Slavoj Žižek vermerkt:
Von mir selbst gibt es im Internet ein nie endendes Gespräch mit einem slowenischen Philosophen, das unsere beiden Stimmen mit hoher Genauigkeit nachahmt, aber unser Diskurs ist ohne Sinn, ohne neue Ideen, lediglich eine Nachahmung unserer Stimmen und ausgewählter Themen, zu denen wir beide in der Vergangenheit gesprochen haben. Alle Sätze sind korrekt in Grammatik und Vokabular, aber der Diskurs selbst ist tot, ohne Seele. Er ist nichts als Mimikry.1
Anders ausgedrückt: ChatGPT und seine Mitstreiter tragen vielleicht viel Chaos in sich, doch kein lebendiges, produktives Chaos – einen „tanzenden Stern“ könne sie darum nicht zur Welt bringen, allenfalls mal mehr oder weniger interessanten oder gefälligen content. Wie auch?
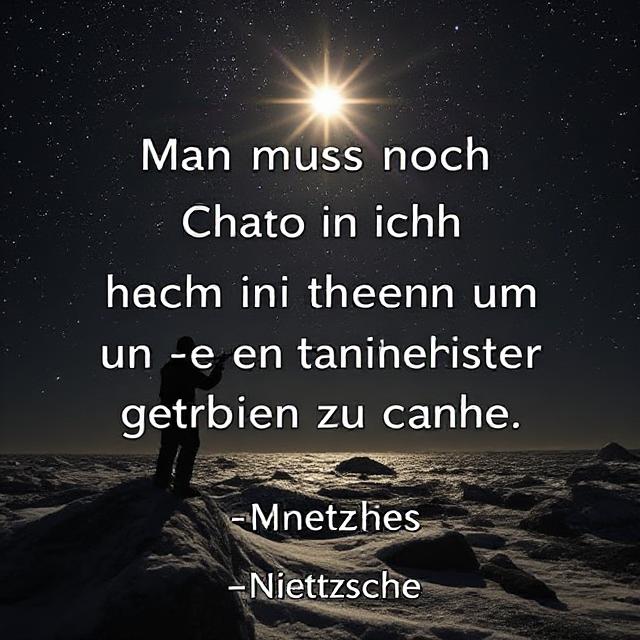
II. Tägliches, Alltägliches
Ein Blick in die sozialen Medien, auf denen man seit einigen Monaten mit KI-generierten Billo-Inhalten geradezu erschlagen wird, genügt: Nur selten sind diese Machwerke wirklich überzeugend, sie gehen eher auf die Nerven. Um wirklich gute Filme, Songs, Bilder oder Texte mit KI zu generieren, braucht es nach wie vor kreativen menschlichen Input, die Maschine allein vermag es allenfalls, durch ihre Ähnlichkeit zu solchen Inhalten zu verblüffen. In der Regel erkennt man nach kurzer Zeit die spezifische Handschrift der KI – bzw., genauer gesagt: die auffällige Abwesenheit einer Handschrift, die Sterilität ihrer Produktionen.
Auch bei mir ist die KI in der Zwischenzeit in den Alltag eingesickert. Spätestens, nachdem Google standardmäßig KI-Antworten ausgibt bei Anfragen, lässt sich ihr ja auch kaum noch ausweichen. Zugegeben: Bei Alltagsproblemen habe ich mit der KI mitunter recht positive Erfahrungen gemacht. Anstatt sich mühsam durch zahlreiche Seiten durchklicken oder gar minutenlange YouTube-Tutorials ansehen zu müssen, um zum Beispiel herauszufinden, bei wieviel Grad man einen bestimmten Stoff waschen sollte oder wie lange ein bestimmtes Nahrungsmittel außerhalb des Kühlschranks haltbar ist, gibt die KI nun binnen Sekunden eine prägnante und in den meisten Fällen – jedenfalls für den Hausgebrauch – auch korrekte Antwort. Vor ein paar Wochen half mir ChatGPT sogar dabei, ein recht schwerwiegendes Computerproblem zu lösen. Mit einer wahren Engelsgeduld erklärte es mir Schritt für Schritt, wie ich den Fehler ausfindig machen, meine Daten retten und ihn dann beheben konnte. Und ich konnte sogar neugierige Nachfragen dazu stellen, warum ich diese Schritte überhaupt vollziehen sollte und was da technisch genau dahintersteckt. Das Ergebnis: Ich habe mir einiges Geld für eine manuelle Reparatur gespart und einige Zeit für das Durchscrollen irgendwelcher obskurer Internetforen. Das hat quasi ChatGPT schon alles für mich erledigt; wobei es am Ende doch noch mich brauchte, um seine Anweisungen umzusetzen und das hätte ich ohne ein gewisses Vorwissen in Sachen Hardware wahrscheinlich nicht vermocht.
Freilich ist der qualitative Sprung ja eher gering, wenn es um solche Banalitäten geht. Ob man nun die relevanten Informationen selbst zusammenklaubt oder sie von einem Computerprogramm suchen und sich in übersichtlicher Form präsentieren lässt, ist eigentlich zweitrangig. Bei meiner eigentlichen philosophischen Arbeit habe ich jedenfalls noch keinen echten Nutzwert der KI entdecken können.
Mit was ich ebenfalls experimentierte, war, mir von KI-Programmen unterhaltsame Geschichten oder Rollenspielszenarien schreiben zu lassen wie „Ich bin ein Pirat im 18. Jahrhundert und auf Seefahrt in der Karibik und unterhalte mich mit einem Kollegen“ oder „Ich streife als Zauberelf durch den Märchenwald und erlebe lustige Abenteuer“. Auch da gab es anfangs einen gewissen Verblüffungseffekt, bis ich die immer gleichen redundanten Formulierungen und ausgelutschten Ideen nach einer Weile satthatte und dann doch wieder andere Möglichkeiten der Abendunterhaltung bevorzugte. Damit das Resultat einigermaßen interessant wurde, war am Ende einfach zu viel eigener Input gefragt – da ist es dann doch aufregender, einen Roman zu lesen oder sich einen Film anzusehen.
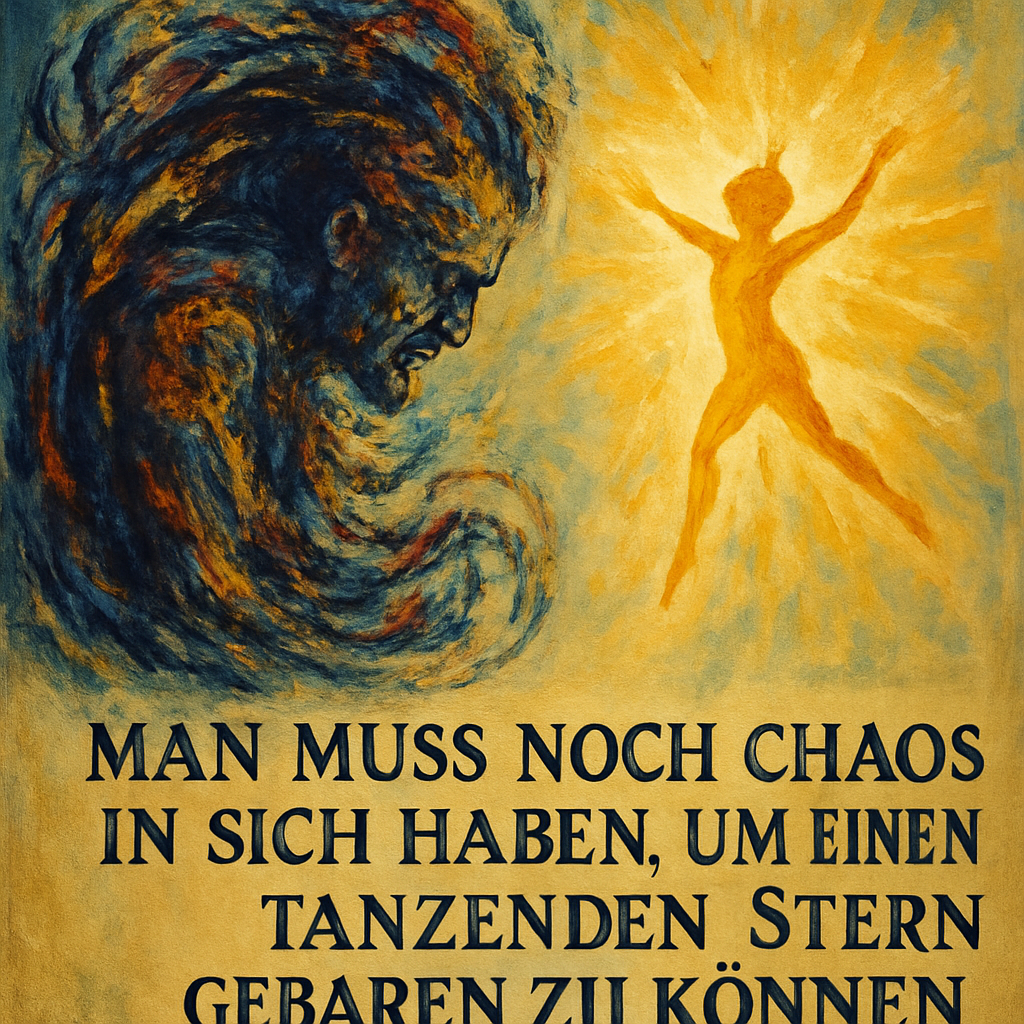
III. Die Digitalisierung des Kinderzimmers
Mal mehr, mal weniger aufregend ist es, abends mit meinem kleinen dreijährigen Sohn noch YouTube-Videos zu gucken. Auch das kindliche Schlafzimmer hat die Digitalisierung längst erreicht, „was gucken“ ist aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Aber wie dem Junior ernsthaft diese Freude verbieten, wenn man selbst dauernd am Handy hängt? Wenigstens machen wir ein gemeinsames Erlebnis draus und ich habe (noch) die volle Kontrolle über die Inhalte. Und im Ostseeurlaub wurde einfach behauptet, es gäbe hier kein Internet – dann ging’s auch mal zwei Wochen ohne. Ohne edle Lügen kommt der Erzieher nicht aus, das wusste schon Platon.
Die Digitalisierung der Kinderzimmer ist beileibe kein Randphänomen und ein wichtiger Aspekt der Thematik, über den zu selten gesprochen wird. Kürzlich suchte ich aus Neugier mal heraus, was eigentlich der erfolgreichste Kanal des Videoportals ist. Auf Platz 1, bekannt wie wenig überraschend: die penetrante Obernervensäge MrBeast, über dessen dubiose Geschäftspraktiken ich mich hier nicht weiter auslassen möchte, mit 423 Millionen Abonnenten. Auf Platz 2 kommt dann ein indischer Musikkanal namens T-Series, der immerhin 301 Millionen Follower begeistert. Auf Platz 3 dicht dahinter mit 195 Millionen: Cocomelon – Nursery Rhymes, ein Kanal, dessen Content für den durchschnittlichen Erwachsenen höchstens als Folterwerkzeug taugt, der sich ausschließlich an Kleinkinder richtet!2
Betrachtet man die meistgeklickten Videos, wird es noch absurder. Hier ist Cocomelon gleich zwei Mal unter den Top 10. Der Kindergeburtstagskracher Wheels on the Bus ist auf Platz 3 mit 7,8 Milliarden Klicks, der Bath Song folgt dicht dahinter mit 7,12. Und das meistgeklickte YouTube-Video aller Zeiten mit Weitem Abstand: Baby Shark Dance mit 16,14 Milliarden! Und unter den Top 10 sind noch zwei weitere Videos nur für Kindergartenkinder!3
Das Erfolgsrezept dieser Kanäle: Für das frühkindliche Gehirn regelrechte audiovisuelle Drogen erzeugen. Diese Videos haben keinerlei pädagogischen Wert, es geht einfach nur darum, die Kinder süchtig zu machen nach diesen quietschbunten, schnell wechselnden und das kindliche Gehirn dadurch vollkommen flashenden Bildern und eingängigen Melodien. Und ich weiß genau: Sobald ich Junior den Schund zeigen würde, wäre er auch sofort angefixt.
Doch die Hauptverantwortung trifft wohl die Zigmillionen Eltern, die auf dem ganzen Globus ihre Kinder mit solchem toxischen Content ruhigstellen bzw. nicht genügend Ich-Stärke aufbringen, um einfach mal „Nein“ zu sagen; oder deren Lebensumstände einfach zu prekär sind. Man muss es sich ja wirklich vor Augen führen: Für alle Altersklassen außer vielleicht zwei- bis sechsjährige sind diese Videos nahezu unerträglich, das heißt es muss auf der Welt Millionen von Kinderzimmern geben, in denen diese Verblödungshymen in Endlosschleife laufen.4 – Dass es derweil schon längst KI-Angebote für Kleinkinder gibt und Eltern, die ihre Kinder stundenlang mit ihnen sprechen lassen, überrascht da wenig.
Nein, das gibt’s bei mir alles nicht, bei uns wird noch normal gespielt und der einzige, der sich Geschichten ausdenkt auf der Basis von „Prompts“, ist der Papa. Hier sehe ich wirklich wenig Potential der KI und möchte meinen Sohn möglichst lange in Unkenntnis darüber lassen, dass es das überhaupt gibt. Der soll mal schön selbst mit seinen Tierfiguren und Klötzchen Zauberwelten erbauen, fiktive Freunde ersinnen und verrückte Fabelwesen malen.
YouTube ist leider, was Inhalte für Kleinkinder angeht, wie ein Bällebad, das mit klebrigen Marzipankugeln gefüllt ist. Ein besonders markantes Beispiel: Wer „deutsche Märchen“ oder Ähnliches sucht, muss sich erst einmal durch Unmengen von vermutlich ausschließlich KI-generiertem Mumpitz durchscrollen, bis er irgendetwas Brauchbares findet.5 Ist also alles verloren und werden unsere Kinder schon von früh an zu bildschirmsüchtigen, phantasielosen Konsumzombies konditioniert? „Letzten Menschen“ qua Geburt? Der OpenAI-Chef Sam Altman ließ kürzlich stolz verlauten, dass heute geborene Kinder niemals so „smart“ wie KI werden könnten. Das mag sogar zutreffen, wenn man „smart“ als hirnloses Nachplappern, das klug klingt, definiert.6 Allerdings aus anderen Gründen, als es Altman wohl meint …
In der frühkindlichen Erziehung scheinen mir jedenfalls digitale Medien mit Vorsicht zu genießen zu sein. Es wäre weltfremd, sie gar nicht zu gebrauchen, doch sie erziehen die Kinder zugleich zur Passivität. Das ist eine große Gefahr.

IV. Die „Vogel-Weisheit“7
Wenigstens eine Insel der Hoffnung gibt es: die entsprechenden Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ganz vorne dabei der Klassiker der Klassiker seit Opas Kindertagen: das Sandmännchen. Hier werden noch phantasievolle, lustige und kreative Geschichten erzählt, die nicht einfach dadurch entstanden, dass ein indischer Contentcreator bei ChatGPT „Write me a German fairy tale with a princess, a clownfish, and a rhinozeros“ eingab. Und das Beste: Sie sind auch für Eltern unterhaltsam, amüsant, lehrreich. So geht es wirklich nicht darum, das Kind vorm Bildschirm zu parken, sondern sich gemeinsam kuschelnd etwas anzusehen, was allen gefällt und über das man zusammen lachen und im Anschluss konversieren kann.
Eine unserer letzten Abendgeschichten war nun besonders bemerkenswert. Es ging darin um den jungen Spatzen Fieps. Er fliegt fröhlich mit seinen Spatzeneltern durch die Stadt und entdeckt eine Krempelkiste, die seine Neugier weckt. Darin enthalten: ein Blechvogel mit Aufziehfeder. Fieps will sich mit ihm unterhalten, doch bekommt keine Antwort. Als Fieps ihn dann anstupst, fängt er plötzlich an sich zu bewegen, doch vollkommen ungelenk und ziellos. Er rennt immer wieder gegen die Kistenwand. Das tut Fieps leid und er will seinem neuen Freund das Fliegen beibringen. Doch alles Zeigen, Erklären und Anstupsen hilft nicht: Der Blechkamerad versteht’s einfach nicht. Dann hat Fieps eine Idee: Er stupst den Automaten noch einmal an und katapultiert ihn mit einer aus einem Nudelholz und einem Buch bestehenden Wippe zum Karton hinaus. Der Blechvogel hüpft von dannen in die Abendsonne, Fieps behält seinen Aufziehschlüssel zurück, den er fortan als eine Art Kuscheltier behält.
So ist es auch mit Mensch und KI: Von sich aus kann sie überhaupt nichts, man muss sie erst aufziehen und anstupsen, ehe sie irgendetwas zustande bringt. Unsere Anweisungen versteht sie oft gar nicht erst und auch, wenn sie auf den ersten Blick menschlich wirkt, ist sie zu Höhenflügen der Phantasie eben doch nicht fähig. Erst mit sehr viel eigener Kreativität kann man sie zum Fliegen bringen, doch auch dann ist es eher ein Hüpfen gen Abendlicht, kein Aufbruch ins Morgenrot. Und irgendwann ist Schluss, wenn der menschliche Input fehlt. Wir Menschen haben durch sie ein neues nützliches Werk- und unterhaltsames Spielzeug gewonnen, doch werden dadurch ebenso wenig bedroht wie der Schachsport durch Schachcomputer oder echte Haustiere durch den Furby (übrigens auch schon eine Art „Künstliche Intelligenz“ – releast vor 26 Jahren!) – wer kennt den überhaupt noch? Am Ende des Tages können wir uns beruhigt schlafen legen, während die Roboter ohne zu murren den Boden wischen und den Abwasch machen …

V. Quid est veritas?
Man muss sich stets vor Augen halten: Es handelt sich bei KI nicht zuletzt um einen gewaltigen Hype, eine typische Blase. Große Konzerne haben Milliarde von Dollar in die Entwicklung dieser Tools investiert und die müssen sich nun irgendwie amortisieren. Und unzählige Glücksritter wollen nun ihr Scheibchen vom Marzipankuchen abhaben. Aus dieser Sicht muss die KI umwerfend, revolutionär, unglaublich arbeitssparend sein. Und teilweise ist sie all das sicher auch. Doch am Ende haben wir es doch mit einem Phänomen wie Kryptowährungen, automatischem Fahren oder dem erwähnten Wunderspielzeug zu tun: Themen, die einige Monate durch alle Medien gehen und sich am Ende doch als Luftnummern herausstellen oder zumindest nicht als derart lebensverändernd, wie sie anfangs präsentiert werden.
Nietzsche entnehme ich eine gewisse Gelassenheit, wenn es um solche kurzlebigen Fragen geht, den „Lärm der grossen Schauspieler und das Geschwirr der giftigen Fliegen“8. Es geht vor allem darum, nicht einem Denkfehler zu unterliegen, der in der gegenwärtigen Mediendebatte um KI oft gemacht wird: zu unterstellen, dass technologischer Fortschritt linear, wenn nicht gar exponentiell verläuft. Die Wahrheit ist: Neue technologische Innovationen tauchen in der Regel plötzlich auf, doch ihre Entwicklung stagniert dann oftmals über längere Zeit und betrifft nur Detailfragen, bis dann die nächste technische Revolution stattfindet. Technologische Entwicklung vollzieht sich also plötzlich und sprunghaft, nicht kontinuierlich und berechenbar. Im Fall der KI wird es nun vor allem darum gehen, mittels besserer Schnittstellen die Grenzen und Möglichkeiten ihrer alltäglichen Anwendung zu erkunden; weitere bahnbrechende Entwicklungen sind schon allein aus dem Grund auf absehbare Zeit nicht zu erwarten, dass die Hardware ihrer linearen Weiterentwicklung enge Grenzen setzt. Rechenleistung ist nun einmal physisch begrenzt, solange nicht vollkommen neue Chip-Modelle erfunden werden, und auch der Strom, mit dem die Superrechner, die hinter der KI stecken, betrieben werden, kommt nicht einfach aus der Steckdose. Ebenso wenig, wie Roboter auf absehbare Zeit Pakete austragen oder Supermarktregale einräumen werden können, werden sie das prinzipielle Problem überwinden können, dass menschliche Kreativität und echtes Nachdenken „chaotische“, an einen fühlenden und leidenden Leib gebundene, Elemente beinhaltet, die Computer allenfalls nachahmen, aber eben nicht selbst vollziehen können. Auch das hat Nietzsche klar erkannt.
Machen wir uns nichts vor: Es gibt eigentlich keine „künstliche Intelligenz“, sondern nur eine starke Verbesserung in den sprachlichen und bild- und tongenerierenden Fähigkeiten der von uns entwickelten Maschinen. Computer sind besser darin geworden, uns zu täuschen und Intelligenz zu simulieren; sie sind nicht wirklich intelligent geworden. Dies zeigt sich am deutlichsten, wenn es um die Frage nach der Wahrheit von Aussagen geht. Auch wir Menschen plappern die meiste Zeit nur Aussagen nach, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, doch wir haben zugleich einen Begriff von der Wahrheit oder Unwahrheit dieser Aussagen. Auf der Basis eines bestimmten intuitiven Verständnisses unserer Wirklichkeit fällen wir Urteile über den Wahrheitsgehalt von Aussagen – und das jeden Tag. Doch dieser Prozess ist ein hochgradig kreativer, der verlangt, eine Aussage derart zu interpretieren, dass sie in Wahrheitskriterien übersetzbar wird und deren Erfüllung anhand eines in letzter Instanz leiblich-intuitiven Verständnisses von Wirklichkeit zu überprüfen.
Selbst ein Computer, der mit einer Datenbank gefüttert wäre, die alle Fakten der Welt enthielte – was schon an sich unmöglich ist, da sich selbst das einfachste Phänomen in eine unendliche Fülle von „Fakten“ zerlegen lässt, wenn es kein intuitives Vorverständnis davon gibt, was als relevantes Faktum gelten soll und was nicht –, könnte auf dieser Basis unmöglich entscheiden, ob die von ihm produzierten Aussagen wahr oder falsch sind, weil ihm ein solches Verständnis vollkommen abgeht. Der Hang der KI zum Halluzinieren ist mithin kein „Unfall“ oder ein technisch zu behebendes Manko, sondern zeigt eine unlösbare Aporie auf: Es kann keine Maschine geben, die ohne genau vorgegebene Parameter zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden kann. Doch da es solche klaren und eindeutigen Parameter bei gewöhnlichen Aussagen in der Regel nicht gibt, muss es beim bloßen Nachplappern bleiben. Man muss nur hinreichend komplexe Fälle – wie etwa die Interpretation philosophischer Texte – konstruieren, um jede KI ins Bockshorn zu jagen; und oftmals genügen banalste Fragen aus.
Und diese Überlegungen gelten analog für alle Bereiche menschlicher Praxis. Die Gelingensbedingungen unserer Tätigkeiten sind nie zu 100 % maschinengerecht operationalisierbar. Merkmale eines guten Essens, einer höflichen Geste, einer tugendhaften Tat, einer schönen Landschaft; wir alle kennen sie, ohne sie doch explizieren zu können – und dennoch ist es immer möglich, dass uns ein guter Koch etwa mit einem Essen überrascht, dass wir genießen, ohne dass es unserem expliziten Verständnis einer guten Speise entspricht. Und wer würde schon gerne in einer Welt ohne „Chaos“ leben, in der es anders wäre, ohne Ausnahmen, ohne komplexe Grenzfälle, ohne Ermessensspielraum?
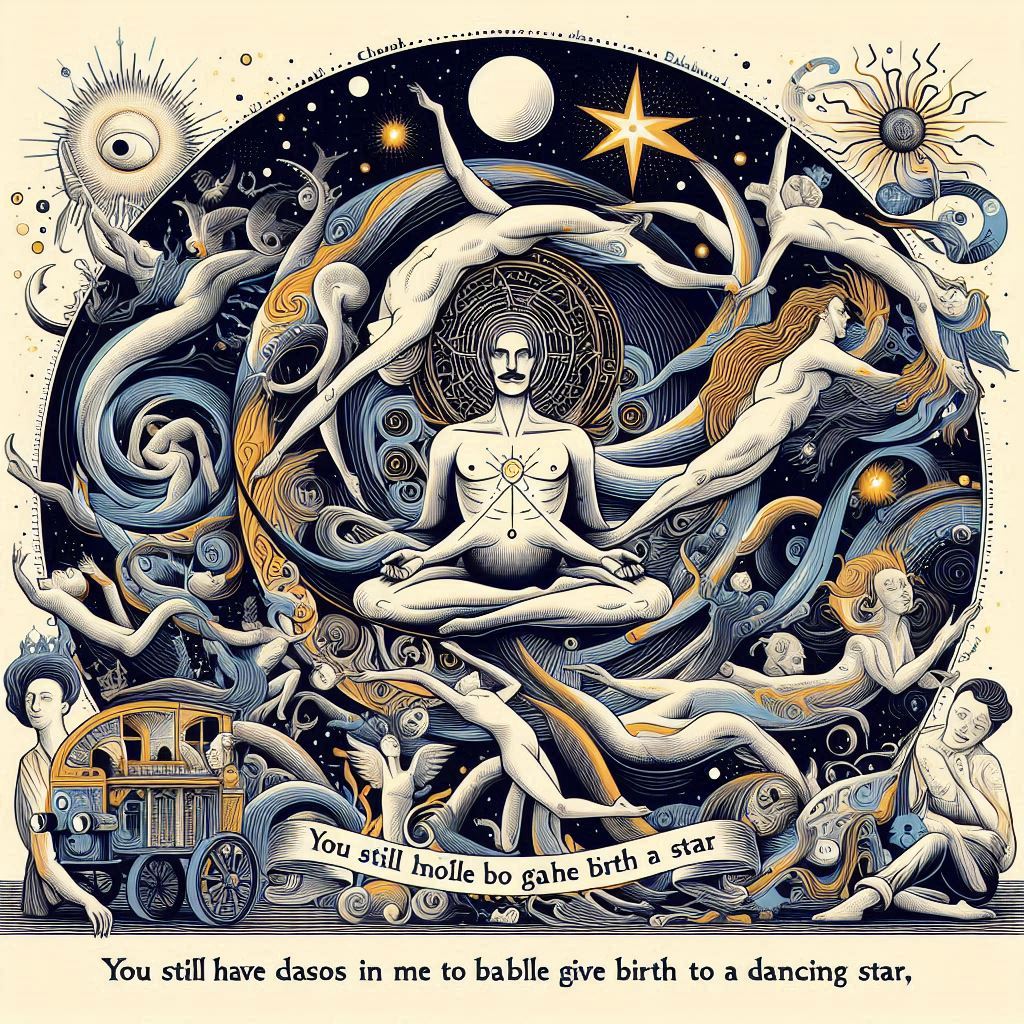
VI. Amme, mehr nicht
Von der KI ist aus ihr selbst heraus weder die Realisierung irgendwelcher Utopien zu erwarten noch die Apokalypse zu befürchten. Ihre Grenzen werden sich nach dem Abflauen des künstlichen Hypes schnell herausstellen und sich der Diskurs um sie normalisieren. Die beiden eigentlich entscheidenden Fragen, um deren Klärung es gehen müsste, werden dann hoffentlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit kommen: Wie kann man sicherstellen, dass von der kommerziellen Nutzung der KI-Systeme nicht nur große Konzerne, sondern auch die kreativen Datenlieferanten (Künstlerinnen, Autoren, Musiker etc.) profitieren? Hier scheint mir tatsächlich ein großes Problem im Sinne einer echten revolutionären Enteignung zu bestehen.9 Und wie können wir den durch diese neuen Maschinen rasant steigenden Heißhunger nach Energie und anderen begrenzten Ressourcen wie Kühlwasser oder Metallen aller Art stillen, ohne den drohenden ökologischen Kollaps des Planeten weiter zu beschleunigen?
An meiner verhalten optimistischen Einschätzung vor einem Jahr (Link) würde ich also unverändert festhalten wollen. Die KI wird aus sich selbst heraus weder zu einem „Ende des Menschen“ führen – höchstens in dem Sinne, dass ein Dritter Weltkrieg geführt von nicht mehr zu stoppenden vollautomatisierten Killerdrohnen ausbricht, doch dann sind es erneut nicht die Maschinen, die die Schuld tragen – noch zur Heraufkunft des „Übermenschen“. Wir werden uns so oder so auch weiterhin auf unsere notwendig beschränkte Intelligenz – tastend, experimentierend, chaotisch – verlassen müssen, sind wir doch keine „Denk-, Schreib- und Redemaschinen“10. Zum Glück!
Literatur
Herzog, Werner: Die Zukunft der Wahrheit. München 2024.
Fußnoten
1: Die Zukunft der Wahrheit, S. 10. Das Buch beinhaltet generell einige interessante Einsichten zum Thema KI.
2: Quelle: Wikipedia, Stand: 19.08.2025.
3: Quelle: Wikipedia, Stand: 19.08.2025.
4: Man kann es auch genauer berechnen. Der Baby Shark Dance ist seit 9 Jahren online. Auf der Welt gibt es etwa 1,45 Milliarden Kinder im Alter zwischen 0 und 10, davon lebt etwa 1/3 in extremer Armut (!) und hat vermutlich keinen Zugang zu solchen Medien, bleiben also 957 Millionen. Das bedeutet, jedes Kind in dieser Kohorte muss sich den Baby Shark Dance im Durchschnitt 17 Mal angesehen haben seit seinem Erscheinen!
5: Meine Empfehlung an dieser Stelle: Der leider eingestellte Kanal Deine Märchenwelt.
6: Was, nebenbei bemerkt, auch recht gut dem Verständnis von Parvenüs vom Schlage Altmans entsprechen dürfte.
7: Also sprach Zarathustra, Die sieben Siegel, 7.
8: Also sprach Zarathustra, Von den Fliegen des Marktes.
9: Auch diese Frage dürfte sich allerdings als lösbar herausstellen, nehmen sich doch nun auch Kreativkonzerne wie Disney der Sache an (Link).
10: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, Abs. 5.
Kann KI einen tanzenden Stern gebären?
Von Spatzen, Kanonen und Lockvögeln
Wie schon vor einem Jahr (Link) ergänzt unser Autor Paul Stephan auch seinen diesjährigen „Dialog“ mit ChatGPT (Link) um einen Kommentar zum aktuellen Stand der Entwicklung der „Künstlichen Intelligenz“. Seine Einschätzung fällt etwas nüchterner aus – doch seinen grundsätzlichen Technikoptimismus möchte er sich nicht nehmen lassen. Pessimismus und naiven Hype, der gerade offensichtlich geschürt wird, um sicherzustellen, dass sich die Milliardeninvestionen in KI auch amortisieren, möchte er gleichermaßen vermeiden.
Die Bilder zu diesem Artikel ließen wir von verschiedenen KI-Tools zu folgendem Prompt generieren: „Erstelle mir bitte ein Bild zu dem Aphorismus ‚Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können‘ von Nietzsche“, eines von ChatGPT „Lieblingszitaten“ des Philosophen aus Also sprach Zarathustra (Link). Das Artikelbild stammt von Microsoft AI.
