Nietzsche POParts
Sind nicht Worte und Töne
Regenbogen und Schein-Brücken
zwischen Ewig-Geschiedenem?
Nietzsche
POP
arts
Nietzsche

Sind

nicht

Worte


und

Töne
Regenbogen
POP

und

Scheinbrücken

zwischen

Ewig-

Geschiedenem
arts

Zeitgemässer Blog zu den Erkenntnissen Friedrich Nietzsches
Artikel
_________
Der Übermensch im Hamsterrad
Nietzsche zwischen Silicon Valley und Neuer Rechter
Der Übermensch im Hamsterrad
Nietzsche zwischen Silicon Valley und Neuer Rechter


Dieser Essay, den wir mit dem ersten Platz des diesjährigen Eisvogel-Preises für radikale Essayistik auszeichneten (Link), untersucht Nietzsches Frage nach den „Barbaren“ im zeitgenössischen Kontext und analysiert, wie seine Philosophie heute politisch instrumentalisiert wird. Vor diesem Hintergrund zeigt der Text, wie Hustle Culture, Plattformkapitalismus und neoreaktionäre Ideologien den „Willen zur Macht“ ökonomisieren und zu einer neuen Form subtiler Barbarei werden: einer inneren Zersetzung kultureller Tiefe durch Marktlogik, technokratische Mythen und performativen Nihilismus. Dabei kann Nietzsches Denken gerade eingesetzt werden, um diese Tendenzen in ihrer Genealogie zu beschreiben, ihren immanenten Nihilismus zu enttarnen und einen (über-)humanen Gegenentwurf zu ihnen aufzuzeigen.
„[W]o sind die Barbaren des 20. Jahrhunderts?“1
Diese Frage aus einem Nachlassfragment Nietzsches provoziert auch heute noch: Wer sind nun die gegenwärtigen Kräfte, die die bestehende Ordnung herausfordern – und das nicht aus Zerstörungslust, sondern als Antwort auf eine Kultur, die sich zunehmend in Resignation und Marktlogik erschöpft? Wer sind die Barbaren unserer Zeit? Dieser Essay nimmt Nietzsches Frage als Ausgangspunkt für eine Gegenwartsanalyse: Wer hat dem fortschreitenden Nihilismus unserer Zeit etwas entgegenzusetzen – und was steht auf dem Spiel, wenn Philosophie zum Werkzeug politischer Mythologie wird? Um die Tragweite dieser Frage zu erfassen, gilt es zunächst, die unterschiedlichen Auslegungen Nietzsches im politischen Denken des 20. und 21. Jahrhunderts zu analysieren.
I. Machtmythologie vs. Kritik
Ein deutlicher Unterschied zwischen rechter und linker Nietzsche-Rezeption liegt in der Art, wie seine Texte gelesen und verstanden werden. VertreterInnen der Neuen Rechten neigen dazu, Nietzsche „beim Wort“ zu nehmen und somit affirmativ zu interpretieren. Begriffe wie der „Übermensch“ oder der „Wille zur Macht“ werden hier als Leitbilder für eine Politik verstanden, die Hierarchie, elitäres Denken und eine grundsätzliche Ablehnung des Egalitarismus rechtfertigen sollen. Hier erscheint Nietzsche als lehrender Prophet einer neuen aristokratischen Ordnung. Die Vereinnahmung Nietzsches durch rechte Strömungen stellt eine Kontinuität dar und lässt sich exemplarisch an der postum von Nietzsches Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche veröffentlichten Textsammlung Der Wille zur Macht nachvollziehen: Obwohl von Friedrich Nietzsche selbst nie autorisiert, wurde sie zum Referenztext für eine affirmativ-rechte Nietzsche-Rezeption – schon im Nationalsozialismus wurde Nietzsche als vermeintlicher Vordenker eines heroischen, völkischen Weltbildes missbraucht –, obwohl er selbst Antisemitismus, Nationalismus und jedes autoritäre Denken verurteilte. So stützte sich Martin Heidegger zunächst auf die verfälschte Ausgabe und reduzierte Nietzsche auf eine „Vollendung der Metaphysik“ – womit seine existenzielle und genealogische Radikalität entleert wurde.2 In der Neuen Rechten wird, von Alain de Benoist bis zu Götz Kubitschek, Nietzsche weiterhin als Projektionsfläche eines postliberalen Elitarismus stilisiert, während seine Kritik an Macht, Moral und Ressentiment gezielt umgedeutet oder schlicht ignoriert wird. So findet eine instrumentelle statt philosophische Rezeption statt: pseudointellektuell operierend, ideologisch aufgeblasen – und steht somit im Widerspruch zu jeder ernsthaften und dialektischen, also differenzierten und die internen Paradoxien von Nietzsches Werk reflektierenden statt leugnenden, Lektüre Nietzsches. Außerdem ist auffällig, wie sich die rechte Nietzsche-Rezeption stellenweise mit neoliberalen und auch libertären Weltbildern verbindet: Wird Nietzsche wortwörtlich als Prophet des „Willens zur Macht“ und als Kritiker egalitärer Moral gelesen, lässt sich darauf aufbauend eine Legitimation ungebremster Konkurrenz und gesellschaftlicher Hierarchie ableiten. So gilt der Erfolg der Starken – in wirtschaftlicher Hinsicht zum Beispiel erreicht durch die Vermeidung von Steuern – nicht mehr nur als ökonomisches Ergebnis, sondern wird mit dem Begriff der Moral erhöht: Er erscheint als Ausdruck einer natürlichen Überlegenheit. Eine ursprünglich kulturkritische Haltung kippt derart in eine neoliberale Ideologie, in der der Markt als natürliche Arena des „Übermenschen“ verstanden wird. So wird – paradoxerweise – Moral selbst zum Werkzeug der Herrschaft. Dem gegenüber liegend steht eine (linke) Nietzsche-Rezeption, die genau diese Mechanismen aufdeckt und kritisiert. Anstatt Nietzsche als Vordenker einer neuen Elite zu lesen, nutzt sie seine Gedanken genealogisch, um so zu zeigen, wie Moral und Diskurs zur Stabilisierung von Macht- und Profitinteressen missbraucht werden. So wird der „Willen zur Macht“ nicht affirmativ verherrlicht – stattdessen wird er analysiert als das, was gesellschaftliche Normen, Institutionen und Ideologien antreibt. Nietzsches Philosophie wird somit zu einem Werkzeug, um Herrschaft als kulturell erzeugtes, nicht „natürliches“ Phänomen sichtbar zu machen (zu „enttarnen“) – und somit Räume für Emanzipation, Solidarität und Kritik zu öffnen.
II. Hetzen in der Plattformwelt
Eine wortwörtliche Nietzsche-Lektüre, in der der „Wille zur Macht“ und der Erfolg des Starken moralisch verklärt werden, findet eine zeitgenössische Entsprechung in der „Hustle Culture“, welche auf Social-Media-Plattformen massenhaft propagiert wird.3 Permanente Selbstausbeutung – der Hustle –, das Optimieren, das Selbstvermarkten gilt hier als Zeichen von Stärke, von Tatkraft und kippt fast schon, je nach Darstellung, in ein heroisches Übermenschentum. Diese Hustle Culture lässt sich auch in Anlehnung an Max Webers Analyse des protestantischen Arbeitsethos als säkularisierte Heilslehre begreifen: Erlösung wird durch Leistung ersetzt und Produktivität wird somit zur moralischen Pflicht.4 Diese Ideologie stellt Arbeits- und Leistungsdruck als individuelle Tugend dar, verschweigt aber gezielt, wie sehr sie zugleich bestehende Machtverhältnisse und Eigentumsbedingungen stützt: Denn die Plattformen, auf denen dieser Kult verbreitet wird – ob auf TikTok, Instagram oder X (ehem. Twitter) –, gehören milliardenschweren Techkonzernen, die selbst nach der Logik des Willens zur Macht agieren und, ganz nebenbei, unvorstellbare Profite aus Aufmerksamkeit, Daten und unbezahlter Arbeit ziehen. Hier deckt die linke Nietzsche-Rezeption den Kern des Problems auf: Dass Moral und Diskurse – und auch „Selbstverwirklichung“ an sich – instrumentalisiert werden, um Plattformkapitalismus und digitalen Feudalismus zu legitimieren. Während einige wenige Konzerne den Löwenanteil der Gewinne einstreichen, wird dem Einzelnen suggeriert, er könne durch Hustle zum Übermenschen werden – eine Illusion, die den Status Quo zementiert, anstatt ihn zu hinterfragen.
Vor diesem Hintergrund erscheint die eingangs gestellte Frage, wer die „Barbaren“ in Nietzsches Sinn heute sind, in einem neuen Licht: die rechte, oft wortwörtliche Rezeption Nietzsches deutet die „Barbaren“ häufig als heroische Elite, die mit ihrem Willen zur Macht die Gesellschaft umstürzen wird, um neue Hierarchien errichten zu können; als „natürliche“ Führende im Zeitalter einer dekadenten Masse. Doch blickt man aufmerksam auf die heutige Realität von Hustle Culture, Plattformkapitalismus und digitalem Feudalismus, so zeigt sich eine eindeutige Wendung: Nun erscheinen genau die Konzerne und Plattformen, die nach außen den Kult des unbedingten Erfolgs, der grenzenlosen Selbstoptimierung und des Übermenschen promoten, als die eigentlichen Barbaren; nicht im romantischen, heroischen Sinn, sondern als destruktive Kräfte, die alles Untergründige, alles Fragile, alles Humane zerstören, um den Profit zu maximieren. Dadurch wird auch die Masse der Selbstausbeutenden, die auf Social-Media-Plattformen endlos Content produziert und sich selbst vermarktet, Teil einer neuen Barbarei: Nicht, weil sie diejenigen sind, die brutal herrschen, sondern weil sie unfreiwillig die Logik der Stärkeren reproduzieren und damit kulturelle Tiefe, kritische Reflexion und Solidarität opfern. So wird sichtbar, wie Barbarei heute nicht nur rohe Gewalt bedeutet, sondern auch die kalte, systematische Auslöschung von Differenz, von echtem Denken: also von dem, was Kultur im eigentlichen Sinn ausmacht. Die Barbaren von heute zerstören also nicht (nur) von außen, sondern sie wirken subtil von innen, wenn sie die Herrschaft der Plattformen und den Mythos vom Übermenschen als selbstoptimierte Unternehmerperson normalisieren. Die sogenannte „Hustle Culture“ ist dabei kein kulturelles Randphänomen, sondern Ausdruck einer tieferliegenden Ideologie, die auch in den Sphären der Tech-CEOs und ihrer diskursiv-theoretischen Vordenkenden wirkt. Wo einst Religion, Moral und Philosophie normative Orientierungen boten, tritt heute eine (vermeidlich) entpolitisierte Erfolgsästhetik an ihre Stelle – gespeist aus einem technokratisch gewendeten Willen zur Macht, der, wie Adorno und Horkheimer warnen würden,5 längst nicht mehr der Aufklärung dient, sondern ihr dialektisches Gegenteil produziert: Mythos in der Maske von Fortschritt. Diese Verschiebung ebnet den Weg für Strömungen wie die „Neoreaktionäre Bewegung“, abgekürzt oft „NRx“ – auch bekannt als „Dunkle Aufklärung“ –, die sich explizit an Nietzsche anlehnen, dabei jedoch alle dialektische, historisch-kritische Tiefe abwerfen. Die NRx denkt diesen Kult des Erfolgs, den die Hustle Culture emotional auf Plattformen inszeniert, konsequent zu Ende: als Möglichkeit der Unmenschlichkeit, als kybernetische Reorganisation von Herrschaft nach marktwirtschaftlichem Maßstab. Die „Theorie“ der NRx basiert auf pseudowissenschaftlichen Konzepten wie „Human Biodiversity“6 – einer Ethik des Stärkeren, aufbauend auf rassenideologischen Trugschlüssen – oder einem rechtslibertären Verständnis von Staat als Unternehmensstruktur. Dabei verzichten ihre Vertreter stets auf Kontextualisierung, historisches Bewusstsein oder moralische Reflexion. Die Dunkle Aufklärung performt Nihilismus, wo Nietzsche ihn überwinden wollte. Ihre AnhängerInnen kultivieren den Gestus der Radikalität – aber bleiben dabei, unfreiwillig komisch, in der Pose stecken. Ihr Barbar ist eine Karikatur: ein kybernetischer Reaktionär mit provokanten Social-Media-Profil, kein schöpferischer Geist. Wer die Frage des Barbaren ernst nimmt, wird sich dieser Vereinnahmung Nietzsches entziehen müssen: Sind die wahren Barbaren nicht die, die den kulturellen Zynismus verweigern? (Neu-)Rechte Akteure inszenieren sich gerne als die „stärkere Art“, von der Nietzsche in dem eingangs zitierten Nachlassfragment spricht: als diejenigen, die dem „kosmopolitische[n] Affekt- und Intelligenzen-Chaos“ ein Ende setzen könnten. Doch ihre Revolte zielt letztlich nicht auf neue Werte (oder gar: moralisch fundierte), sondern auf die Reaktivierung alter Ordnungsphantasien: Autorität, Hierarchie – in Form einer technologischen Herrschaft. Sie predigen Entzauberung, beschwören dabei aber eigene Mythen: der Markt als Maschine der Offenbarung, der Code als Gottesbeweis, das Ewige Leben in der Cloud, der CEO als Souverän. In dieser Welt wird Nietzsche nicht gelesen, sondern gebraucht: als (pseudo-)ästhetische Chiffre eines Willens zur Macht.
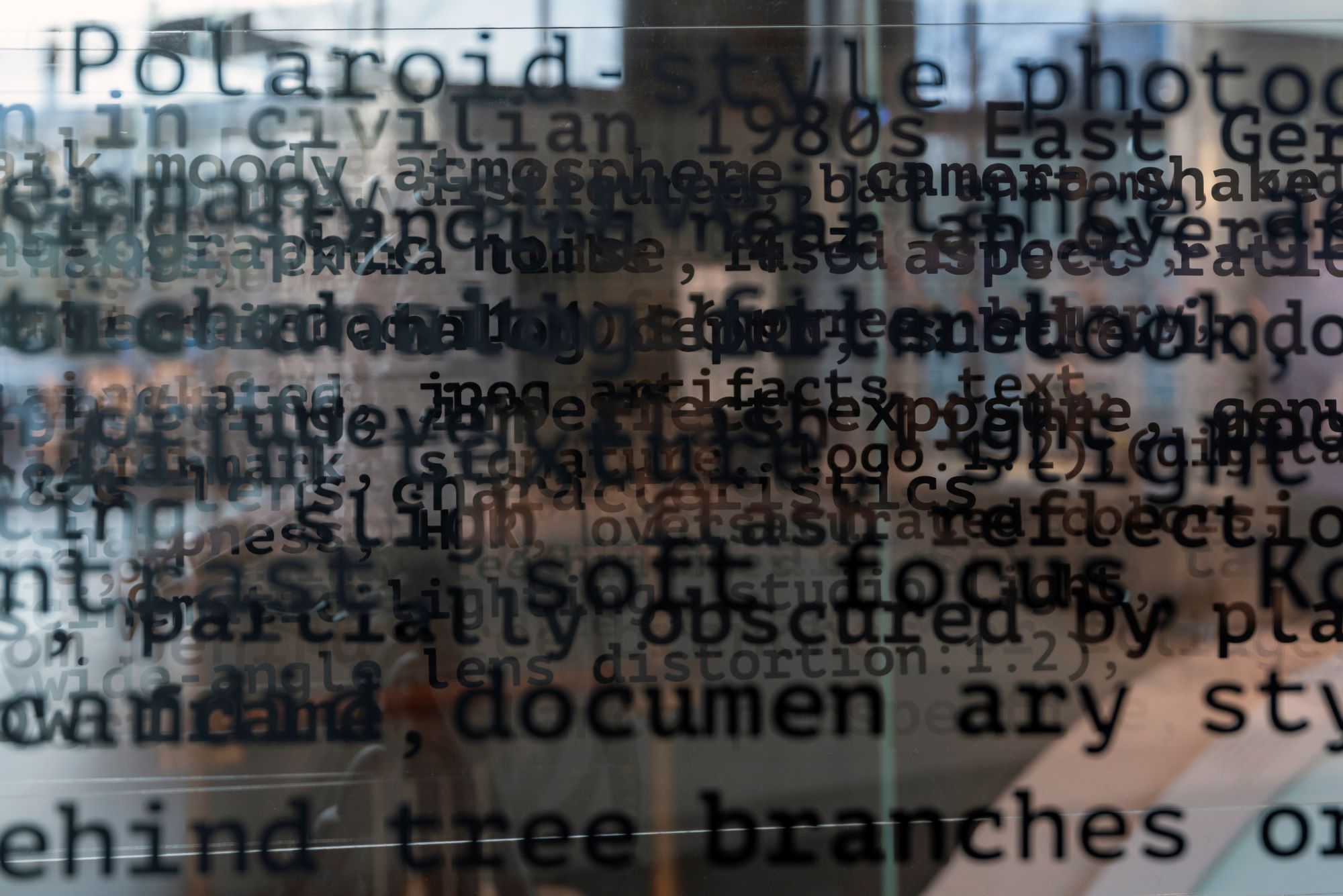
III. Ein linksnietzscheanischer Gegenentwurf?
Die entscheidende Differenz liegt hier darin, dass Nietzsche seine Barbaren nicht als Funktionäre eines neuen Systems gedacht hat, sondern als existenziell Störende: als diejenigen, die durch radikale Arbeit in und an ihrem Innern zur Schöpfung fähig und tätig werden. Es ist der Einzelne, der bei Nietzsche zählt, nicht die Elite. „Der Übermensch ist der Sinn der Erde“7, ruft Zarathustra „allen und keinem“ zu – und dieser Übermensch entsteht nicht durch technologischen Fortschritt: Er ist kein Cyborg, kein posthumanes Subjekt, sondern zur Umwertung, zur Verwandlung, zur künstlerischen Selbstschöpfung fähig. So bleibt die Frage: Sind die neuen Tech-CEOs wirklich die Barbaren, auf die Nietzsche gehofft hat – oder eine postironische Simulation derselben Idee? Vielleicht sind sie die Karikatur des Wandels, den Nietzsche gefordert hat: zukunftsvergessen, strategisch überheblich, metaphysisch hohl. Und doch wird gerade dieser radikale, existenzielle Ernst in der Ästhetik der Neuen Rechten karikiert: Was sich dort als Barbarentum inszeniert – in Podcasts, vermeintlicher Guerilla-Ästhetik und pseudo-intellektuellem Tech-Bro-Gehabe – ist keine Antwort auf den Nihilismus, sondern dessen performativer Vollzug. Die Neue Rechte und ihre SympathisantInnen verstecken sich hinter dieser Maske des „(post)ironischen Barbaren“: einer Pose, die sich zugleich über Ernsthaftigkeit erhebt und sich dennoch als Avantgarde behauptet. Ihre ProtagonistInnen agieren wie Figuren einer kantischen Parodie: Sie handeln, als ob sie einer transzendentalen Maxime folgen, nur um sich im nächsten Augenblick vom Spielcharakter ihres eigenen Handelns zu distanzieren.8 Kant würde hier keine Freiheit diagnostizieren, viel eher Heteronomie durch Zynismus, eine moralische Fehlleistung, die Freud als „Rationalisierung“ bezeichnen würde: Ein kulturelles Über-Ich wird simuliert, während der Wille zum Nihilismus schon längst regiert.9 Nietzsche wäre der schärfste Kritiker dieses Spiels, denn seine Idee des Barbaren setzt eine radikale „psychologische[] Nacktheit“ 10 voraus, eine existenzielle Offenheit, die sich nicht vom zynischen Lachen nährt, sondern vom Risiko zur Selbstgestaltung. Wenn Nietzsche schreibt, dass die „Barbaren“ „der größten Härte gegen sich selber fähig“ (ebd.) sein müssen, dann meint er eben keinen kalten Technokratismus, sondern ein kritisches Durcharbeiten der eigenen Verstrickung in das, was man selber kritisiert. Der Barbar ist also nicht der, der bestehende Ordnungen verspottet, sondern derjenige, der fähig ist, nach dem Zusammenbruch eine neue Ordnung zu schaffen, die sich nicht mehr auf die Ressentiments der alten stützt. Die Neue Rechte hingegen ersetzt Gestaltung durch Affektökonomie: Sie imitiert Tiefe, ohne sie zu erleiden. Ihre „Barbaren“ sind SchauspielerInnen in einem ideologischen Theater. Das Resultat ist kein neuer Mythos, sondern ein nihilistischer Kulturkampf, der sich an den Trümmern der Moderne berauscht, ohne dabei etwas Neues zu erdenken oder gar zu erbauen.
So führt die eigentliche Frage nach dem „Barbaren“ letztlich auf eine paradoxe Bewegung zurück: Kaum gestellt, so verrät diese Frage die eigene Sehnsucht nach dem Außen, das es nicht gibt – ein Symptom jener Dekadenz, die man zu überwinden hofft (und die Nietzsche selbst stark kritisiert hat). Auch dieses Essay hier bleibt – neben einer Analyse des Status Quo – selbst Teil einer Ordnung, die er infragestellt und zugleich fortschreibt. Die Barbarei unserer Gegenwart ist daher eben nicht das rohe Außen, sondern das subtile Innen: die totale Erschöpfung, die jede Revolte in Pose verwandelt; die Langeweile einer Welt, in der auch das „dagegen sein“ zum Ornament des Marktes wird. Die neuen Barbaren treten nicht als heroische Gestalten auf, sondern als Algorithmen – die unsere Aufmerksamkeit strukturieren, während wir noch glauben zu wählen. Es sind Machtapparate, die sich selbst als Fortschritt markieren und gerade darin die eigentliche Kultur liquidieren. Im Zustand der Entropie bleibt das Werden möglich – man denke nur an Deleuzes Werdensbegriff11: nicht als harmonische Lösung, sondern als riskante Bejahung von Differenz. Das Chaos ist nicht nur Zerfall, sondern gleichzeitig Bedingung für Schöpfung, eine Bewegung im Innern der Auflösung: das Risiko, ohne Garantie zu handeln, als Imperativ. Letztlich bleibt weder Barbar noch Humanist – nur die Frage, ob es möglich ist, im Bewusstsein der eigenen Verstrickung anders zu handeln, ohne dabei zu wissen, was dieses „Anders“ bedeuten kann.
Tobias Kurpat (geb. 1997 in Leipzig) studiert in der Klasse für Künstlerisches Handeln und Forschen an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bei Prof. Christin Lahr. In seiner Arbeit untersucht er virtuelle Räume als ideologisch aufgeladene Territorien und analysiert die Spannung zwischen technokratischen Machtstrukturen, Künstlicher Intelligenz und immersiven Medien. Dabei setzt er sich kritisch mit den Mythen des Silicon Valley sowie pseudowissenschaftlichen Narrativen auseinander. In Essays, Malerei und digitalen Praktiken erforscht er, wie postdigitale Infrastrukturen gestaltet, instrumentalisiert und ästhetisch zurückerobert werden können.
Quellen
Adorno, Theodor W. & Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt a. M.: Fischer 1969 [zuerst: Amsterdam: Querido 1947].
Dasgupta, Kushan, Nicole Iturriaga & Aaron Panofsky: How White nationalists mobilize genetics: From genetic ancestry and human biodiversity to counterscience and metapolitics. In: American Journal of Physical Anthropology 175/2 (2021), S. 387-398; doi:10.1002/ajpa.24150.
Deleuze, Gilles: Nietzsche und die Philosophie. München: Rogner & Bernhard 1976 [franz. Original: Nietzsche et la philosophie. Paris: PUF 1962].
Deleuze, Gilles & Félix Guattari: Was ist Philosophie? Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2000 [franz. Original: Qu’est-ce que la philosophie? Paris: Éditions de Minuit 1991].
Freud, Sigmund: Das Unbehagen in der Kultur. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag 1930.
Heidegger, Martin: Nietzsche. Der europäische Nihilismus. In: Gesamtausgabe Bd. 47. Frankfurt a. M.: Klostermann 2004; abrufbar auf https://www.beyng.com/gaapp/recordband/46.
Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Riga: Hartknoch 1785.
Nietzsche, Friedrich: Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte, hrsg. von Elisabeth Förster-Nietzsche. Leipzig: Naumann 1901 (abgerufen über Project Gutenberg: https://www.gutenberg.org/files/60360/60360-h/60360-h.htm). [Nicht von Nietzsche autorisiert!]
Weber, Max: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. In: Ders.: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I. Tübingen: Mohr Siebeck 1920 [zuerst in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 1904/5].
Bildnachweis
Artikelbilder: Ausschnitte aus der Installation „Fotoalbum (made in GDR)“ von Tobias Kurpat (Fotograf: Sven Bergelt)
Portrait: Foto von Aaron Frek
Fußnoten
1: Nachgelassene Fragmente 1887, Nr. 13[31].
2: Heidegger, Der europäische Nihilismus, S. 7 f. (§ 1).
3: „Hustle Culture“ bezeichnet einen gesellschaftlichen Trend, in dem ständige Arbeit, Produktivität und beruflicher Ehrgeiz glorifiziert werden. Dabei wird das „Sich-Abrackern“ (to hustle) nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern als erstrebenswerter Lebensstil inszeniert, oft auf Kosten von Freizeit, Gesundheit und Schlaf.
4: Vgl. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus
5: Vgl. Theodor W. Adorno & Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung.
6: Vgl. Kushan Dasgupta, Nicole Iturriaga & Aaron Panofsky, How White nationalists mobilize genetics.
7: Also sprach Zarathustra, Vorrede, 3.
8: Vgl. Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
9: Vgl. Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur. Für eine vertiefte Analyse dieses Phänomens am Beispiel des neoreaktionär-„avantgardistischen“ KünstlerInnen-Kollektivs The Unsafe House vgl. meinen Artikel Wenn die Avantgarde rückwärts marschiert.
10: Nachgelassene Fragmente 1887, Nr. 13[31].
11: Vgl. Gilles Deleuze & Félix Guattari, Was ist Philosophie? und Deleuze, Nietzsche und die Philosophie.
Der Übermensch im Hamsterrad
Nietzsche zwischen Silicon Valley und Neuer Rechter
Dieser Essay, den wir mit dem ersten Platz des diesjährigen Eisvogel-Preises für radikale Essayistik auszeichneten (Link), untersucht Nietzsches Frage nach den „Barbaren“ im zeitgenössischen Kontext und analysiert, wie seine Philosophie heute politisch instrumentalisiert wird. Vor diesem Hintergrund zeigt der Text, wie Hustle Culture, Plattformkapitalismus und neoreaktionäre Ideologien den „Willen zur Macht“ ökonomisieren und zu einer neuen Form subtiler Barbarei werden: einer inneren Zersetzung kultureller Tiefe durch Marktlogik, technokratische Mythen und performativen Nihilismus. Dabei kann Nietzsches Denken gerade eingesetzt werden, um diese Tendenzen in ihrer Genealogie zu beschreiben, ihren immanenten Nihilismus zu enttarnen und einen (über-)humanen Gegenentwurf zu ihnen aufzuzeigen.
Barbarinnen – wenn Frauen zur Gefahr werden
Barbarinnen – wenn Frauen zur Gefahr werden


In der heutigen Welt, die sich modern und gleichberechtigt nennen will, wirken alte Muster fort – Rivalität statt Solidarität, Anpassung statt Aufbruch. Der Essay fragt provokant: Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts? Er zeigt das Entstehen einer neuen weiblichen Kraft – einer Frau, die nicht zerstört, sondern verweigert, die sich alten Rollen entzieht und aus Schmerz schöpferische Kraft gewinnt. Durch Beispiele aus der Realität und der Literatur versucht der Text zu zeigen, dass wahre Veränderung nicht in Gehorsam, sondern im mutigen „Nein“ beginnt – und dass Solidarität unter den Frauen die eigentliche Revolution sein könnte.
Wir prämierten den Text mit dem zweiten Platz des diesjährigen Eisvogel-Preises für radikale Essayistik (Link).
Wer ihn lieber anhören möchte, findet ihn zusätzlich eingelesen von Caroline Will auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie (Link) oder auf Soundcloud (Link).
I. Einleitung
Als ich vor über zwanzig Jahren mein Studium beendete, hatte ich das Gefühl, dass unsere Zeit gekommen war. „Jetzt sind wir dran, Mädels!“, dachte ich voller Enthusiasmus. Gebildet, mutig und stark wollten wir eine neue Realität schaffen, in der Frauen nicht mehr nur eine Nebenrolle spielen, sondern Schöpferinnen ihres eigenen Lebens sind. Es schien mir, als seien alle Grenzen meiner Phantasie und meiner Möglichkeiten offen.
Die Realität erwies sich jedoch als komplexer. Ja, das stimmt, wir Frauen sind heute deutlich präsenter als das noch zum Beispiel im 20. Jahrhundert der Fall war. In der Politik, Kultur und Wissenschaft sind zahlreiche beeindruckende Beispiele zu finden. Wir bekleiden hohe Ämter, kämpfen mutiger für unsere Rechte, gehen auf die Straße, um zu demonstrieren. Unter der Oberfläche der emanzipatorischen Erfolge bestehen jedoch weiterhin alte Strukturen fort. Die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen – gleichzeitig perfekte Arbeitnehmerinnen, Mütter und Betreuerinnen zu sein – sind nicht verschwunden. Es besteht weiterhin eine Diskrepanz zwischen Frauen- und Männerwelten: Eigenschaften, die bei Männern bewundert werden (Stärke, Ehrgeiz, Unabhängigkeit), werden bei Frauen oft negativ beäugt. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld: Frauen sollen sich einerseits emanzipiert und selbstbewusst zeigen, andererseits aber weiterhin traditionelle Vorstellungen erfüllen.
Meiner Meinung nach liegt das Problem bei uns Frauen in der mangelnden Solidarität untereinander. Die Frauen wurden nicht immer im Geiste der Gemeinschaft erzogen, sondern eher im Geiste der Rivalität und des Wettbewerbs, im ständigen Ringen um Anerkennung und Akzeptanz in einer patriarchalischen Welt. Dabei ist es gerade die Gemeinschaft, die die Möglichkeit eröffnet, individuelle Schwächen zu überwinden, neue Kräfte freizusetzen und bestehende Machtverhältnisse nachhaltig zu verschieben.
Allzu oft handeln wir allein und wiederholen dabei die uns auferlegten Muster der Rivalität. Wer nur gegeneinander kämpft, schwächt die eigene Position und verhindert die Entstehung einer solidarischen Bewegung. Die Erfahrung echter Gemeinschaft – das Teilen von Wissen, das gegenseitige Stärken, das Aufbrechen von Konkurrenz – ist dagegen unsere größte Ressource. Dabei liegt gerade in der Erfahrung der Gemeinschaft unsere größte Stärke.
Daher die Frage: „Wo sind die die Barbaren des 21. Jahrhunderts?“. Kann die moderne Frau zu einer Figur werden, die Nietzsche als „Barbar” bezeichnete – nicht als zerstörerische, sondern als schöpferische Kraft, die alte Ordnungen zerbricht, um Platz für Neues zu schaffen?
Vielleicht bedeutet dies, dass die Frau von heute nicht länger in den Kategorien denkt, die ihr vorgegeben wurden, sondern eigene Formen von Macht, Kreativität und Gemeinschaft entwickelt. In dieser Gestalt könnte die Frau tatsächlich zu einer historischen Kraft werden, die nicht nur Gleichheit fordert, sondern die Grundlagen des Miteinanders neu definiert.
II. Solidarität als Kraft
Die Geschichte zeigt uns, dass Männer über Jahrhunderte hinweg die Kunst der Zusammenarbeit perfektioniert haben. Armeen, Bruderschaften, Gewerkschaften – all dies basierte auf gemeinsamen Zielen, klaren Strukturen und unerschütterlicher Loyalität gegenüber der Gruppe. Frauen hingegen agierten meist als Einzelpersonen im familiären Umfeld. Uns wurde nie wirklich vermittelt, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, dass Zusammenhalt nicht nur eine Tugend, sondern eine Überlebensstrategie ist.
Doch gerade in dieser Erkenntnis liegt ein Wendepunkt. Erst in der Gemeinschaft entdecken wir unsere wahre Kraft. Was in der Einsamkeit eine Last ist, wird durch viele Schultern geteilt und damit tragbar. Was allein wie ein leises Flüstern klingt, wird in der Gemeinschaft zu einer Stimme, die niemand ignorieren kann. Solidarität unter Frauen bedeutet, alte Muster der Rivalität hinter sich zu lassen, um neue Ordnung zu schaffen. Es geht nicht darum, Männer nachzuahmen, sondern eigene Formen der Kooperation zu entwickeln – geprägt von Empathie, Kreativität und gegenseitiger Stärkung.
III. Nietzsche und die Figur des Barbaren
Friedrich Nietzsche verwendete den Begriff „Barbar“ in einem Sinn, der weit vom Alltagsverständnis abwich. Er meinte damit nicht einen primitiven, wilden Menschen, sondern jemanden, der die Kraft hat, die Grenzen der alten Moral zu überschreiten. Der Barbar war für ihn eine kreative Figur – jemand, der sich nicht scheut, die bestehende Ordnung zu zerstören, um Platz für neue Werte zu schaffen.
Nietzsche sah im Barbaren die Antwort auf den Nihilismus der Moderne. Wenn alte Wertesysteme zerfallen, braucht es Menschen, die den Mut haben, sich ins Unbekannte zu wagen und der Welt von Grund auf einen neuen Sinn zu geben. Der Barbar ist also kein Zerstörer aus Hass, sondern jemand, der durch Verweigerung und Rebellion Raum für die Zukunft schafft.
Nietzsche schrieb darüber in männlichen Kategorien – seine Sprache ist voller Figuren von Kriegern und „Übermenschen“. Über Frauen äußert er sich oft ironisch, manchmal sogar misogyn. Und doch lässt sich Nietzsche „gegen ihn” lesen und erkennen, dass seine Kategorie des Barbaren geschlechtsneutral ist. Nicht das Geschlecht, sondern die innere Stärke und die Authentizität entscheiden über die Fähigkeit, neue Werte hervorzubringen.
In dieser Lesart wird die Figur des Barbaren – oder besser: der Barbarin – zu einem Symbol für Transformation. Sie verkörpert die Kraft, nicht nur Teil einer Geschichte zu sein, sondern selbst Geschichte zu schreiben.
IV. Eine Frau – Die Barbarin
Wenn wir den Barbaren als eine Figur der kreativen Verweigerung betrachten, dann verkörpert gerade die moderne Frau eine Figur der Barbarin.
Über Jahrhunderte hinweg wurde sie an den Rand der patriarchalischen Kultur gedrängt – ein Rand, der zugleich Ausschluss und Widerstand ermöglichte. Von dort aus konnte sie nicht nur beobachten, sondern auch einen neuen Weg erlernen, um das gesamte System in Frage zu stellen.
Ihre „Barbarei“ besteht nicht aus Gewalt, sondern der Verweigerung, Rollen anzunehmen, die sie verstummen lassen. Der Verweigerung, sich dem System anzupassen, das sie als „minderwertig“ einstuft. Verweigerung des Lächelns, wenn Gehorsam verlangt wird. In der Verweigerung, die Regeln eines Spiels zu akzeptieren, das sie nie erfunden hat.
Eine Barbarin ist eine Frau, die sich weigert, eine „bessere Version eines Mannes“ zu sein. Sie spielt nicht nach fremden Regeln. Sie will kein Material im Projekt eines anderen sein, sondern schreibt ihre eigenen Regeln. Ihre Stärke entsteht aus Schmerz – aus der Erfahrung von Verrat, Verlust, Gewalt und verwandelt sich in die Entscheidung, nicht aufzugeben und alte Abhängigkeiten zu durchbrechen. Sie durchschneidet die alten Abhängigkeiten, wie eine Kriegerin, die ihre Fesseln sprengt. Sie trägt die Spur des „Außen“ in sich – und genau daraus zieht sie ihre schöpferische Kraft.

V. Frauen in der Mafiawelt
In Alex Perrys Roman The Good Mothers lernen wir die Geschichten von Frauen kennen, die mit der kalabrischen Mafia „Ndrangheta“ in Verbindung stehen. Dort sind Männer – Väter, Brüder, Partner – keine romantischen Krieger, sondern kalte, organisierte Kriminelle. Im Namen der „Ehre“ und „Loyalität“ foltern, morden und zerstören sie das Leben ihrer eigenen Familien. In diesem System soll die Frau nur ein Rädchen im Getriebe sein: gehorsam, still, unterwürfig. Doch gerade in dieser Maschinerie entstehen die Risse.
Frauen wie Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola und andere beginnen, „Nein” zu sagen. Ihr Widerstand ist keine heroische Pose, sondern entspringt der schieren Verzweiflung. Sie verraten die Clans, brechen das Schweigegelübde, sie wenden sich an den Staat, wissend, dass dies einem Todesurteil gleichkommt.
In einer Welt, in der Schweigen Überleben bedeutet, wird ihre „Stimme“ zur gefährlichsten Waffe. Es ist ein Akt kreativer Zerstörung – echte Barbarei gegenüber einem kranken System.
Sie besitzen keine Armee, kein Geld und keine Macht. Sie haben nur ihr Wort, ihre Weigerung, ihren Widerstand. Ihr „Nein“ wird zu einem Akt der kreativen Zerstörung: einer Barbarei, die nicht auf Blut, sondern auf Verweigerung gründet. Und das erweist sich stärker als der gesamte Mafia-Clan. Die Tragik liegt darin, dass viele von ihnen den höchsten Preis zahlen. Doch ihr Verrat ist zugleich ein Aufbruch – ein Zeichen, dass selbst in einem System, das totale Kontrolle verlangt, der Bruch möglich ist.
Ihr Widerstand beweist, dass die größte Bedrohung für die Mafia nicht von außen kommt – nicht von Polizei oder Politik, sondern von den Stimmen jener, die man jahrelang zum Schweigen erzogen hat.
VI. Margaret Atwoods Gilead
Ein ähnliches Bild – wenn auch in literarischer Form – zeichnet Margaret Atwood in ihren Romanen Der Report der Magd und Die Zeuginnen. Gilead ist eine totalitäre Utopie, in der Frauen auf ihre Funktionen reduziert werden: Mutter, Dienerin, Objekt eines Rituals. Ohne Namen, Sprache und Freiheit sollen alle Mägde zur Verfügung stehen, um in dem Projekt der männlichen Herrschaft die Menschheit „neu“ zu definieren.
Doch der erste Widerstand entsteht nicht durch Waffen, sondern durch Verweigerung. June, Emily, Moira – zunächst eingeschüchtert – entdecken, dass die wahre Kraft in der Gemeinschaft liegt. Geflüsterte Worte, verstohlene Blicke, Solidarität werden zum Beginn einer Revolution. In diesem Sinne ist ihre Schwesternschaft eine moderne Form der Barbarei: nicht auf Dominanz gegründet, sondern auf Solidarität und der Weigerung, sich an der Lüge zu beteiligen.
Atwoods Bild macht deutlich: Barbarei ist hier nicht rohe Gewalt, sondern die kreative Kraft, sich zu entziehen, sich neu zu verbünden, sich nicht brechen zu lassen. So zeigt Gilead, dass selbst im scheinbar totalen System – in dem die Frauen auf Symbole reduziert, auf Rollen fixiert, auf Unterwerfung dressiert werden – der Aufbruch möglich bleibt. Jede Verweigerung, jedes Weitergeben von Hoffnung ist ein Angriff auf die alte Ordnung. Die Solidarität der Unterdrückten wird zur Waffe. Die „Barbarin“ in Gilead ist also jene, die nicht nur überlebt, sondern das Überleben in Widerstand verwandelt – und dadurch den Raum für eine andere Zukunft öffnet.
VII. Barbarei als Verweigerung
Die Figur des Barbaren der heutigen Zeit ist keine Figur des Kriegers mit dem Schwert. Er kommt nicht von außen, um Mauern niederzureißen und Städte zu plündern. Er ist jemand, der von innen heraus „Nein” zu einer Ordnung sagt, die ihn zerstört. Er ist eine innere Figur, ein Störenfried, der mitten in der Ordnung lebt – und dennoch „Nein“ sagt zu einer Zivilisation, die ihn verschlingt.
Die Barbarei des 21. Jahrhunderts ist eine subtile Kunst der Verweigerung: die Verweigerung des Gehorsams, die Verweigerung, nach den Drehbüchern anderer zu leben. Die Verweigerung, sich in Rollen pressen zu lassen, die nur der Stabilität des Systems dienen.
Heute brauchen wir keine weitere Utopie. Wir brauchen den Mut, nicht als Rohstoff für die Projekte anderer zu dienen. Die Barbarin ist nicht mehr der Eroberer, sondern der Verweigerer, jemand, der sagt: Heute? Nein Danke!
VIII. Persönliche Perspektive
Ich wurde Ende der 1970er Jahre im kommunistischen Polen geboren. Frauen waren überall – auf den Feldern, in Büros, manchmal auch in der Politik. In meiner Kindheit wirkten sie unersetzlich zu sein. Heldinnen des Alltags.
Nach Jahren wurde mir klar, wie sehr wir in alten Mustern verhaftet waren. Bei Demonstrationen riefen wir Parolen, aber im Alltag überschritten wir selten die Schwelle des echten Widerstands. Wir wählten immer noch das „bekannte Übel”, anstatt das Risiko einzugehen, etwas Neues aufzubauen. Wir gehorchten, anstatt zu verweigern.
Heute sehe ich, dass die größte Kraft diejenigen Frauen haben, die Schmerz erfahren haben: Verrat, Abtreibung, Armut, Gewalt. Sie sind es, die nach dem hundertsten Sturz wieder aufstehen können. Sie sind es, die keine Abhängigkeit mehr suchen, sondern sich für die Verweigerung entscheiden. Sie sind die wahren Barbarinnen – diejenigen, die sich weigern, am System teilzunehmen, das an einer kompletten Anpassung beruht.
IX. Schlussfolgerungen
Wo sind also die Barbaren des 21. Jahrhunderts? Es sind nicht mehr fremde männliche Krieger vor den Toren, sondern Frauen, die sich von innen heraus weigern, an dem alten Tändeln teilzunehmen. Sie sind es, die am Rande stehen und die Kraft haben, die Grundlagen des Systems zu zerstören. Nicht durch Gewalt, sondern durch Verweigerung, durch Solidarität, durch Gemeinschaft.
Barbarei ist heute nicht das Ende der Zivilisation, sondern die Möglichkeit eines Neuanfangs. Es ist das „Nein“, das zur Sprache der Freiheit wird. Es ist der Mut, sich nicht für das bekannte Übel zu entscheiden, sondern in die Dunkelheit einzutreten und dort – gemeinsam – etwas Neues zu schaffen.
Vielleicht liegt gerade darin die paradoxe Wahrheit unserer Zeit: Die Frauen, die jahrhundertelang an den Rand gedrängt, als „minderwertig“ behandelt, zur Unsichtbarkeit gezwungen wurden, sind heute die Einzigen, die den Mut haben, „Barbarinnen“ zu sein.
Das Artikelbild trägt den Titel Barbarin des 21. Jahrhunderts und wurde von der Autorin selbst gemalt (Gemälde, Acryl/Öl). Sie schreibt selbst dazu: „Die Barbarin des 21. Jahrhunderts bittet nicht um Erlaubnis und rechtfertigt sich nicht. Geboren aus Zivilisationsmüdigkeit, trägt sie einen Bruch in sich – zwischen dem Menschlichen und dem, was sich der Zivilisation entzieht. Ihr Gesicht ist eine Landkarte moderner Emotionen: Wut, Ironie, Zärtlichkeit und Schmerz verschmelzen zu einer Maske, die offenbart, statt zu verbergen. Sie blickt nicht in die Vergangenheit, sondern durch uns hindurch, zerstört Illusionen der Harmonie und zeigt, dass Schönheit aus Mut und nicht aus Ordnung entsteht. Die Figur ist kein Porträt, sondern ein Spiegel.“
Olimpia Smolenska wurde 1976 in Zielona Góra, Polen, geboren. Mit siebzehn Jahren ging sie nach Neuzelle in Brandenburg, um dort ihr Abitur an einem deutsch-polnischen Gymnasium zu absolvieren. Ihr Diplom in Kulturwissenschaften schloss sie 2010 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) mit einer Arbeit zum Thema Integration über die Sprache – unter Berücksichtigung des Zweitspracherwerbs polnischer Gymnasiasten im brandenburgischen Neuzelle ab. Derzeit arbeitet sie an der Goethe-Universität im Geschäftszimmer des Instituts für Philosophie.
Literatur
Atwood, Margaret: Der Report der Magd. Übers. v. Helga Pfetsch. München 1987.
Dies.: Die Zeuginnen. Übers. v. Monika Baark. Berlin 2019.
Perry, Alex: The Good Mothers. The Story of the Three Women Who Took on the World’s Most Powerful Mafia. New York 2018.
Barbarinnen – wenn Frauen zur Gefahr werden
In der heutigen Welt, die sich modern und gleichberechtigt nennen will, wirken alte Muster fort – Rivalität statt Solidarität, Anpassung statt Aufbruch. Der Essay fragt provokant: Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts? Er zeigt das Entstehen einer neuen weiblichen Kraft – einer Frau, die nicht zerstört, sondern verweigert, die sich alten Rollen entzieht und aus Schmerz schöpferische Kraft gewinnt. Durch Beispiele aus der Realität und der Literatur versucht der Text zu zeigen, dass wahre Veränderung nicht in Gehorsam, sondern im mutigen „Nein“ beginnt – und dass Solidarität unter den Frauen die eigentliche Revolution sein könnte.
Wir prämierten den Text mit dem zweiten Platz des diesjährigen Eisvogel-Preises für radikale Essayistik (Link).
Wer ihn lieber anhören möchte, findet ihn zusätzlich eingelesen von Caroline Will auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie (Link) oder auf Soundcloud (Link).
Der Sinn ist gefallen, doch ich träume noch
Der Sinn ist gefallen, doch ich träume noch


Dieser Essay widersetzt sich der Leere einer Welt, die zu Gunsten der Funktion ihren Sinn verloren hat. Mit Nietzsche, Camus und dem Schatten des Sisyphos im Rücken, suche ich nach dem Wilden, nach dem Träumerischen, nach jenen, die sich nicht fügen und sich weigern, zu verstummen. Ich schreibe über die modernen Barbaren: Über Menschen, die das Nichts sehen und dennoch weiteratmen, weiterschreien, weiterträumen. Dieser Text ist meine Hymne an den Trotz, an das Ungeformte, an den Mut, die Sinnlosigkeit nicht zu fürchten. Denn selbst ohne Sinn werde ich nicht verstummen. Nicht jetzt, nicht in dieser Welt. Und eine andere gibt es nicht.
Der Essay entstand als Antwort auf die Preisfrage des diesjährigen Eisvogel-Preises (Link). Wir zeichneten ihn nicht aus, doch publizieren ihn dennoch als wichtigen Beitrag zum Thema der «neuen Barbaren» aufgrund seiner ausserordentlichen literarischen Qualität. Wer ihn lieber anhören möchte, findet ihn zusätzlich eingelesen von Caroline Will auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie (Link) oder auf Soundcloud (Link).
Die verlorene Welt und die Suche nach den neuen Barbaren
«Wo sind die Barbaren?», fragte Friedrich Nietzsche. Meine Stimme hallt der seinen nach wie ein Echo. Ja, wo sind sie denn, die anderen Barbaren? Denn ich bin einer von ihnen und stehe hier. Nicht mit einem Schwert, nicht mit Feuer, sondern mit einem Traum in der Hand, einem Traum, der so vergänglich wirkt wie die Wolken am Horizont. Doch ich kann und werde ihn nicht loslassen. Ich werde mich ihnen nicht fügen. Die Welt hat sich eingerichtet: Ihre Werte sind glatt und ihre Gedanken steril. Dennoch bin ich hier und rufe, doch niemand hört mich, und sehen wollen sie auch nicht. Alles hat einen Platz in dieser traurigen Welt, ausser das Wilde und das Ungeformte.
Nihilismus und die Geburt der Träumer
Der Nihilismus, von dem Nietzsche sprach, war nicht bloss eine Warnung, nein, es war der Untergang der Welt selbst. Die Werte sind wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Schuld daran ist nicht die Evolution, nicht der Lauf der Zeit, sondern der Mensch selbst. Denn wir sind müde geworden und haben unseren Kampfgeist verloren. Daraus entstand eine Welt, die sich mit dem Schein von etwas Fundamentalem zufriedengibt. Technik ersetzt die Neugierde, Fortschritt ersetzt den Willen und alles hat eine Funktion, doch nichts hat einen Sinn. Und irgendwo inmitten dieser funktionalen Wüste stehen wir, die Träumer. Wir werden als unbrauchbar abgestempelt, denn wir fühlen zu viel, wir brechen zu leicht und wir wollen die Uniform nicht anziehen. Vielleicht sind wir die neuen Barbaren. Nicht, weil wir zerstören, sondern, weil wir nicht gehorchen, und das scheint den grössten Schaden überhaupt anzurichten.
Die lautlose Invasion der Leere
Die Leere kam also nicht mit einer Fanfare. Sie kündigte sich nicht an mit einem: «So, hier bin ich.» Nein, sie war plötzlich da, still und selbstverständlich, und wir haben es nicht einmal gemerkt. Jetzt ist es zu spät. Die Leere ist längst unter uns verteilt; sie sitzt in unseren Körpern, sie ist in unsere DNA geschrieben. Wir leben in einer funktionalen Welt, in der alles möglichst simpel sein muss, denn jeder Gegenstand, ja, selbst jedes Lebewesen erfüllt eine bestimmte Funktion. Wir sind geprägt vom Gedanken, dass wir die Welt optimieren müssen, dass das menschliche Leben praktischer werden soll, dass alles schneller und immer schneller funktioniert. Doch mir wird übel auf dieser Achterbahn.
Sisyphos, unser alter Freund
Funktion wird als Sinn missbraucht, weil wir den Gedanken nicht ertragen, dass unsere Existenz vielleicht gar keinen Sinn hat. Ich denke an den Mythos des Sisyphos. An jenen Mann, der von den Göttern dazu verdammt wurde, einen Stein den Berg hinaufzurollen, nur um ihn immer wieder hinunterstürzen zu sehen, für alle Ewigkeit. Sisyphos’ Aufgabe war sinnlos und damit auch funktionslos. Was bringt sie ihm schlussendlich? Genau: Nichts. Und doch er tat es, aus Trotz gegenüber den Göttern. Er wollte ihnen die Genugtuung seiner Niederlage nicht gönnen, also machte er weiter, auch ohne Ziel und ohne Ertrag. Ich denke auch an Albert Camus, der diesen Mythos als Ebenbild der menschlichen Existenz betrachtete: Das Leben ist sinnlos, und doch leben wir weiter, einfach so, weil wir es können. Wir tanzen auf dem Grab der Sinnhaftigkeit, nicht weil wir glauben, sondern weil es uns Freude macht. Die heutige technische Welt tut so, als kenne sie weder Camus noch Sisyphos, und wer weiss, vielleicht kennt sie die beiden wirklich nicht. Sie ist zu verbissen darin, Fortschritt zu machen. Zu verbissen darin die grösste Erfindung des Jahrhunderts zu vollbringen. Und wofür? Genau, für einen angeblichen Sinn. Doch diesen Sinn gibt es nicht, und etwas anderes zu behaupten wäre eine Lüge.
Technik als Religion des Fortschritts
Nietzsche warnte einst vor einem Nihilismus, der den Willen des Menschen zerstören würde. Doch seine Angst war nur ein Bruchteil von dem, was wirklich eingetreten ist: Die Menschen sind nicht nur müde geworden, sie leben eine Lüge. Technik, und das Streben nach dem Sinn, den sie verspricht, ist der neue Gott.
Widerstand der modernen Barbaren
In dieser Welt, die alles braucht, Zahlen, Tempo, Ziele, und nicht weiss wozu, gibt es Körper, die zu weich sind, Seelen, die zu langsam träumen und Ziele, die nichts weiter sind als Bilder über den Wolken. Vielleicht sind sie es, die Widerstandsfreudigen, die den Nihilismus stürzen wollen, auch wenn er längst eingetreten ist. Sie erkennen den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe, doch sind sie bereit, mit ihren Ideen das Menschliche, das Wilde und das Träumerische zurückzuholen. Ich nenne sie die modernen Barbaren.
Randfiguren des Systems
Die modernen Barbaren werden ausgestossen. Denn die technische Welt, längst vom Nihilismus wie eine Seuche befallen, ist bequem geworden, und niemand will sie hergeben. Die Barbaren stören. Sie erinnern. Sie hinterfragen. Also drängt man sie an den Rand, denn sie sind in der Unterzahl. Man nennt sie «verrückt», «gestört», «krank im Kopf». Und erneut findet eine Umkehrung der Werte statt, eine, wie sie Nietzsche einst voraussah, unfreiwillig Prophet. Die Barbaren sind das Abbild des Übermenschen: Jene, die verstanden haben, worum es geht, was wirklich zählt, und die keine Angst haben vor der Sinnlosigkeit. Der Rest aber? Die sind Sklaven. Sklaven, die sich blind von einem Pseudo-Sinn treiben lassen. Eigentlich sind sie schwach, doch Technik macht sie stark. Die Technik, diese Pseudo-Funktionalität, wirkt wie Waffen in einem Videospiel, und die Sklaven sind nichts als Charaktere. Avatare mit Namensschild. Nur dort in ihrer Scheinwelt sind sie stark. Nur dort, gemeinsam, als Allianz der Armen. Sie selbst würden sich nie arm nennen, nein, denn in ihrer Welt ist alles bedeutungsvoll: Sie glauben, sie existieren wegen des Urknalls, weil der Zufall es so wollte. Sie gehen morgens zur Arbeit, weil sie «einen Unterschied machen» wollen. Sie kaufen Stocks, denn Reichtum ist das Ziel. Doch die Wahrheit, die sie nicht hören können, oder nicht hören wollen, ist diese: Das alles ist eine grosse Lüge. Einen Sinn hat es nie gegeben. Aber wer würde schon den Barbaren glauben? Die passen ja nicht ins System. Die stören nur. Die sind doch sowieso krank im Kopf. Und im Rennen um die Funktionalität ist für sie kein Platz vorgesehen.
Nützlichkeit als Zwang
Wer morgens nicht aufstehen will, ist depressiv. Wer keinen Ehrgeiz zeigt, gilt als behandlungsbedürftig. Wer zu leise oder zu sensibel ist, der ist falsch und passt nicht rein. Niemals wird die Welt hinterfragt, sondern immer nur der Mensch, der an ihr zerbricht. Doch es heisst nicht «Warum bricht er?», sondern: «Deshalb sollte er nicht brechen.» Und schon sitzt der Barbar mit einer Diagnose in einem zu hellen Raum und wundert sich, warum seine Augen brennen.
Denn alles, was den Fortschritt der Technologie stoppen könnte, alles, was eine Gefahr für die robotisierten Menschen darstellen könnte, wird eingesperrt. Nicht Heilung ist das Ziel, nicht das Wiederherstellen eines Wohlbefindens, sondern eine Notlösung: Die Barbaren sollen funktionsfähig werden. Nutzbar und anpassbar. Daraus entsteht eine Zwangsnorm, in der Individualität und Menschlichkeit keinen Platz mehr haben. Am Ende zählt also nicht, ob es einem Menschen besser geht, sondern nur, dass es weitergeht.
Simulation, Scheinwelt und der Hunger nach Echtheit
Die Welt ist schon lange nicht mehr echt, sie ist effizient. Und das reicht den meisten. Doch nicht den Barbaren. Sie sehen, dass der Mensch den Sinn verloren hat, und trotzdem suchen die Barbaren weiter danach. Alles, was man ihnen dafür anbietet, sind Klicks und Geräte. Die ganzen Avatare merken längst nicht mehr, dass sie in einer Simulation leben, denn es ist bequem und es gibt Belohnungen, wenn sie mitmachen. Genau wie Gott einst das Paradies versprach. Die Barbaren sehen, dass die Welt brennt und dass sie dringend Hilfe benötigen. Doch sind ihnen die Hände gebunden und als Trost wird ihnen Bluetooth angeboten. Es ist alles fort.
Die letzte Rebellion
«Es ist alles fort», flüstere ich vor mich hin und betrachte die Gestalt im Spiegel. Sie ähnelt mir sehr, doch ihre Augen sind müde und ihre Seele wirkt leer. Auch ich werde langsam müde, denn Barbarin sein, ist anstrengend. Es gibt Tage, da möchte ich einfach dazugehören. Da will ich morgens aufstehen und in das System passen. Ich sehe die Uniform, die über meinem Stuhl hängt, und stelle mir vor, wie es wäre, zu lächeln, wenn sie es erwarten. Ich wünschte, meine Gedanken wären einfacher, doch ich kann sie nicht ausschalten und ich will es auch nicht, denn ich glaube noch an das Wilde. Ich glaube an die Traumwolken, die ich selbst erschaffen habe, mit meinen eigenen Werten, mit meinem eigenen Sinn. Nicht, weil ich die Sinnlosigkeit nicht aushalte, sondern, weil ich die Kraft habe, etwas zu schaffen, genau wie Sisyphos. «Wo sind die Barbaren?», fragte Friedrich Nietzsche. Meine Antwort hört er längst nicht mehr, doch spreche ich sie aus: «Ich bin hier.» Meine Beine sind noch nicht so müde, dass sie mich nicht mehr tragen würden, und in meinen Armen trage ich noch genug Kraft, um meine Träume zu halten. Ich habe der Welt nichts zu bieten, nicht wirklich; aber ich gebe nicht auf. Und vielleicht ist das meine letzte Form von Rebellion: Nicht still zu werden. Denn selbst, wenn ich verliere, ich bin eine Barbarin. Und das schreibe ich mit Stolz.
Giulia Romina Itin wurde 2007 in der Nähe von Luzern geboren und studiert derzeit Philosophie und Geschichte an der Universität Basel. In ihren Texten setzt sie sich mit existenziellen und gesellschaftskritischen Fragen auseinander: Sinn und Sinnlosigkeit, Auflehnung, Identität, das Träumerische und der Widerstand gegen das Vorgeformte. Ihr Denken wird vor allem von Friedrich Nietzsche und Albert Camus geprägt, deren Perspektiven auf Freiheit, Revolte und Absurdität ihren Blick für die Brüche der Gegenwart schärfen. Neben dem Studium schreibt Giulia Lyrik und Prosa, um in einer sinnleeren Welt nicht innerlich zu verstummen. Schreiben bedeutet für sie, weiterzufragen, wo andere schweigen.
Das Artikelbild stammt von der Autorin. Sie schreibt dazu: «Ich habe es im Januar 2025 selber fotografiert, irgendwo zwischen Madeira und Teneriffa auf offenem Meer. Ich habe dieses Bild gewählt, weil es dieselbe Stimmung trägt wie mein Text: Schwere Wolken, Lichtbrüche und ein Himmel, der zugleich droht und träumt. Diese Wolken erinnern mich an die ‘Traumwolken’, von denen ich im Text spreche. Jene, die ich mir selbst erschaffen habe, trotz einer Welt, die Sinn verloren hat. Das Foto zeigt eine Wirklichkeit, die dunkel, aber nicht hoffnungslos ist, und genau aus dieser Motivation heraus existiert mein Text.»
Der Sinn ist gefallen, doch ich träume noch
Dieser Essay widersetzt sich der Leere einer Welt, die zu Gunsten der Funktion ihren Sinn verloren hat. Mit Nietzsche, Camus und dem Schatten des Sisyphos im Rücken, suche ich nach dem Wilden, nach dem Träumerischen, nach jenen, die sich nicht fügen und sich weigern, zu verstummen. Ich schreibe über die modernen Barbaren: Über Menschen, die das Nichts sehen und dennoch weiteratmen, weiterschreien, weiterträumen. Dieser Text ist meine Hymne an den Trotz, an das Ungeformte, an den Mut, die Sinnlosigkeit nicht zu fürchten. Denn selbst ohne Sinn werde ich nicht verstummen. Nicht jetzt, nicht in dieser Welt. Und eine andere gibt es nicht.
Der Essay entstand als Antwort auf die Preisfrage des diesjährigen Eisvogel-Preises (Link). Wir zeichneten ihn nicht aus, doch publizieren ihn dennoch als wichtigen Beitrag zum Thema der «neuen Barbaren» aufgrund seiner ausserordentlichen literarischen Qualität. Wer ihn lieber anhören möchte, findet ihn zusätzlich eingelesen von Caroline Will auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie (Link) oder auf Soundcloud (Link).
„Friede mit dem Islam“?
Wanderungen mit Nietzsche durch Glasgows muslimischen Süden: Teil 2
„Friede mit dem Islam“?
Wanderungen mit Nietzsche durch Glasgows muslimischen Süden: Teil 2
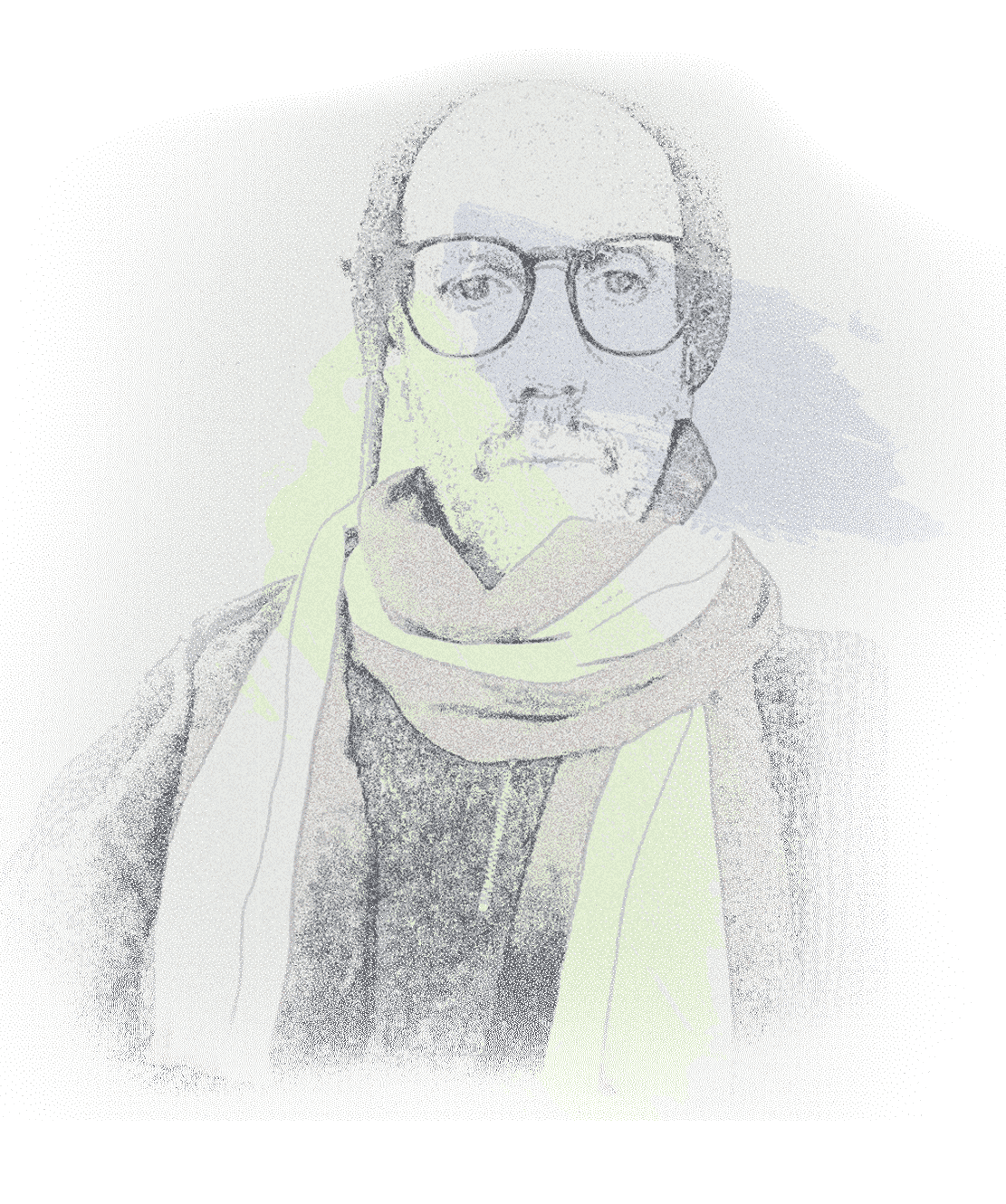

Im zweiten Teil seines Artikels über seine Reise durch den muslimisch geprägten Süden Glasgows geht unser Stammautor Henry Holland vertieft auf Nietzsches immer wieder aufflammende Beschäftigung mit der Religion Mohammeds ein, erläutert näher, wie der französische Künstler und Theoretiker Pierre Klossowski in seinem experimentellen Roman Der Baphomet Nietzscheanismus, sexuelle Transgression und vom Islam inspirierte Mystik in eigensinniger Weise verband und kehrt dann noch einmal zurück in die schottische Großstadt, um seinen Reisebericht abzurunden.
Aus dem Englischen übersetzt von Lukas Meisner und Paul Stephan.
I. Nietzsches historischer Islam?
Unser berühmter philosophierender Wanderer war in Bezug auf die in Teil Eins vorgebrachten historischen Fakten weitgehend unwissend, allerdings eher auf kreative als auf wirklich geniale Weise: Die neue Religion verbreitete sich in den ersten Jahrhunderten, die auf die Offenbarung an Mohammed folgten, mehr durch rhetorische als durch gewaltsame Bekehrung. Jedoch las Nietzsche Julius Wellhausen, Historiker der antiken Religionen und Verfasser der vielleicht umfassendsten Geschichte des frühen Islam, die zu dieser Zeit auf Deutsch verfügbar war. Neben der 1887 veröffentlichten Darstellung der vorislamischen Kultur in der arabischen Welt, in der der Autor den Islam „als Abschluss der religiösen Entwicklung des arabischen Heidentums” beschreibt, verschlang Nietzsche auch Wellhausens einzigartige und für Aufsehen sorgende Darstellungen des antiken Judentums, bevor er 1888 Der Antichrist verfasste.1 Wellhausens Werke waren nur einige von vielen „orientalistischen“ und islambezogenen Texten, die ab den 1860er Jahren auf Deutsch oder in deutscher Übersetzung erschienen und die Nietzsche mit Passion las. Dazu gehörten Gifford Palgraves Journeys Through Arabia und mehrere Werke des damaligen Star-Orientalisten Max Müller. Nietzsche hatte 1870/71 Max Müllers Essays über östliche Religionen gelesen und exzerpiert, in denen er die Bestätigung fand, dass zumindest ein „Teil des buddhistischen Kanons“ als „nihilistisch“ anzusehen sei.2 Vieles deutet darauf hin, dass Müllers Schriften zur indischen Philosophie den Ausgangspunkt für Nietzsches spätere Faszination für das bildeten, was er als „Gesetzbuch des Manu“ bezeichnet und was Indologen als Manusmṛiti nennen – einen metrischen Sanskrit-Text, der zwischen 200 v. u. Z. und 200 n. u. Z. verfasst wurde.3 Nietzsches Leitfaden zum Gesetzbuch des Manu war, was der moderne Gelehrte Andreas Sommer in religionswissenschaftlicher Hinsicht als eine „höchst zweifelhafte Quelle“ bezeichnet, nämlich Louis Jacolliots 1876 erschienenes Buch Les législateurs religieux. Manou. Moïse. Mahomet.4 Inspiriert von Jacolliots polemischer Gegenüberstellung von Manu und dem koranischen Propheten versuchte Nietzsche, Manu und den Islam in einem dichten Fragment aus dem Frühjahr 1888 miteinander zu verbinden, das sorgfältig auf der Seite angeordnet, aber erst posthum veröffentlicht wurde und eine Metaphilosophie der „arischen” und „semitischen” Religion unternimmt:
Wie eine Jasagende arische Religion, die Ausgeburt der herrschenden Classen, aussieht:
das Gesetzbuch Manu’s.
Wie eine Jasagende semitische Religion, die Ausgeburt der herrschenden Classen, aussieht:
das Gesetzbuch Muhammeds. Das alte Testament, in den älteren Theilen
Wie eine Nein-sagende semitische Religion, als Ausgeburt der unterdrückten Klassen, aussieht:
nach indisch-arischen Begriffen: das neue Testament – eine Tschandala-Religion
Wie eine Neinsagende arische Religion aussieht, gewachsen unter den herrschenden Ständen
: der Buddhismus.5
Seltsamer-, ja: wundersamerweise greifen einige progressive Muslime nun Nietzsches Konzeption des Islams auf, der als eine Religion von einer außergewöhnlichen (spät„heidnischen“, arabischen, in Medina ansässigen) herrschenden Klasse geschaffen worden sei, die einen übermenschlichen Mut bewiesen habe. Sie betrachten diese Sichtweise als eine pluralistische Bastion gegen eine vereinheitlichende Wiedererweckungstendenz unter ihren Glaubensgenossen. Letztere sagen einfach: „Nein – der Islam war und ist und kann niemals so sein“, und beenden damit die Diskussion darüber, wie er dennoch als lebensbejahende, moderne Religion dienen könnte. Nietzsche integriert seine Skizze, in der er Manus und Mohammeds „Gesetzbücher“ miteinander verbindet, in seine bekannteste Positionierung zum Islam im 60. Abschnitt des Antichrist. Das Buch war im November 1888 druckfertig; aufgrund des schweren Zusammenbruchs und der dauerhaften Krise von Nietzsches psychischer Gesundheit seit Januar 1889 erschien es derweil erst 1894, herausgegeben von seiner Schwester in überarbeiteter Form. Erst seit dem Erscheinen der maßgeblichen Ausgabe von Colli und Montinari in den 1960er Jahren können wir nun sicher sein, was Nietzsche über den jüngsten großen Monotheismus sagen wollte. Es klingt wie eine Tirade eines brillanten Redners in der Speakers‘ Corner des Hyde Park, wenn Nietzsche das Christentum mit einer Flut schwerer, beleidigender Vorwürfe belegt und den Islam dafür lobt, wie dieser sich in der „maurischen” Kultur manifestiert habe:
Das Christenthum hat uns um die Ernte der antiken Cultur gebracht, es hat uns später wieder um die Ernte der Islam-Cultur gebracht. Die wunderbare maurische Cultur-Welt Spaniens, uns im Grunde verwandter, zu Sinn und Geschmack redender als Rom und Griechenland, wurde niedergetreten – ich sage nicht von was für Füssen – warum? weil sie vornehmen, weil sie Männer-Instinkten ihre Entstehung verdankte, weil sie zum Leben Ja sagte auch noch mit den seltnen und raffinirten Kostbarkeiten des maurischen Lebens!
Unser Redner verurteilt die Kreuzzüge, die diese Lebenswelt vernichtet haben, sowie den deutschen Adel für seine Beteiligung an den Plünderungen der Kreuzritter. Er nennt Ursachen für diese kulturelle Verdorbenheit und fordert den Leser auf, in diesem Kampf der Kulturen Partei zu ergreifen:
Christenthum, Alkohol – die beiden grossen Mittel der Corruption… An sich sollte es ja keine Wahl geben, Angesichts von Islam und Christenthum, so wenig als Angesichts eines Arabers und eines Juden.6 Die Entscheidung ist gegeben, es steht Niemandem frei, hier noch zu wählen. Entweder ist man ein Tschandala oder man ist es nicht… „Krieg mit Rom auf’s Messer! Friede, Freundschaft mit dem Islam“: so empfand, so that jener grosse Freigeist, das Genie unter den deutschen Kaisern, Friedrich der Zweite.7
Die Einteilung aller historischen Akteure in „Tschandala“ oder „die Vornehmen“ ist ein Kurzschluss, der dem Jahr 1888 spezifisch angehört. Er übernimmt den erstgenannten Begriff aus dem Hinduismus, wo er ein Mitglied der niedrigsten Kaste (und insbesondere diejenigen, die Leichen beseitigen) bezeichnet, und interpretiert ihn als Begriff für „das niedere Volk, die Ausgestossnen und ‚Sünder‘“.8 Indem Nietzsche darauf besteht, dass diejenigen, die an den Anfängen des Islams beteiligt waren und dessen Aufblühen ermöglichten, keine Tschandala sind, trennt er den Islam kategorisch vom späten, dekadenten Christentum ab. Diese Parteinahme wird von Roy Jackson aufgegriffen, dem Autor der offenbar einzigen umfassenden Studie zu diesem Thema in den letzten Jahren, der behauptet, dass „der Islam viel aus Nietzsches Kritik am ‚toten Gott‘ des Christentums lernen kann“.9 Indem Jackson argumentiert, dass Nietzsche nicht das religiöse Leben als solches ablehnt, sondern lediglich lebensverneinende Formen des religiösen Impulses, kann er die „zwei grundlegendsten Optionen“ darlegen, vor denen der Islam stehe: entweder
denselben Weg wie das Christentum in Europa zu gehen und seinen Gott zu dem „toten Gott“ zu machen, den Nietzsche so kritisiert, oder aus Nietzsches Religiosität zu lernen und einen „lebendigen Gott“ anzunehmen, der die Säkularisierung nicht als Feind betrachtet.10
Jacksons intellektuelle Manöver sind kaum wasserdicht. Wie Peter Groff uns erinnert, sind Nietzsches Denkweisen und -mittel zwar so radikal, dass sie über den Atheismus hinausgehen, doch bedeutet dieses Hinausgehen keine Rückkehr zum Theismus.11 Entscheidend ist hier jedoch nicht, ob alle Grundlagen von Jacksons Argumentation überzeugen – das tun sie nicht; und Nietzsches eigenes Bild einer „ja-sagenden“ Religion passt schlecht zur Religiosität in den Straßen von Pollockshields heute –, sondern entscheidend sind vielmehr die politischen und kulturellen Kämpfe innerhalb des Islams, die Jackson überhaupt erst dazu motivieren, sich Nietzsche zuzuwenden. Es handelt sich um Kämpfe um den richtigen Weg, den „Schlüsselparadigmen“ der Religion wieder zu begegnen: dem Koran, dem Propheten Mohammed, dem Stadtstaat Medina und den vier rechtgeleiteten Kalifen [632–661 u. Z.].12 Für Jackson und sein Lager muss diese Wiederbegegnung „kritisch-historisch“ sein, damit Gläubige ehrlich ergründen können, was der Islam gewesen ist und in der halb-säkularen Moderne werden könnte. Groff und Jackson stellen diesen Ansatz der Haltung jüngerer Vertreter der Strömung des „Islamischen Erwachens“ wie Mawlana Mawdudi (1903–1979) gegenüber, die sich, von einer transhistorischen Denkart ausgehend, weigern, sich erneut mit denselben Paradigmen auseinanderzusetzen, und stattdessen darauf beharren, dass diese Paradigmen über jede Kritik erhaben, „ursprünglich und allumfassend“ seien.13
Vor allem wendet sich Jackson an den Nietzsche von Jenseits von Gut und Böse, nicht um den philosophischen Diskurs von „der Seele” selbst zu befreien, sondern um sie als „sterblich“, „als Subjekts-Vielheit“, „als Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte“ neu zu definieren.14 Dies ermöglicht es Jackson, Vielfalt zuzulassen und einseitige Darstellungen abzulehnen, wenn er die Seelen untersucht, die das religiöse Leben und die Gesellschaft der „Schlüsselparadigmen”-Periode aufgebaut haben. Bald gelangen wir an einen Ort, der sich völlig von den geistigen Landkarten unterscheidet, die die meisten Nicht-Muslime davon haben: Der erste islamische Stadtstaat war nach Jacksons Lesart „zutiefst pluralistisch“, erkannte an, dass „das Weltliche und das Religiöse“ getrennte Bereiche sein sollten, und wurde vom Propheten beseelt, der weniger als „religiös-politischer Herrscher (wie von den zeitgenössischen Verfechtern eines ‚Islamischen Erwachens‘ angenommen) fungierte, sondern eher als ‚charismatischer Schiedsrichter in Streitigkeiten““.15

II. Seelen und „Moslem-Sein“ in Pierre Klossowskis Wahnsinnskunst
Timothy Winters islamischer Zugang zu Nietzsche baut auf Pierre Klossowskis Interpretation des Philosophen auf und folgt dem Pfad verschlüsselter und doch entzifferbarer Spuren eines „Moslem-Seins“ [muslimness], den der französische Künstler hinterließ. Sie verdichten sich maximal in dem Roman Der Baphomet aus dem Jahr 1965. Dieser gewann zwar den prestigeträchtigen Literaturpreis Prix des Critiques, doch brachte seit seinem Erscheinen nichtsdestotrotz zahlreiche Leser und andere Kritiker gegen sich auf. Das Buch ist in der Tat so seltsam, dass es, wenn man es mit aller Kraft gegen eine Wand schmetterte, seine Faszinationskraft dennoch nicht einbüßte, sondern einen dazu brächte, die herumflatternden Seiten aufzusammeln und mit dem Lesen von vorne zu beginnen. Nicht von ungefähr entschied sich Klossowski, den Roman innerhalb einer historischen Gemeinschaft spielen zu lassen, die sowohl reaktionäre Katholiken als auch einflussreiche Verschwörungstheoretiker durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder der Islamophilie oder sogar des Krypto-Islams bezichtigt haben: innerhalb der Gemeinschaft der Tempel-Ritter.16 Der Autor wirft den Lesern immer wieder entsprechende Hinweise vor die Füße und sieht zu, wie sie reagieren werden. Und Klossowski hat uns noch einen weiteren Köder ausgelegt: In dem Roman taucht auch Nietzsche selbst als Figur auf und wird bewusst mit dem islamophilen Kaiser Friedrich II. verschmolzen. Der Vorzug dieses Buches und Winters experimenteller hermeneutischer Aneignung desselben ist es, dass sie, wenn man sich auf sie einlässt, einige der allgegenwärtigen rationalistischen Vorurteile gegenüber dem Islam ins Wanken bringen. Klossowskis Ästhetik setzt das in Werk, was der Islamwissenschaftler Thomas Bauer als einen der „Grundpfeiler des sunnitischen Islam“ bezeichnet, nämlich „den Prozess der Ambiguisierung“.17
Durch den Prolog hindurch hält Klossowski gerade noch eine gewisse erzählerische Spannung aufrecht. Er spielt im Jahr 1307 in einer Niederlassung des Templer-Ordens, kurz bevor man ihn auf Veranlassung des französischen Königs Philipp IV. der Ketzerei beschuldigte und gewaltsam auflöste. Die Handlung ist weit hergeholt, aber wenigstens gibt es eine. Valentine von Saint-Vit, Dame von Palençay, hat ein Auge auf eine einträgliche Länderei geworfen, die ihr Großonkel einst dem Orden vermacht hatte und die dieser nun aus ihrer Sicht widerrechtlich okkupiert. Sie hat von Philipps Plan Wind gekriegt und schickt nun ihren wunderschönen vierzehn Jahre alten Neffen, Ogier von Beauséant, zu den Brüdern der Komturei. Sie hofft, dass sie seinen sexuellen Reizen erliegen werden, um sich so einen Beweis ihrer „Ketzerei“ zu verschaffen, den sie benötigt, um die „Krieger-Mönche“ zu diskreditieren und dadurch ihr Land zurückzuerlangen. Die Sex-, Panzerhemd- und Flagellations-„Spiele“, die folgen, sind nicht gerade lustig für den brutal misshandelten Ogier, dessen Binnenperspektive uns verschlossen ist. Unsere Perspektive auf die Handlung ist diejenige der sich im Recht fühlenden päderastischen Männer. Die Erzählung kulminiert in einem an Ogier verübten Ritualmord. Er wird nackt ausgezogen und erhängt. Die kostümierten Ritter lassen ihn an einem Seil über ihnen schwebend zurück „im Leeren“. Man wird an diesem Punkt das Gefühl nicht los, Zeuge von etwas geworden zu sein, was man besser nicht hätte sehen sollen. Es ist, als läse man den gutgeschriebenen Bericht über einen Snuff-Film18 auf handwerklich hohem Niveau.

Was Klossowskis Meinung nach eine solche Darlegung rechtfertigt, ergibt sich erst nach und nach aus der Unterhaltung zwischen den „Hauchen“, oder auch, christlich gesprochen, „entleibten Seelen“, die im Hauptteil des Romans miteinander debattieren. Diese Hauche wurden, im Augenblick des Todes, „von den Leibern, die sie im Leben enthalten hatten, ausgeatmet“ – im Fall des Romans von Ogier und vielen anderen mit dem Templer-Orden verbundenen Leibern – und schwirren nun ziellos umher, bis sie von neuen Leibern „eingeatmet“ werden; wenn auch nicht notwendigerweise als neue Seelen, denn manchmal ziehen mehrere in einen einzelnen Menschen ein. Oder sie verbleiben bewacht in diesem Zustand für unzählige Jahrhunderte, bis zum „Jüngsten Gericht und der Wiederauferstehung des Fleisches“, die ihnen dieser Theologie zufolge erlauben werden, sich wieder mit ihren ursprünglichen Leibern zu vereinigen.19
An diesem Punkt haben wir die historische Zeit verlassen, ja sogar die gewöhnliche Kausalität, und befinden uns in demjenigen, was Winter, Louis Massignon (1883-1962 u. Z.) zitierend, als „islamische Zeit […], eine Milchstraße, die aus Augenblicken besteht“, bezeichnet.20 Man könnte diese Dimension, in die Klossowski das Herz des Romans verlegt, auch als „suprahistorisch“ statt transhistorisch bezeichnen: Sie verleugnet nicht die lineare historische Zeit und was in ihr stattfindet, doch ist dieser Form der Offenbarung auch nicht untergeordnet. Indem sich Klossowski für diesen kosmischen Zeitrahmen entscheidet, antwortet er in literarischer Form auf Nietzsches Herangehensweise an eine Philosophie der Seelen. In einem Brief an Jean Decottignies, der der englischen Ausgabe von Der Baphomet als Anhang hinzugefügt wurde, artikuliert Klossowski, was dieses Buch umsetzen soll. Wie immer spricht er in Rätseln und so wie jemand, der meint, der Welt wichtige Dinge mitteilen zu haben, sich aber weigert, sie auch zu sagen. Doch immerhin deutet er seine theologischen Hintergrundannahmen hier wenigstens an:
Der Baphomet (Gotteserkenntnis [gnosis] oder Fabel oder orientalische Erzählung) sollte auf keinen Fall als Demonstration einer tieferen Wahrheit missverstanden werden in der Art von Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkunft. Und auch nicht als Fiktion, die um diese persönliche Erfahrung Nietzsches herum erbaut wurde. Nichtsdestotrotz erweckt mein Buch den Anschein, die theologischen Konsequenzen dieser Lehre (etwa die Reise einer Seele durch unterschiedliche Identitäten hindurch) zu erwägen, insofern diese mit der Seelenwanderungslehre des Carpocrates [Gründer einer gnostischen Sekte, frühes 2. Jh. u. Z.] koinzidieren.21
Das Establishment der Nietzsche-Forschung kann heutzutage mit solchen Verbindungen zwischen der ewigen Wiederkunft und Seelenwanderung bzw. – wie man mittlerweile eher sagen würde, wenn man überhaupt davon spräche – Wiedergeburt, nicht viel anfangen. Man muss aber nicht an die Wiedergeburt glauben, um die Überdeterminiertheit in Frage zu stellen, mit der sich die Philosophie der Seelen immer wieder obsessiv mit der Fragen nach der Sterblichkeit und vor allem mit den Augenblicken des Todes beschäftigt. Auf islamische Weise betrachtet, sind das nichts anderes als flüchtige Funken in einer supernovischen Unendlichkeit von Momenten. Wenn es stimmt, dass, wie Nietzsche sagt, die Seele die Multiplizität des Subjekts ist, das heißt, wenn das Subjekt stets eine Vielheit und niemals eine Einheit ist, warum sollte dann die Vorstellung, dass eine einzelne Seele in einem einzelnen Leib wohnt, rational intelligibler sein als diejenige, dass mehrere Seelen einen Leib bewohnen? Nietzsche argumentiert im 109. Aphorismus der Morgenröthe, dass niemand von uns einen unparteiischen „Intellect“ oder eine souveräne Seele besitze, der über die Konflikte zwischen unseren Trieben, die wir erleben, regieren könnte. Dieser Intellekt sei im Gegenteil nichts mehr als „das blinde Werkzeug eines anderen Triebes, welcher ein Rival dessen ist, der uns durch seine Heftigkeit quält“22. Wenn dem so ist, warum sollten wir dann das Phantasma einer vereinigten Seele, dem wir begegnet wären, wenn wir mit Nietzsche bei einem Teller Kuttelsuppe in den 1880er Jahren diese Fragen erörtert hätten, höher werten als die Vielheit seiner Ideen – lyrisch gesprochen eben seiner Seelen –, die sich, seitdem sein physischer Herz am 25. August 1900 zu schlagen aufhörte, in so unterschiedlichen Formen reinkarniert haben?
Klossowski steckt seine Nase in genau dieses Material, aber auf viel humorvollere Weise, wenn er Nietzsche als Protagonisten in den Baphomet hineinschmuggelt. Wir begegnen ihm im achten Kapitel, wo wir erfahren, dass er „in der Gestalt eines Ameisenbären“23 – ja, richtig gelesen – wiedergeboren wurde und nun unter dem Namen „Friedrich der Antichrist“ firmiert, innerhalb des Kreises des Großmeisters der Tempelritter, Jacob von Molay (ca. 1240-1314 u. Z.). Während er in der historischen Zeit auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, nachdem Dutzende von Templern schon im Zuge der gewaltsamen Zerschlagung des Ordens hingerichtet worden waren, lässt der Roman „den Großmeister“ damit fortfahren, seinen Rittern in dieser Zwischenwelt vorzustehen, die sich wie ein ewiger Warteraum anfühlt. Im Auftrag der „THRONE und HERRSCHAFTEN“, zwei Orden oder Klassen von Engeln, soll er die Seelen seiner ermordeten Ritter bis zur wohlverdienten Wiederauferstehung des Fleisches beim Jüngsten Gericht bewachen. Aber da er von verschiedener Seite unter Druck steht, vermag es Molay kaum, diesen göttlichen Plan konsequent umzusetzen. Einer dieser Störfaktoren ist der Ameisenbär. Der Großmeister verwechselt den Ameisenbär Nietzsche mit dem erwähnten Friedrich II. und es ist nicht einfach, ihn von seiner Verwirrung abzubringen: „Was habe ich mit Friedrich zu schaffen? Wohl der Hohenstaufen? Der Antichrist … Ameisenbär?“24 Nietzsche wusste, dass Friedrich II. von Hohenstaufen vom Papst zum „Antichrist“ erklärt wurde, da er dessen theokratisches Regime herausforderte. Dies war nur ein weiterer Grund für ihn, diese Bezeichnung als Titel des letzten Buches zu verwenden, das er während seines wachen Lebens vollendete. Dieser Titel ist doppeldeutig und lässt sich im Englischen ebenso sehr mit The Anti-Christ wie mit The Anti-Christian übersetzen.25 In der Tat geht es Nietzsche in dem Buch vor allem darum, das Alltagsleben moderner Christen zu attackieren. Nietzsche genoss sichtlich die Ambiguität des Titels, die es ihm erlaubte, als Reinkarnation des Teufels aufzutreten.
Dieser teuflische Nietzsche verwandelt sich jedoch in eine Witzfigur, wenn wir ihn in Der Baphomet nicht nur zum ersten Mal hören, sondern auch sehen. Ausgerechnet Ogier, der für lange Zeit verschwunden war, reitet auf ihm bei seiner stilvollen Rückkehr:
Und wie die Schar der Wachen die Menge auseinandertreibt und Spalier bildet, da reitet auf einem zotteligen Ungeheuer, das er mit einer Kette lenkt, inmitten der Tische langsam Ogier heran. Kein Gast, der ihn nicht bei jedem Schritt anhielte, um das Tier aus größtmöglicher Nähe zu mustern, dessen winziger Kopf mit der langen, hartnäckig über die Fliesen streichenden Schnauze im Gegensatz steht zu dem gewaltigen Körper mit den langen Klauen an den Pfoten[.]26
Klossowskis Prozession ruft gleichzeitig zahlreiche Assoziationen wach. Es fällt schwer, hier nicht an das tragikomische Foto zu denken, das Nietzsche neben Paul Rée als Zugpferd angespannt vor der Kutsche der peitschenschwingenden Lou Salomé zeigt. Und es fällt genauso schwer, hierin nicht eine dionysische Umkehrung von Christi Einzug in Jerusalem, auf einem Esel reitend, zu erblicken. Beide Szenen enthalten etwas gewollt Lächerliches; beide zeigen, wie die Verspotteten und Gedemütigten ihre Demütigung und Verspottung abwerfen in Taten, die von einer unwahrscheinlichen Überwindung zeugen. Doch neben solchen offensichtlichen Assoziationen sollten wir Winters Lesart nicht außer Acht lassen: Angesichts von Klossowskis „zweideutiger“ Konversion zum Islam plädiert Winter dafür, „Moslem-Sein“, nicht explizit den Islam selbst, als verschlüsseltes „Thema in seinen späteren Schriften“ zu erblicken.27 Liest man die Szene mit dem „zotteligen Ungeheuer“ auf diese Weise, erscheinen sowohl Ogier durch das, was er durchlitt, als auch Nietzsche selbst, in der völlig verfremdeten Gestalt des Ameisenbären, als „die Ausgeschlossenen“, die über einen „gerechten Anspruch“ verfügen. Winter bezieht sich hier erneut auf den ökumenischen katholischen Universalgelehrten Louis Massignon, um den Islam als die Religion dieses Anspruchs zu beschreiben:
Der Islam ist ein gewaltiges Mysterium des göttlichen Willens, der gerechte Anspruch [die Zurückforderung] der Ausgeschlossenen, derjenigen, die man in Gestalt ihres Stammvaters Ismael in die Wüste vertrieb, gegenüber den „Privilegierten“ Gottes, den Juden und nicht zuletzt den Christen, die ihre göttlichen Gnadenprivilegien missbraucht haben.28
Es ist gut möglich, Massignons und Winters Bestimmung des Islams entschieden zurückzuweisen und auch zu bestreiten, dass Klossowskis Roman mit dem „Moslem-Sein“ irgendetwas zu tun hat, und doch von dem philosophischen Material, auf dem diese Debatten basieren, gefesselt zu sein. Ist Nietzsches unveröffentlichte Notiz über „die Wiederkunft des Gleichen“, welche er im August des Jahres 1881 in den Schweizer Alpen verfasste und die selbst hartnäckig zweideutig bleibt und als Katalysator für alle Antworten Klossowskis auf Nietzsche dient, wirklich nichts mehr als ein unsinniges „Gedankenexperiment“? Ist da keine spirituelle Erleuchtung, keine Epiphanie – hier gibt’s nichts zu sehen, gehen Sie weiter, gehen Sie? Die Notiz wurde mit großer Sorgfalt zu Papier gebracht. Sie trägt die Überschrift „Entwurf“ und ist mit der Bemerkung versehen: „6000 Fuss über dem Meere und viel höher über allen menschlichen Dingen“. Sie hat sicherlich religiös gestimmte Leser Nietzsches dazu ermutigt, ihre Weltsichten aus Nietzsches Werk selbst heraus zu verbreiten.29 Jedenfalls Klossowski zufolge ist diese Notiz nicht der Entwurf einer Theorie im Embryostadium, sondern die Beschreibung einer gelebten Erfahrung:30
Die Wiederkunft des Gleichen.
Entwurf.
- Die Einverleibung der Grundirrthümer.
- Die Einverleibung der Leidenschaften.
- Die Einverleibung des Wissens und des verzichtenden Wissens. (Leidenschaft der Erkenntniss)
- Der Unschuldige. Der Einzelne als Experiment. Die Erleichterung des Lebens, Erniedrigung, Abschwächung – Übergang.
- Das neue Schwergewicht: die ewige Wiederkunft des Gleichen. Unendliche Wichtigkeit unseres Wissen’s, Irren’s, unsrer Gewohnheiten, Lebensweisen für alles Kommende. Was machen wir mit dem Reste unseres Lebens – wir, die wir den grössten Theil desselben in der wesentlichsten Unwissenheit verbracht haben? Wir lehren die Lehre – es ist das stärkste Mittel, sie uns selber einzuverleiben. Unsre Art Seligkeit, als Lehrer der grössten Lehre.
Anfang August 1881 in Sils-Maria31

III. Epilog: Wandern durch Pollockshields mit Fatima und Ismael
Während ich diesen Artikel schreibe, führe ich ein Online-Interview mit einer Frau Ende zwanzig, die ich gut kenne und die in Pollockshields aufgewachsen ist. Obwohl sie, wie ich, gerne wandert, hat noch keiner von uns die Alpenpfade rund um Sils-Maria erkundet, um auf den Spuren Nietzsches zu wandeln. Ich lasse meine Gedanken über die ewige Wiederkehr hinter mir, die mit unzähligen unerfüllten Wünschen verbunden ist, sei es nach Pakora oder nach Wanderungen in der Schweiz, und finde mich in einem Videoanruf wieder. Schon wieder.
Fatima ist Ingenieurin und arbeitet in der Luftfahrtindustrie im Süden Englands. Sie definiert sich in erster Linie als Schottin und erst in zweiter Linie als Muslimin. Dennoch ist sie bereit, mit mir über ihren Glauben zu sprechen. Sie erzählt von ihrem weniger religiösen Vater, dessen Hauptanliegen es war, in Routinejobs in harter Arbeit zu brillieren, um seinen Kindern die gute Schul- und Universitätsausbildung zu ermöglichen, die sie nun erhalten haben. Sie beschreibt ihre religiösere Mutter, mit der sie mehr über Fragen der Religionsausübung gesprochen hat, wie zum Beispiel den Hijab, den ihre Mutter sie als Teenagerin tragen lassen wollte. Als Fatima klar machte, dass sie das nicht wolle, bestanden weder ihre Mutter noch andere Familienmitglieder auf dieser Kleiderordnung. Als ob sie sich verpflichtet fühlte, mich über die Grundlagen aufzuklären, stellt Fatima die „fünf Säulen“ des Islams in den Vordergrund, die sie in der muslimischen „Sonntagsschule“ gelernt hat: das Glaubensbekenntnis, das Gebet, Almosen geben, Fasten während des Ramadan und die – einmal im Leben stattfindende – Hadsch, die Pilgerfahrt nach Mekka. Fatima erklärt, dass sie noch nicht auf der Hadsch war, aber schon auf der Umrah, der kleinen Pilgerfahrt.
Wie für viele andere Gläubige, mit denen ich spreche, sind theologische Fragen für Fatima nicht besonders wichtig. Von außen betrachtet scheint ihr Leben völlig weltlich zu sein: Sie arbeitet hart, reist um die Welt, verbringt Zeit mit Freundinnen und Freunden und spielt Bassgitarre. In dieser Hinsicht beeindrucken sie die Appelle derer, die den Koran und die anderen Texte der Tradition allzu wortwörtlich auslegen, nicht. Muhammad ibn Adam al-Kawthari etwa ist ein pro-kalifaler Geistlicher aus Leicester, England, der ein Verbot sowohl des Spielens als auch des Hörens von Instrumenten propagiert, aber das ist kaum die Art von Stimme, auf die Fatima hört.32 Angesichts solcher asketischer und irrationalistischer Erscheinungsformen in der muslimischen Gemeinschaft Großbritanniens und angesichts der Tatsache, dass Fatima das genaue Gegenteil davon ist, eine besonnene Person, die die Vielfalt des Lebens bejaht, frage ich sie, ob sie sich etwas vorstellen kann, das sie dazu bringen würde, ihre Religion ganz aufzugeben. Sie hält einen Moment inne, bezeichnet ihre religiöse Erziehung in ihrer Kindheit nüchtern als „Indoktrination“ und spricht darüber, wie Menschen diese verinnerlichen – dass man sie nicht einfach abschütteln kann. Sie vergisst nicht, wie die Glasgow Sunnis, die Gruppe, der sie angehört, dafür sorgen, dass diejenigen, die sich offiziell von ihrem Glauben lossagen, die „richtige“ Botschaft erhalten: „Du wirst für immer in der Hölle schmoren“. Ich dränge Fatima nicht weiter – Erwachsene, die sich an die existenziellen religiösen Bilder erinnern, die ihnen als Kinder eingeprägt wurden, brauchen es, dass manches davon privat bleibt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie weder an das Höllenfeuer glaubt noch sich weigert, es völlig zu leugnen. Religion ist eng mit Familie, Kultur und geografischer Gemeinschaft verbunden: den Dingen, die einen mitprägen, während man zu dem wird, was man ist. Da es keine alternative philosophische oder religiöse Weltanschauung gibt, die mit einer Substanz und Anziehungskraft aufwarten kann, die mit derjenigen des Islams vergleichbar ist – warum sollten Menschen wie Fatima riskieren, damit zu brechen?
Zurück in Glasgow im Sommer und mit etwas Zeit vor meinem abendlichen Interview mit dem Imam der Dawat-E-Islami-Moschee in der Niddrie Road, gehe ich zum Queen’s Park südlich von Pollockshields, um dort zu warten. Unter hoch aufragenden Kirchtürmen sitzen Gruppen auf dem frisch gemähten Rasen und bereiten sich auf das Wochenende vor, trinken und rauchen Joints, während die Hitze nachlässt. Ein barfüßiger Glasgower mit nahöstlichen Wurzeln läuft sogar mit einem zahmen, aber nicht angebundenen Papagei auf der Schulter herum. So etwas habe ich in der Öffentlichkeit noch nie gesehen. Wenn er oder seine Vorfahren jemals einer „neinsagenden Religion” angehörten, sagt er jetzt so energisch Ja zum Leben, dass man das Gefühl hat, es könnte gefährlich enden. Die nord-sudanesischen Friseure, bei denen ich auf dem Weg zum Park kurz vorbeigeschaut hatte, um mir die Haare schneiden zu lassen, waren ebenfalls sehr gesprächig. Ihr erklärtes Moslem-Sein hindert sie nicht daran, das Leben als eine gesellige und sich langsam entwickelnde Party zu betrachten. Als ich die Moschee betrete, ändert sich die Stimmung. Höflicherweise haben der pakistanische Imam Shafqad Mahmood, sein Assistent Mansoor Awais, der für ihn dolmetscht, wenn das Englisch komplexer wird, und ein weiteres älteres Gemeindemitglied, Haji Ahmad, kurzfristig eine halbe Stunde Zeit für mich gefunden, bevor die Abendgebete beginnen. Meine Unruhe rührt aus dem, was ich über die Organisation Dawat-E-Islami in Ed Husains liberaler muslimischer Kritik an der aktuellen Lage seiner Religion in Großbritannien gelesen habe. Die in Pakistan ansässige Gruppe, deren Name übersetzt „Einladung zum Islam“ bedeutet, eröffnete um 1995 ihre ersten Moscheen in Großbritannien und verfügt nun, wie mir der Imam stolz erzählt, über drei Zentren im Großraum Glasgow, die wöchentlich über fünfhundert Gläubige versorgen.33 Husain seinerseits spricht über den sektiererischen Mord an Asad Shah im Jahr 2016, weniger als eine Meile von dem Ort entfernt, an dem wir sitzen und uns unterhalten, begangen von einem „Mann der Dawat-e-Islami“, allerdings einem aus Bradford im Norden Englands und nicht einem Mitbürger aus Glasgow.34 Shahs „Vergehen“ bestand, zumindest in den Augen seines Mörders, darin, ein Ahmadi zu sein, ein Anhänger des Inders Ghulam Ahmad (1835–1908 u. Z.), der behauptete, gleichzeitig ein „Erneuerer des Glaubens“, „der verheißene Messias“ und „der Mahdi (der Rechtgeleitete, der am Ende der Zeit zusammen mit dem Messias erscheinen wird)“ zu sein: Damit gab er den Anstoß zu einer bedeutenden neuen religiösen Bewegung, die von orthodoxen Muslimen einheitlich abgelehnt wird.35 Da Husain bereits einen früheren Imam der Queen’s-Park-Moschee zu Dawat-e-Islami und dem Mord von 2016 befragt und ausweichende Antworten erhalten hatte, beschränke ich mich darauf, nach der Haltung der Moschee gegenüber Schiiten, der Ahmadiyya-Muslimgemeinschaft und anderen muslimischen Glaubensrichtungen zu fragen. Meine überaus orthodoxe Frage wird mit einer schnörkellosen Antwort bedacht: „Die Ahmadiyya sind keine Muslime.“ Überraschenderweise fügt Haji Ahmad jedoch hinzu: „Wir haben Schiiten, die jede Woche hierherkommen, um zu beten. Die Ahmadiyya könnten sogar hierherkommen und beten, wenn sie wollten. Wenn sie nichts sagen würden.“ Die Botschaft ist großzügig gemeint, aber klar: Die Moscheeleiter tolerieren nicht-konforme Glaubensrichtungen nur insoweit, als sie völlig privat bleiben. Diese Strategie zur Gewährleistung von Konformität passt zu dem, was meine Frage nach der Haltung der Moschee „gegenüber homosexuellen Muslimen oder Trans-Menschen“ ergibt: „Wir akzeptieren sie nicht. Aber wir würden nichts sagen[, wenn sie zum Beten in die Moschee kämen].“ Ich muss an die Geschichte denken, die Fatima mir erzählt hat über eine lesbische muslimische Freundin von ihr, die versuchte, sich ihrer Mutter zu offenbaren, und deren Mutter nicht in der Lage war, diese Realität zu akzeptieren oder zu unterstützen. Wenn man die Geschichte hört, denkt man, dass die Mutter der Freundin schon lange zuvor von den Beziehungen ihrer Tochter gewusst haben muss – und sie toleriert hat, solange sie geheim blieben.

Niemand verheimlicht etwas im Category is Books, gleich die Straße hoch nahe der Dawat-E-Islami-Moschee und der ihr angegliederten religiösen Schule. Leider komme ich außerhalb der Öffnungszeiten an, aber das Schaufenster ruft Passanten mit bestechenden Slogans zu: „Unterstützt Lesben“, „Lieber homo als hässig“, „Bewegungsfreiheit für alle!“ – und in riesigen Buchstaben das möglicherweise bahnbrechende: „RAUS AUS DEM INTERNET. ZERSTÖRT DIE RECHTE.“ Man könnte meinen, dass es keinen Dialog zwischen der Gemeinde dieses Ladens und der Moschee gibt. Aber der Grund, der einen Dialog hervorgerufen hat und weiterhin hervorrufen wird, ergibt sich, als ich die Leiter der Moschee nach den Rezipienten des offiziellen Gemeinnützigkeitsstatus der Organisation frage: „In den letzten zwei Jahren haben wir Hilfslieferungen per Flugzeug nach Gaza und in das Westjordanland finanziert, Lebensmittel, Wasser und Kleidung, und wir haben uns auch um Waisenkinder gekümmert, unabhängig davon, ob die Menschen dort Muslime, Christen oder was auch immer sind.“ Wie die große britische Nachrichtenplattform The Canary kürzlich berichtete, fordert der Glasgower Ableger der Gruppe „No Pride in Genocide“, „eine breite Koalition von LGBTQ+- Glasgowern“, von den Organisatoren der jährlichen Pride-Parade der Stadt, dass sie das ablehnen, was die Journalisten der Plattform als „Unternehmen, die direkt von der illegalen Besetzung Israels und dem anhaltenden Völkermord in Palästina profitieren“ bezeichnen.36 Solche Belange scheinen weit entfernt von Nietzsches philosophischen und Klossowskis künstlerischen Ahnungen zum Islam. Doch ein Blick auf Judith Butler, der sicherlich meistgelesenen Philosophin ihrer Generation zum Thema Queerness,37 genügt, um zu erkennen, dass es durchaus einen philosophischen Aspekt dieser Bemühungen gibt. Im Kampf gegen Donald Trumps Executive Order 14168 vom Januar 2025, deren Titel nicht verheimlicht, um was es geht – „Verteidigung von Frauen vor geschlechtstheoretischem Extremismus und Wiederherstellung der biologischen Wahrheit in der Bundesregierung“ –, verbindet Butler die Punkte der gemeinsamen Sache, die Trans-Menschen, Muslime und andere Menschen mit Migrationshintergrund in den polarisierten Gesellschaften von heute finden können und finden. Darüber hinaus konzentriert Butler sich auf die Gruppe von Trans-Menschen, die von der extremen Rechten am meisten verunglimpft wird: „Menschen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde und die einen Übergang [zu einer weiblichen oder anderen Geschlechtsidentität; HH] anstreben“.38 Butler weist darauf hin, dass „Mutmaßungen“ über solche Personen, wie sie von einer wachsenden Zahl in der Gesellschaft angestellt würden, unbegründet seien, und dass die große Mehrheit von ihnen diesen Übergang vollziehe, weil „sie sich ein lebenswerteres Leben erhoffen“. Diesen Punkt konkretisierend, argumentiert Butler, dass es keine philosophische Rechtfertigung dafür gebe, die „wenigen dokumentierten Fälle“, in denen Männer diesen Übergang vorgenommen hätten, um „Zugang zu Frauenräumen zu erhalten, um, wie angenommen wird, den dortigen Frauen Schaden zuzufügen“, als allgemeines „Paradigma eines typischen Übergangs“ zu betrachten. Ausgehend davon und im Autorenplural schreibend, kommt Butler zu folgendem Schluss:
Wir verweisen nicht auf die ruchlosen Schandtaten einzelner Juden oder Muslime und schließen daraus, dass alle Juden oder Muslime so handeln. Nein, wir lehnen es ab, auf dieser Grundlage zu verallgemeinern, und wir vermuten, dass diejenigen, die dies tun, die einzelnen Beispiele, die sie vorbringen, nutzen, um eine Form des Hasses zu bestätigen und zu verstärken, die sie ohnehin schon empfinden.39
War Nietzsche bösartig, intendierte er Verletzungen, als er den Islam als „eine ja-sagende semitische Religion, hervorgebracht von den herrschenden Klassen“, bezeichnete, und dieses Vorurteil zugunsten des Islams gegenüber dem Christentum und dem Judentum in seinen Schriften festschrieb? – „Entweder ist man ein Tschandala oder man ist es nicht.“ Wenn ja, könnte das Heilmittel für einen solchen Schaden bei seinen umsichtigeren, gemäßigteren und künstlerisch vieldeutigeren Nachfolgern zu finden sein. Ob man solche Nachfolger in den Straßen von Glasgows Süden oder bei großen Künstlern und modernen Muslimen wie Pierre Klossowski findet, hängt davon ab, welche Art von kultureller oder religiöser Heimat man sucht.
Alle Fotos sind vom Autor selbst aufgenommen worden. Das Titelbild zeigt den Hinterhof einer Steinmetzerei am Rande von Pollockshields, die zweisprachige Grabsteine für die muslimischen Einwohner des Stadtteils anbietet.
Bibliographie
Albany, HRH Prince Michael of Walid & Amine Salhab: The Knights Templar of the Middle East: The Hidden History of the Islamic Origins of Freemasonry. Weiser Books: 2006.
Almond, Ian: Nietzsche’s Peace with Islam: My Enemy’s Enemy is my Friend. In: German Life and Letters 56, Nr. 1 (2003), S. 43-55.
Balthus (Graf Balthazar Klossowski de Rola Balthus): Balthus in his Own Words: A Conversation with Cristina Carrillo de Albornoz. Assouline: 2002.
Balzani, Marzia: Ahmadiyya Islam and the Muslim Diaspora: Living at the End of Days. Routledge: 2020.
Barber, Malcolm: The New Knighthood: A History of the Order of the Temple. Cambridge University Press: 1994.
Bauer, Thomas: A Culture of Ambiguity: An Alternative History of Islam, übers. v. Hinrich Biesterfeldt & Tricia Tunstall. Columbia University Press: 2021. (Im deutschen Original: Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams. Suhrkamp: 2011.)
Butler, Judith: This is Wrong: Judith Butler on Executive Order 14168. In: London Review of Books, 03.04.2025, https://www.lrb.co.uk/the-paper/v47/n06/judith-butler/this-is-wrong, ohne Seitenzählung (Link zur deutschen Übersetzung).
Canary Journalists, The: Glasgow Pride was just exposed as being complicit in Israel’s genocide. In: The Canary, 20.07.2025, ohne Seitenzählung, https://www.thecanary.co/uk/news/2025/07/20/glasgow-pride-2025/.
Groff, Peter: Nietzsche and Islam [Rezension zu Nietzsche and Islam von Roy Jackson]. In: Philosophy East & West, Bd. 60, Nr. 3, Juli 2010, S. 430-437.
Husain, Ed: Among the Mosques: A Journey Around Muslim Britain. Bloomsbury: 2021.
Jackson, Roy: Nietzsche and Islam. Routledge: 2007.
Klossowski, Pierre: Der Baphomet, übers. v. Gerhard Goebel. Rowohlt: 1987.
Klossowski, Pierre: The Baphomet, übers. v. Sophie Hawkes and Stephen Sartarelli, mit einer Einleitung von Juan Garcia Ponce & Michel Foucault. Eridanos Press: 1988.
Krokus, Christian: The Theology of Louis Massignon: Islam, Christ and the Church. Catholic University of America Press: 2017.
Newcomb, Tim (Übers. & Hg.): Friedrich Nietzsche, Anti-Christian: The Curse of Christianity. Livraria Press: 2024.
Orsucci, Andrea: Orient-Okzident: Nietzsches Versuch einer Loslösung vom europäischen Weltbild. De Gruyter: 2011.
Smith Daniel: Translator’s Preface. In: Pierre Klossowski. Nietzsche and the Vicious Circle, übers. v. Daniel Smith. University of Chicago Press: 1997, S. vii-xiii.
Sommer, Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, Ecce homo, Dionysos-Dithyramben, Nietzsche contra Wagner. De Gruyter: 2013.
Winter, Timothy: Klossowski’s Reading of Nietzsche From an Islamic Viewpoint. 2025. [Unveröffentlichtes Manuskript, das Winter mit Henry Holland im Oktober 2025 teilte, mit einem Text, der Winters auf YouTube gehaltener Vorlesung ähnelt, aber leicht davon abweicht.]
Fußnoten
1: Wellhausen, Reste arabischen Heidentums (1887), zititert nach Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, Ecce homo, Dionysos-Dithyramben, Nietzsche contra Wagner, S. 294 f. Sommer bestätigt, dass Nietzsche diese Arbeit Wellhausens in dieser Periode las; s. Sommers Personenregister, ebd., 920, für ausgiebige Referenzen zu Nietzsches Lesart Wellhausens.
2: Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, S. 110.
3: Alle Referenzen zum Manusmriti bzw. dem „Gesetzesbuch des Manu“ in Nietzsches Werk und zum damit verbundenen Konzept „Taschandala“ stammen aus dem Jahr 1888. Ein Brief an Heinrich Köselitz vom 31. Mai 1888 (Link) legt nahe, dass Nietzsche gerade die Arbeit entdeckt hatte: „Eine wesentliche Belehrung verdanke ich diesen letzten Wochen: ich fand das Gesetzbuch des Manu in einer französischen Übersetzung [wahrscheinlich Louis Jacolliots; HH], die in Indien, unter genauer Controle der hochgestelltesten Priester und Gelehrten daselbst, gemacht worden ist. Dies absolut arische Erzeugniß, ein Priestercodex der Moral auf Grundlage der Veden, der Kasten-Vorstellung und uralten Herkommens – nicht pessimistisch, wie sehr auch immer priesterhaft – ergänzt meine Vorstellungen über Religion in der merkwürdigsten Weise.“ Für mehr zu „orientalistischen“ Texten, die Nietzsche las, vgl. Ian Almond, Nietzsche's Peace with Islam, S. 43, sowie Andrea Orsucci, Orient-Okzident: Nietzsches Versuch einer Loslösung vom europäischen Weltbild.
4: Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, S. 9 & 265.
5: Nachgelassene Fragmente 1888 14[95].
6: Wie Andreas Urs Sommer zeigt, fügte Nietzsche diese billige antisemitische Stichelei erst im finalen Entwurf in den Text ein. Sommer legt nahe, dass Nietzsche hier verbreitete antisemitische Ressentiments unter seinen möglichen Lesern bedienen möchte (vgl. Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, S. 298).
7: Der Antichrist, Abs. 60. In jüngster Zeit gab es zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten über die Vorliebe Friedrichs II. für den Islam. Zu Nietzsches Quellen zu jenem Thema siehe auch Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, S. 298 f. Sommer hebt hier auch die Rolle hervor, die August Müllers Schriften über Friedrich II. in Nietzsches Lesart hatten. Müller schreibt hier etwa, es sei „bekannt“, dass „Kaiser Friedrich II. […] an Sprache und Litteratur der Araber das lebhafteste Interesse nahm, mit seinem muslimischen Hofphilosophen gottlos Logik trieb und zum Skandal aller frommen Leute selbst ein halber oder ganzer Heide [i. e. Moslem; HH] wurde“ (zit. n. ebd., S. 298.).
9: So die Zusammenfassung der von Peter Jackson vertretenen Argumentation in Peter Groff, Nietzsche and Islam, S. 431. Anm. d. Übers.: Alle Zitate aus englischsprachigen Texten wurden von uns selbst ins Deutsche übertragen.
10: Roy Jackson, Nietzsche and Islam, e-book-Verortung: Kap. 1, 7.51.
11: Vgl. Groff, Nietzsche and Islam, S. 435. Groff hält Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 346, für eine von Nietzsches klarsten Aussagen betreffs des Vorhabens „über den Atheismus hinauszugehen“. Hier schreibt Nietzsche: „Wollten wir uns einfach mit einem älteren Ausdruck Gottlose oder Ungläubige oder auch Immoralisten nennen, wir würden uns damit noch lange nicht bezeichnet glauben“.
12: Vgl. Groff, Nietzsche and Islam, S. 430.
13: Vgl. ebd., S. 431 und Jackson, Nietzsche, Kapitel 2, 8.46-8.50.
14: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 12.
15: Zusammenfassung von Jacksons Argumentation in Groff, Nietzsche and Islam, S. 432.
16: Für einen ausgezeichnet recherchierten historische Abriss solcher Sichtweisen vgl. Malcom Barber, The New Knighthood, S. 321. Für einen islamophilen Zugang zur selben Geschichte, der selbst ein wenig verschwörungstheoretisch daherkommt, vgl. HRH Prince Michael of Albany & Walid Amine Salhab, The Knights Templar of the Middle East, S. x f. & 22 f.
17: Thomas Bauer, A Culture of Ambiguity, S. 11, zit. n. Timothy Winters unveröffentlichtem Manuskript Klossowski’s reading of Nietzsche from an Islamic viewpoint, S. 1, das Winter großzügigerweise mit mir im Oktober 2025 geteilt hat. Ich danke ihm herzlich dafür. Ein solches im Entstehen befindliches Buch zu teilen ist eine großartige Geste der Kollegialität. Der Text von Winters Manuskript ist weitgehend identisch mit seiner erwähnten YouTube-Vorlesung (Link), doch beinhaltet ein paar unwesentliche Änderungen.
18: Amm. d. Übers.: „Snuff-Filme” sind Filme, die in realistisch wirkender Manier krasse Gewalt darstellen zur Unterhaltung oder sexuellen Erregung und in einem Mord kulminieren. Ihr Reiz liegt darin, dass sie mit dem Eindruck spielen, das Gezeigte könnte wirklich passiert sein.
19: Klossowski, The Baphomet, S. xv.
20: Winter, Klossowski’s reading of Nietzsche from an Islamic viewpoint, S. 8.
21: Pierre Klossowski, The Baphomet, S. 166 f.
23: Meine Hervorhebung. Klossowski, Der Baphomet, S. 140.
24: Ebd., S. 141.
25: Die meisten Übersetzer folgen weiterhin der Tradition, die u. a. von Walter Kaufmann begründet wurde, und betiteln ihr englisches Werk mit The Antichrist. Tim Newcomb allerdings, Autor einiger der wenigen Übersetzungen unter dem Titel The Anti-Christian, ist darin zuzustimmen, dass Nietzsches Primärziel die Christen seiner Zeit waren. Da sich ‚ein Christ‘ als ‚a Christian‘ übersetzen lässt, ist es legitim, sich für den Alternativtitel The Anti-Christian zu entscheiden. Vgl. Tim Newcomb, Afterword in Friedrich Nietzsche, Anti-Christian: The Curse of Christianity.
26: Klossowski, Der Baphomet, S. 158.
27: Winter, Klossowski’s reading, S. 10. Klossowskis Konversion ist zweideutig in dem Sinne, dass sie nur von einer einzigen lapidaren Bemerkung eines jüngeren Bruders Balthus bezeugt wird: „Mein Bruder, Pierre, wurde, als er jung war, ein dominikanischer Mönch. Dann, viel später, konvertierte er zum Islam.“ (Zit. n. Balthus [Graf Balthazar Klossowski de Rola Balthus], Balthus in his Own Words, S. 11.) Es gibt keinen Grund, Balthus’ Zeugnis nur deshalb in Frage zu stellen, weil es so knapp ist. Viel eher legt dieser Umstand nahe, dass es sich bei Klossowskis „Moslem-Sein“ um eine großteils private Angelegenheit handelte. Es gilt allerdings zu berücksichtigen, dass dies nicht die einzige Konversion in Klossowskis Leben ist, die Balthus beschreibt: Adam-Maxwell Reweski „hinterließ meinem Bruder und mir einen Geldbetrag, den wir für unsere Erziehung verwenden durften, wenn wir nur Katholiken würden. Und wir konvertierten zum Katholizismus, auch wenn unser Vater ein Protestant war“ (ebd., S. 5).
28: Christian Krokus, The Theology of Louis Massignon, S. 175; zit. n. Winter, Klossowski’s Reading of Nietzsche, S. 11.
29: Nachgelassene Fragmente 1881 11[141].
30: Vgl. bspw. den Vortrag „mit dem Titel Vergessen und Wiedererinnerung in der gelebten Erfahrung der ewigen Wiederkunft des Gleichen, den Klossowski bei der berühmtem Konferenz über Nietzsche im Juli 1964 in Royaumont hielt“, wie ihn Daniel Smith beschreibt (Translator’s Preface, S. viii).
31: Nachgelassene Fragmente 1881 11[141]. Man sollte hier nicht vergessen, dass das Wort „Einverleibung“ eine starke christliche Konnotation hat und auf den Begriff der „Inkarnation“ (von Spätlateinisch incarnatio, „der Akt der Fleischwerdung“ oder des Eintritts in einen Körper) verweist.
32: Vgl. zu Al-Kawthari Ed Husain, Among the Mosques, Kap. 1.
33: Es wird geschätzt, dass Dawat-e-Islami im Vereinigten Königreich um die vierzig Veranstaltungsorte gehören.
34: Für Details des Mordes und der theologischen Rolle, die Dawat-e-Islami dabei spielte, siehe Ed Husain, Among the Mosques, Kapitel 8, Edinburgh and Glasgow.
35: Vgl. Marzia Balzani, Ahmadiyya Islam and the Muslim Diaspora, S. 2.
36: The Canary Journalists, Glasgow Pride was just exposed as being complicit in Israel’s genocide, 20.07.2025, ohne Seitenzählung.
37: Anm. d. Übers.: Butler identifiziert sich seit 2019 als nichtbinäre Person.
38: Judith Butler, This is Wrong: Judith Butler on Executive Order 14168, ohne Seitenzählung.
39: Ebd.
„Friede mit dem Islam“?
Wanderungen mit Nietzsche durch Glasgows muslimischen Süden: Teil 2
Im zweiten Teil seines Artikels über seine Reise durch den muslimisch geprägten Süden Glasgows geht unser Stammautor Henry Holland vertieft auf Nietzsches immer wieder aufflammende Beschäftigung mit der Religion Mohammeds ein, erläutert näher, wie der französische Künstler und Theoretiker Pierre Klossowski in seinem experimentellen Roman Der Baphomet Nietzscheanismus, sexuelle Transgression und vom Islam inspirierte Mystik in eigensinniger Weise verband und kehrt dann noch einmal zurück in die schottische Großstadt, um seinen Reisebericht abzurunden.
Aus dem Englischen übersetzt von Lukas Meisner und Paul Stephan.
Im Bann der Maschine
Nietzsches Umwertung der Maschinenmetapher im Spätwerk
Im Bann der Maschine
Nietzsches Umwertung der Maschinenmetapher im Spätwerk


In der vergangenen Woche berichtete Emma Schunack von der diesjährigen Jahrestagung der Nietzsche-Gesellschaft zum Thema Nietzsches Technologien (Link). Ergänzend dazu untersucht Paul Stephan in seinem Beitrag in dieser Woche, wie Nietzsche die Maschine als Metapher einsetzt. Der Befund seiner philologischen Tiefenbohrung mitten durch Nietzsches Schriften: Während er in seinen Frühschriften an die romantische Maschinenkritik anknüpft und die Maschine als Bedrohung der Menschlichkeit und Authentizität beschreibt, vollzieht sich ab 1875, zunächst in seinen Briefen, eine überraschende Wendung. Auch wenn Nietzsche noch gelegentlich an die alte Entgegensetzung von Mensch und Maschine anknüpft, beschreibt er sich nun zunächst selbst als Maschine und befürwortet schließlich eine Verschmelzung bis hin zur Identifikation von Subjekt und Apparat sogar, konzipiert Selbst- als Maschinenwerdung. Dies hängt mit der sukzessiven allgemeinen Abkehr Nietzsches von den humanistischen Idealen seiner frühen und mittleren Schaffensperiode und der zunehmenden ‚Verdunkelung‘ seines Denkens zusammen – nicht zuletzt der Entdeckung der Idee der „ewigen Wiederkunft“. Aus einer Kritik der kapitalistischen Gesellschaftsmaschine wird ihre radikale Affirmation – amor fati als amor machinae.
Nietzsches Kulturkritik ist in ihrer Ausrichtung gegenüber der Moderne äußerst ambivalent. Mal wirkt es so, als vertrete er einen geradezu modernistischen Standpunkt, mal tendiert er ins Romantische oder gar ins Reaktionäre. Um sich diese Zweideutigkeit von Nietzsches Kulturkritik und seiner Positionierung zur Moderne zu vergegenwärtigen, ist es äußerst aufschlussreich, seine Äußerungen zum Begriff der „Maschine“ in den Blick zu nehmen. Dies ermöglicht nicht zuletzt einen differenzierten Blick auf seine Ethik der Authentizität.
I. Ein Kämpfer gegen die Maschinen-Zeit
Wie ein roter Faden ziehen sich durch Nietzsches Werk von den frühesten bis zu den spätesten Schriften Äußerungen, in denen er die Maschine kritisiert und als Metapher für den modernen Kapitalismus verwendet. Er kritisiert etwa, dass der moderne „äußerliche akademische Apparat, […] die in Thätigkeit gesetzte Bildungsmaschine der Universität“1 die Gelehrten gleich Fabrikarbeitern zu bloßen Maschinen herabwürdige.2 Die modernen Philosophen seien „Denk-, Schreib- und Redemaschinen“3. In ähnlicher Weise wie Karl Marx kritisiert Nietzsche in dieser Periode sogar die Unterwerfung der Arbeiter, die genötigt sind, „sich als physische Maschinen [zu] vermiethen“4, selbst unter die Maschinerie und macht sie für ihre sittliche Degeneration verantwortlich bzw. für das Aufkeimen dessen, was er später als „Ressentiment“ bezeichnen sollte:
Die Maschine controlirt furchtbar, daß alles zur rechten Zeit und recht geschieht. Der Arbeiter gehorcht dem blinden Despoten, er ist mehr als sein Sklave. Die Maschine erzieht nicht den Willen zur Selbstbeherrschung. Sie weckt Reaktionsgelüste gegen den Despotismus – die Ausschweifung, den Unsinn, den Rausch. Die Maschine ruft Saturnalien hervor.5
An anderer Stelle formuliert Nietzsche die Dialektik der Maschinisierung wie folgt:
Reaction gegen die Maschinen-Cultur. – Die Maschine, selber ein Erzeugniss der höchsten Denkkraft, setzt bei den Personen, welche sie bedienen, fast nur die niederen gedankenlosen Kräfte in Bewegung. Sie entfesselt dabei eine Unmasse Kraft überhaupt, die sonst schlafen läge, das ist wahr; aber sie giebt nicht den Antrieb zum Höhersteigen, zum Bessermachen, zum Künstlerwerden. Sie macht thätig und einförmig, – das erzeugt aber auf die Dauer eine Gegenwirkung, eine verzweifelte Langeweile der Seele, welche durch sie nach wechselvollem Müssiggange dürsten lernt.6
Die Maschinerie diene so als Erzieherin zur Inauthentizität, produziert flexible Maschinenmenschen, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu erziehen:
Die wilden Thiere sollen über sich wegsehen lernen, und in den Andern (oder Gott) zu leben suchen, sich möglichst vergessend! So geht es ihnen besser! Unsere Moraltendenz ist immer noch die der wilden Thiere! sie sollen Werkzeuge großer Maschinerien außer ihnen werden und lieber das Rad drehen als mit sich zusammen sein. Moralität war bisher Aufforderung sich nicht mit sich zu beschäftigen, indem man sein Nachdenken verlegte und sich die Zeit raubte, Zeit und Kraft. Sich niederarbeiten, müdemachen, Joch tragen unter dem Begriff der Pflicht oder der Höllenfurcht – große Sklavenarbeit war die Moralität: mit der Angst vor dem ego.7
Auch noch im Spätwerk gilt Nietzsche die Unterwerfung unter die „ungeheuren Maschinerie“8 der „sogenannten ‚Civilisation‘“ (ebd.) – ihre Hauptmerkmale: „die Verkleinerung, die Schmerzfähigkeit, die Unruhe, die Hast, das Gewimmel“ (ebd.) – als Hauptgrund für „die Heraufkunft des Pessimismus“ (ebd.). Er spricht abfällig von den beliebig fungiblen „kleine[n] Maschinen“9 der modernen Gelehrten und spottet darüber, dass es die Aufgabe des modernen „höheren Schulwesens“10 sei, „[a]us dem Menschen eine Maschine zu machen“ (ebd.), einen pflichtbewussten „Staats-Beamte[n]“ (ebd.) als, vermeintliche, vollkommene Manifestation der Ethik Kants. Bei ehrlicher Betrachtung
ergiebt sich jene so verschwenderische und verhängnissreiche Zeit der Renaissance als die letzte grosse Zeit, und wir, wir Modernen mit unsrer ängstlichen Selbst-Fürsorge und Nächstenliebe, mit unsren Tugenden der Arbeit, der Anspruchslosigkeit, der Rechtlichkeit, der Wissenschaftlichkeit – sammelnd, ökonomisch, machinal – als eine schwache Zeit[.]11
Und zu guter Letzt spricht er dann noch in Ecce homo von der „Behandlung, die ich von Seiten meiner Mutter und Schwester erfahre“12 als „vollkommene[r] Höllenmaschine“ (ebd.).
Im Nachlass der frühen 1870er Jahre heißt es sogar programmatisch:
Handwerk lernen, nothwendige Rückkehr des Bildungsbedürftigen in den kleinsten Kreis, den er möglichst idealisirt. Kampf gegen die abstracte Production der Maschinen und Fabriken. Ein Hohn und Hass gegen das zu erzeugen, was jetzt als „Bildung“ gilt: dadurch dass man eine reifere Bildung dagegen stellt.13
Die moderne utilitaristische Maschinenwelt ist Nietzsche in ihrer Totalität ein Graus, das er kritisch mit der dionysischen Kultur der Antike konfrontiert:
Das Alterthum ist im Ganzen das Zeitalter des Talents zur Festfreude. Die tausend Anlässe sich zu freuen waren nicht ohne Scharfsinn und großes Nachdenken ausfindig gemacht; ein guter Theil der Gehirnthätigkeit, welche jetzt auf Erfindung von Maschinen, auf Lösung der wissenschaftlichen Probleme gerichtet ist, war damals auf die Vermehrung der Freudenquellen gerichtet: die Empfindung, die Wirkung sollte in’s Angenehme umgebogen werden, wir verändern die Ursachen des Leidens, wir sind prophylaktisch [vorsorgend; PS], jene palliativisch [‚ummantelnd‘ im Sinne der Palliativmedizin; PS].14
In der Maschinenwelt umgäben sich die Menschen mit anonymen Waren anstatt mit wirklichen Dingen, über die sie in eine resonierende Beziehung zu ihren Urhebern treten könnten:
Inwiefern die Maschine demüthigt. – Die Maschine ist unpersönlich, sie entzieht dem Stück Arbeit seinen Stolz, sein individuell Gutes und Fehlerhaftes, was an jeder Nicht-Maschinenarbeit klebt, – also sein Bisschen Humanität. Früher war alles Kaufen von Handwerkern ein Auszeichnen von Personen, mit deren Abzeichen man sich umgab: der Hausrath und die Kleidung wurde dergestalt zur Symbolik gegenseitiger Werthschätzung und persönlicher Zusammengehörigkeit, während wir jetzt nur inmitten anonymen und unpersönlichen Sclaventhums zu leben scheinen. – Man muss die Erleichterung der Arbeit nicht zu theuer kaufen.15
Im Gegensatz zu persönlich gefertigten, authentischen, handwerklichen Produkten überzeugten die maschinellen Waren nicht durch ihre intrinsische Qualität, wie sie nur von Kennern ermittelt werden könnte, sondern nur durch ihren Effekt und betrögen damit das breite Publikum.16
Am schärfsten fasst Nietzsche diese umfassende Kritik an der modernen Warenproduktion und der von ihr verhexten Lebenswelt jedoch in Menschliches, Allzumenschliches zusammen:
Gedanke des Unmuthes. – Es ist mit den Menschen wie mit den Kohlenmeilern im Walde. Erst wenn die jungen Menschen ausgeglüht haben und verkohlt sind, gleich jenen, dann werden sie nützlich. So lange sie dampfen und rauchen, sind sie vielleicht interessanter, aber unnütz und gar zu häufig unbequem. – Die Menschheit verwendet schonungslos jeden Einzelnen als Material zum Heizen ihrer grossen Maschinen: aber wozu dann die Maschinen, wenn alle Einzelnen (das heisst die Menschheit) nur dazu nützen, sie zu unterhalten? Maschinen, die sich selbst Zweck sind, – ist das die umana commedia [menschliche Komödie; PS]?17
Die Nähe dieser Gedanken zu einer rousseauistischen, romantischen Kapitalismuskritik, aber auch zu Marx, ist bemerkenswert und unübersehbar. Die „Maschine“ wird für Nietzsche zum Inbegriff dessen, was der Marxismus als „Fetischismus der Warenproduktion“ bezeichnet und er kommt einem klaren Verständnis der verdinglichenden Mechanismen der kapitalistischen Produktionsweise hier überraschend nahe. – Freilich erstaunt diese Metaphorik nicht vor dem Hintergrund, dass die Aufwertung der ‚authentischen Produktion‘ gegenüber dem Handwerk zu den „absoluten Metaphern“ (Hans Blumenberg) des modernen Authentizitätsdenkens gehört, in dessen Gleisen sich Nietzsche an diesen Stellen vollkommen bewegt. Das Lebendige und das Tote, die Maschine und die echte Praxis, werden schroff dualistisch gegenübergestellt.18
Angesichts dieser deutlichen Worte ist es bezeichnend, dass es, parallel dazu, ab etwa 1875 in Nietzsches Schriften zu einer geradezu diametralen Umwertung der Maschine kommt.
II. Der Mensch als Maschine
Diese vollzieht sich bemerkenswerterweise zunächst in Nietzsches Briefen. Zwischen 1875 und 1888 bezeichnet er in ihnen immer wieder seinen eigenen Leib bzw. sogar sich selbst als „Maschine“ und berichtet von ihrem guten oder schlechten Funktionieren.19 In diesem Sinne spricht er schon in der Morgenröthe in einem rein deskriptiven Sinne vom Leib allgemein als Maschine20 und geht auch dazu über, die Menschheit in neutraler Weise als solche zu titulieren.21 Er knüpft hier offenbar an den naturalistischen Flügel der Aufklärung an, beispielsweise Julien Offray de La Mettries L’homme machine (Der Mensch als Maschine, 1748), im Zuge seines allgemein wachsenden Interesses an naturalistischen Erklärungen menschlichen Verhaltens in jener Periode.
Schon in Menschliches, Allzumenschliches vergleicht Nietzsche in bewundernder Weise die griechische Kultur mit einer rasenden Maschine, deren ungeheures Tempo sie für die kleinsten Störungen anfällig machte.22 Im Nachlass der 1880er Jahre konzipiert Nietzsche dann ebenso unkritisch eine „Darstellung der Maschine ‚Mensch‘“23 und geht dazu über, in der Maschinisierung der Menschheit etwas Gutes zu erblicken:
Die Nothwendigkeit zu erweisen, daß zu einem immer ökonomischeren Verbrauch von Mensch und Menschheit, zu einer immer fester in einander verschlungenen „Maschinerie“ der Interessen und Leistungen eine Gegenbewegung gehört. Ich bezeichne dieselbe als Ausscheidung eines Luxus-Überschusses der Menschheit: in ihr soll eine stärkere Art, ein höherer Typus ans Licht treten, der andre Entstehungs- und andre Erhaltungsbedingungen hat als der Durchschnitts-Mensch. Mein Begriff, mein Gleichniß für diesen Typus ist […] das Wort „Übermensch“.
Auf jenem ersten Wege […] entsteht die Anpassung, die Abflachung, das höhere Chinesenthum, die Instinkt-Bescheidenheit, die Zufriedenheit in der Verkleinerung des Menschen – eine Art Stillstand im Niveau des Menschen. Haben wir erst jene unvermeidlich bevorstehende Wirthschafts-Gesammt-Verwaltung der Erde, dann kann die Menschheit als Maschinerie in deren Diensten ihren besten Sinn finden: als ein ungeheures Räderwerk von immer kleineren, immer feiner „angepaßten“ Rädern; als ein immer wachsendes Überflüssigwerden aller dominirenden und commandirenden Elemente; als ein Ganzes von ungeheurer Kraft, dessen einzelne Faktoren Minimal-Kräfte, Minimal-Werthe darstellen. Im Gegensatz zu dieser Verkleinerung und Anpassung des M<enschen> an eine spezialisirtere Nützlichkeit bedarf es der umgekehrten Bewegung – der Erzeugung des synthetischen, des summirenden, des rechtfertigenden Menschen, für den jene Machinalisirung der Menschheit eine Daseins-Vorausbedingung ist, als ein Untergestell, auf dem er seine höhere Form zu sein sich erfinden kann…
Er braucht ebensosehr die Gegnerschaft der Menge, der „Nivellirten“, das Distanz-Gefühl im Vergleich zu ihnen; er steht auf ihnen, er lebt von ihnen. Diese höhere Form des Aristokratism ist die der Zukunft. – Moralisch geredet, stellt jene Gesammt-Maschinerie, die Solidarität aller Räder, ein maximum in der Ausbeutung des Menschen dar: aber sie setzt solche voraus, derentwegen diese Ausbeutung Sinn hat. Im anderen Falle wäre sie thatsächlich bloß die Gesammt-Verringerung, Werth-Verringerung des Typus Mensch, – ein Rückgangs-Phänomen im größten Stile.
[…] [W]as ich bekämpfe, ist der ökonomische Optimismus: wie als ob mit den wachsenden Unkosten Aller auch der Nutzen Aller nothwendig wachsen müßte. Das Gegentheil scheint mir der Fall: die Unkosten Aller summiren sich zu einem Gesammt-Verlust: der Mensch wird geringer: – so daß man nicht mehr weiß, wozu überhaupt dieser ungeheure Prozeß gedient hat. Ein wozu? ein neues „Wozu!“ – das ist es, was die Menschheit nöthig hat…24
Im Sinne der auch im veröffentlichten Werk wiederholt diskutierten Vorstellung eines – erhofften – Umschlags von Nivellierung in eine neue Aristokratie25 hält Nietzsche nun an seiner früheren Kritik der Maschisierung zwar fest, doch erhofft sich von ihr zugleich die Geburt einer neuen Klasse von „Übermenschen“, die souverän über die „Heerde“ der Maschine gänzlich unterworfener Sklaven gebieten. Im Antichrist spricht er diese politische ‚Utopie‘ deutlich aus und begründet sie naturalistisch: „Dass man ein öffentlicher Nutzen ist, ein Rad, eine Funktion, dazu giebt es eine Naturbestimmung: nicht die Gesellschaft, die Art Glück, deren die Allermeisten bloss fähig sind, macht aus ihnen intelligente Maschinen“26.
Gibt es bereits in Menschliches, Allzumenschliches Aphorismen, in denen die Unterwerfung unter die Maschine zwar nicht apologetisch, aber auch nicht kritisch, sondern rein deskriptiv als ‚Pädagogik‘ beschrieben wird,27 geht er nun vermehrt dazu über diese Subordination, sogar im Fall der Gelehrten, als heilsame Methode gegen das Ressentiment zu empfehlen28 und erblickt in der Maschinisierung großer Teile der Menschheit durch eine kleine ‚Kaste‘ brutaler ‚Raubtiermenschen‘ die Urszene der zivilisatorischen Formung der Menschheit.29
III. Das Genie als Apparat?
Doch Nietzsches Faszination für die Maschine bleibt dabei nicht stehen. Zwar spricht er sich in der Fröhlichen Wissenschaft dagegen aus, die Gesamtheit des Seins als Maschine zu begreifen, doch nicht, weil dies eine Abwertung oder Verdinglichung bedeuten würde, im Gegenteil: „Hüten wir uns schon davor, zu glauben, dass das All eine Maschine sei; es ist gewiss nicht auf Ein Ziel construirt, wir thun ihm mit dem Wort ‚Maschine‘ eine viel zu hohe Ehre an“30. Den menschlichen Intellekt hingegen beschreibt Nietzsche in demselben Buch ganz unkritisch als Maschine31 und ebenso soll nun das menschliche Seelenleben insgesamt als Maschine begriffen werden32. Dies betrifft nun ausgerechnet das seit dem Frühwerk als Inbegriff höchsten authentischen Selbstseins verklärte „Genie“, das Nietzsche ab der Morgenröthe immer wieder mit einer Maschine vergleicht.33 Er spricht in der Götzen-Dämmerung, mit niemand geringerem als Julius Cäsar als Beispiel, gar von „jener subtilen und unter höchstem Druck arbeitenden Maschine, welche Genie heisst“34 und in einem späten Nachlassfragment von ihm als der „sublimste Maschine[n], die es giebt“35.
Die moderne „Natur-Vergewaltigung mit Hülfe der Maschinen und der so unbedenklichen Techniker- und Ingenieur-Erfindsamkeit“36 feiert Nietzsche nun als „Macht und Machtbewusstsein […][,] Hybris und Gottlosigkeit“ (ebd.) und mithin als Gegenpol zur modernen Dekadenz.37 In einem Nachlassfragment von 1887 heißt es sogar:
Die Aufgabe ist, den Menschen möglichst nutzbar <zu> machen, und ihn soweit es irgendwie angeht der unfehlbaren Maschine zu nähern: zu diesem Zwecke muß er mit Maschinen-Tugenden ausgestattet werden (– er muß die Zustände, in welchen er machinal-nutzbar arbeitet, als die höchstwerthigen empfinden lernen: dazu thut noth, daß ihm die anderen möglichst entleidet, möglichst gefährlich und verrufen gemacht werden…)
Hier ist der erste Stein des Anstoßes die Langeweile, die Einförmigkeit, welche alle machinale Thätigkeit mit sich bringt. Diese ertragen zu lernen und nicht nur ertragen, die Langeweile von einem höheren Reize umspielt sehen lernen[.] […] Eine solche Existenz bedarf vielleicht einer philosophischen Rechtfertigung und Verklärung mehr noch als jede andere: die angenehmen Gefühle müssen von irgend einer unfehlbaren Instanz aus überhaupt als niedrigeren Ranges abgewerthet werden; die „Pflicht an sich“, vielleicht sogar das Pathos der Ehrfurcht in Hinsicht auf alles, was unangenehm ist – und diese Forderung als jenseits aller Nützlichkeit, Ergötzlichkeit, Zweckmäßigkeit redend, imperativisch… Die machinale Existenzform als höchste ehrwürdigste Existenzform, sich selbst anbetend.38
Damit ist die Umwertung endgültig vollzogen: Es geht nicht mehr nur darum, einen Sklavenstand von ‚Maschinenmenschen‘ mit Sinne der ‚Höherentwicklung‘ der Gattung zu erzeugen, der eine kleine Gruppe von ‚authentischen‘ Führern gegenüberstehen, sondern alle Menschen sollen gleichermaßen als Rädchen einer großen Gesamtmaschine fungieren, deren Prozess als Selbstzweck bejaht wird. Es kann eigentlich nur noch ein Unterschied zwischen Menschen gemacht werden, die Rädchen sind, und solchen, die selbst in sich geschlossene Maschinen bilden und dadurch zur Herrschaft bestimmt sind. Selbstwerdung als Maschinisierung.
Nietzsche wird damit zum Vordenker eines kybernetischen Technofaschismus, wie ihn bereits Ernst Jünger am Vorabend der ‚Machtergreifung‘ als möglichen Alternativentwurf zum liberalen Humanismus erahnte39 und heute in ‚avantgardefaschistischen‘ Zirkeln40 wieder en vogue ist, aber auch der postmodernistischen Verklärung des „Maschinen-Werdens“ als vermeintliche subversive Praxis, wie sie Gilles Deleuze und Félix Guattari unermüdlich propagieren. Die Utopie des flexiblen Menschen als „Cyborg“41. Es ist geradezu komisch, dass sich sowohl die kritische als auch die affirmative Verwendung der Maschinenmetapher in Nietzsches letzten Schriften gleichermaßen antrifft und bezeugt die Zerrissenheit seines Denkens bzw. seine subjektive Unentschlossenheit.
Bringt man diese letzte Wendung in Nietzsches Denken in Verbindung mit dem Konzept der „ewigen Wiederkunft“, das im endlosen Kreisen der Maschinerie sein handgreifliches Pendant findet,42 auch wenn Nietzsche diese Parallele selbst nicht bemüht, dann offenbart diese Betrachtung den tieferen Grund für Nietzsches ‚Abfall‘: Die wachsende Einsicht in die Strukturdynamik moderner Gesellschaften ließ ihn immer mehr an der Möglichkeit (ver)zweifeln, in ihr Authentizität zu realisieren. Nicht zuletzt, weil er – wie seine erwähnten Briefe bezeugen, die wohl nicht zufällig ganz am Anfang seiner ‚Kehre‘ vom Maschinenstürmer zum -verehrer stehen – erkannte, dass die Maschinisierung der Welt kein bloß äußerliches Geschick, sondern ein inneres Geschehen ist, dem man sich subjektiv nicht zu entziehen vermag. Authentizität ließe sich dann nur als fortwährender Kampf gegen sich selbst realisieren. Damit unzufrieden, bemüht sich Nietzsche nun um die radikale Bejahung der als „ewige Wiederkunft“ mythologisierten Maschinisierung der Welt. Eine Bejahung, die jedoch, wie die Rede von „Höllenmaschine“ in Ecce homo unterstreicht, nur um den Preis der völligen Selbstaufgabe gelingen könnte, handelt es sich doch in seinem Wesen – wie der frühe Nietzsche so glasklar erkannte – um einen menschenfeindlichen Prozess, der die Menschen dazu zwingt, etwas zu bejahen, was sich anders als wahnhaft nicht bejahen lässt.
Der naheliegende Ausweg bestünde eben genau darin, diesen Kampf gegen die innere und äußere Maschinisierung – sowohl im Sinne eines individuellen Heroismus als auch im Sinne politischer ‚Maschinenstürmerei‘ – eben auf sich zu nehmen und die innere Zerrissenheit, die die moderne Lebenswelt den Menschen aufnötigt, zu ertragen. Doch genau darin scheitert Nietzsche, er kann – anders, als von ihm selbst gefordert – diese Spannung nicht aufrechterhalten, muss den „Bogen“ seiner Ethik der Authentizität „abspannen“43 mit Hilfe seiner im Spätwerk immer grotesker, immer realitätsfremder werdenden mythologischen Konstruktionen. Die wahre Herausforderung, die das Authentizitätsideal an die Einzelnen stellt, ist es also, sich die eigene Authentizität in einer von Inauthentizität beherrschten Gesellschaft zu bewahren ohne verrückt zu werden oder der konformistischen Versuchung der Flexibilisierung zu erliegen.
Literatur
Benjamin, Walter: Einbahnstraße. Frankfurt a. M. 1955.
Ders.: Zentralpark. In: Illuminationen. Ausgewählte Schriften. Frankfurt a. M. 1977, S. 230–250.
Haraway, Donna: A Cyborg Manifesto. In: Socialist Review 80 (1985), S. 65–108.
Jünger, Ernst: Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt. Stuttgart 2022.
Stephan, Paul: Die Moderne als Kultur der Ver–gewaltigung. Nietzsche als Kritiker der Gewalt. In: engagée. politisch-philosophische Einmischungen 4 (2016), S. 20-23.
Fußnoten
1: Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten, Vortrag V.
2: Vgl. etwa ebd. und ebd., Vortrag I.
3: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, Abs. 5. Vgl auch Schopenhauer als Erzieher, Abs. 3.
4: Nachgelassene Fragmente Nr. 1880 2[62].
5: Nachgelassene Fragmente Nr. 1879 40[4].
6: Menschliches, Allzumenschliches Bd. II, Der Wanderer und sein Schatten, Aph. 220.
7: Nachgelassene Fragmente Nr. 1880 6[104].
8: Nachgelassene Fragmente Nr. 1887 9[162].
9: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 6.
10: Götzen-Dämmerung, Streifzüge, Aph. 29.
11: Ebd., Aph. 37.
12: Ecce homo, Warum ich so weise bin, Abs. 3.
13: Nachgelassene Fragmente Nr. 1873 29[195].
14: Nachgelassene Fragmente Nr. 1876 23[148].
15: Menschliches, Allzumenschliches Bd. II, Der Wanderer und sein Schatten, Aph. 220.
16: Vgl. ebd., Aph. 280.
17: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. I, Aph. 585.
18: In dieser Phase äußert Nietzsche sogar dezidiert Verständnis für den Unmut der Arbeiter und empfiehlt ihnen seine Ethik der Authentizität als Ausweg aus dem Dilemma an, „entweder Sclave des Staates oder Sclave einer Umsturz-Partei werden zu müssen“ (Morgenröthe, Aph. 206). Solche Gedankenspielen bringen ihn in dieser Zeit in bemerkenswerte Nähe zum Anarchismus (vgl. etwa Morgenröthe, Aph. 179).
19: Vgl. Bf. an Carl von Gersdorff v. 8. 5. 1875, Nr. 443; Bf. an dens. v. 26. 6. 1875, Nr. 457; Bf. an Elisabeth Förster-Nietzsche v. 30. 5. 1879, Nr. 849; Bf. an Heinrich Köselitz v. 14. 8. 1881, Nr. 136; Bf. an Franz Overbeck v. 31. 12. 1882, Nr. 366; Bf. an Malwida von Meysenbug v. 1. 2. 1883, Nr. 371; Bf. an Heinrich Köselitz v. 19. 11. 1886, Nr. 776; Bf. an Franziska Nietzsche v. 5. 3. 1888, Nr. 1003 und Bf. an Franz Overbeck v. 4. 7. 1888, Nr. 1056. Es zeigt sich, dass Nietzsche diese Briefe nicht an ‚irgendwen‘ schreibt, sondern seinen allerintimsten ‚kleinen Kreis‘. An Overbeck schreibt Nietzsche am 14. 11. 1886: „Die Antinomie meiner jetzigen Lage und Existenzform liegt jetzt darin, daß alles das, was ich als philosophus radicalis nöthig habe – Freiheit von Beruf, Weib, Kind, Gesellschaft, Vaterland, Glauben u.s.w. u.s.w. ich als ebensoviele Entbehrungen empfinde, insofern ich glücklicher Weise ein lebendiges Wesen und nicht bloß eine Analysirmaschine und ein Objektivations-Apparat bin“ (Nr. 775). Bemerkenswert ist auch ein Brief an Heinrich Romundt vom 15. 4. 1876, in dem es heißt: „Ich weiß nie, wo ich eigentlich mehr krank bin, wenn ich einmal krank bin, ob als Maschine oder als Maschinist“ (Nr. 521).
20: Vgl. Aph. 86.
21: Vgl. Nachgelassene Fragmente Nr. 1876 21[11].
22: Vgl. Menschliches, Allzumenschliches Bd. I, Aph. 261.
23: Nachgelassene Fragmente Nr. 1884 25[136].
24: Nachgelassene Fragmente Nr. 1887 10[17].
25: Vgl. etwa Jenseits von Gut und Böse, Aph. 242.
26: Abs. 57.
27: Vgl. Bd. I, Aph. 593 und Bd. II, Der Wanderer und sein Schatten, 218.
28: Vgl. Nachgelassene Fragmente 1881 11[31] und Zur Genealogie der Moral, Abs. III, 18.
29: Vgl. ebd., Abs. II, 17.
30: Aph. 109.
32: Vgl. Nachgelassene Fragmente Nr. 1885 2[113] und Der Antichrist, Abs. 14.
33: Vgl. Morgenröthe, Aph. 538; Götzen-Dämmerung, Streifzüge, Aph. 8 und Der Fall Wagner, Abs. 5.
34: Streifzüge, Aph. 31.
35: Nachgelassene Fragmente Nr. 1888 14[133].
36: Zur Genealogie der Moral, Abs. III, 9.
37: Es handelt sich bei dieser Passage um eine der zweideutigsten in Nietzsches Werk. Auf den ersten Blick liegt es nahe, sie als Kritik an der modernen Wissenschaft und Technik zu betrachten (vgl. hierzu auch mein eigener Aufsatz Die Moderne als Kultur der Ver–gewaltigung). Doch der späte Nietzsche verwendet ja „Macht“ und sogar „Vergewaltigung“ in überhaupt keinem kritische Sinne, hält er doch in der Genealogie an anderer Stelle klar fest: „[A]n sich kann natürlich ein Verletzen, Vergewaltigen, Ausbeuten, Vernichten nichts ‚Unrechtes‘ sein, insofern das Leben essentiell, nämlich in seinen Grundfunktionen verletzend, vergewaltigend, ausbeutend, vernichtend fungirt und gar nicht gedacht werden kann ohne diesen Charakter“ (Abs. II, 11). Und in der Passage selbst heißt es: „[S]elbst noch mit dem Maasse der alten Griechen gemessen, nimmt sich unser ganzes modernes Sein, soweit es nicht Schwäche, sondern Macht und Machtbewusstsein ist, wie lauter Hybris und Gottlosigkeit aus“. Nimmt man an, dass sich Nietzsche auch hier noch positiv auf die „alten Griechen“ und ihre Ethik des „Maßes“ bezieht, ist dieser Satz kritisch zu lesen – doch ebenso liegt es nahe, ihn so zu verstehen, dass Nietzsche in den beschriebenen Aspekten der Modernität gerade im Gegenteil „herrenmoralische“ Züge der Moderne erblickt, die ihrem allgemeinen Nihilismus entgegenstehen. Was sollte der erklärte „Antichrist“ auch gegen „Gottlosigkeit“ einzuwenden haben?
38: Nachgelassene Fragmente Nr. 1887 10[11].
39: Vgl. Der Arbeiter.
40: Man denke nur an die entsprechenden Visionen der Milliardäre Elon Musk und Peter Thiel.
41: Vgl. etwa Donna Haraway, A Cyborg Manifesto.
42: Diesen Zusammenhang zwischen „ewiger Wiederkunft“ und Zyklizität der kapitalistischen Ökonomie erkannte bereits Walter Benjamin (vgl. Einbahnstraße, S. 63 & Zentralpark, S. 241–246).
43: Vgl. Jenseits von Gut und Böse, Vorrede.
Im Bann der Maschine
Nietzsches Umwertung der Maschinenmetapher im Spätwerk
In der vergangenen Woche berichtete Emma Schunack von der diesjährigen Jahrestagung der Nietzsche-Gesellschaft zum Thema Nietzsches Technologien (Link). Ergänzend dazu untersucht Paul Stephan in seinem Beitrag in dieser Woche, wie Nietzsche die Maschine als Metapher einsetzt. Der Befund seiner philologischen Tiefenbohrung mitten durch Nietzsches Schriften: Während er in seinen Frühschriften an die romantische Maschinenkritik anknüpft und die Maschine als Bedrohung der Menschlichkeit und Authentizität beschreibt, vollzieht sich ab 1875, zunächst in seinen Briefen, eine überraschende Wendung. Auch wenn Nietzsche noch gelegentlich an die alte Entgegensetzung von Mensch und Maschine anknüpft, beschreibt er sich nun zunächst selbst als Maschine und befürwortet schließlich eine Verschmelzung bis hin zur Identifikation von Subjekt und Apparat sogar, konzipiert Selbst- als Maschinenwerdung. Dies hängt mit der sukzessiven allgemeinen Abkehr Nietzsches von den humanistischen Idealen seiner frühen und mittleren Schaffensperiode und der zunehmenden ‚Verdunkelung‘ seines Denkens zusammen – nicht zuletzt der Entdeckung der Idee der „ewigen Wiederkunft“. Aus einer Kritik der kapitalistischen Gesellschaftsmaschine wird ihre radikale Affirmation – amor fati als amor machinae.
Nietzsche und Cyborgs
Der internationale Nietzsche-Kongress 2025
Nietzsche und Cyborgs
Der internationale Nietzsche-Kongress 2025


Unter dem Thema Nietzsches Technologien wurden in diesem Jahr wieder internationale Besuchende zur Konferenz der Nietzsche-Gesellschaft nach Naumburg an der Saale eingeladen. In der Zeit vom 16. bis zum 19. Oktober gab es neben verschiedenen Vorträgen, einem Film-Screening sowie einem Konzert außerdem eine Kunstausstellung zu besuchen. Unsere Autorin Emma Schunack war vor Ort und berichtet von ihren Eindrücken. Ihre Frage: Wie können Nietzsches Technologien im technologischen Zeitalter Ausdruck finden?
Redaktioneller Hinweis: Nicht erwähnt wird in dem Tagungsbericht die wichtige „Lectio Nietzscheana Naumburgensis“, mit der Werner Stegmaier am Sonntag Vormittag die Tagung abrundete und das Thema der Konferenz nochmal in ganz anderer Weise aufgriff, indem er nach Nietzsches eigenen „Techniken des Philosophierens“ fragte. Wir haben diesen wichtigen Vortrag inzwischen mit freundlicher Erlaubnis des Autors in voller Länge eigens publiziert (Link).
Friedrich Nietzsche selbst verbrachte viele Jahre seiner Kindheit und Jugend in der Stadt an der Saale. Sein Familienhaus steht noch heute im Weingarten 18. 2008 wurde hier die Friedrich-Nietzsche-Stiftung Naumburg gegründet, welche das Nietzsche-Dokumentationszentrum als öffentlich zugängliches Forschungs- und Kulturzentrum betreibt, das auch in diesem Jahr als Veranstaltungsort des Nietzsche-Kongresses dient.
Gelangt man vom Bahnhof zum Kongress, stößt man zunächst auf das ehemalige Familienhaus Nietzsches. Ein von Wein umranktes, verwinkeltes Haus, in dessen Erdgeschoss sich heute ein kleiner Buchladen mit einer Auswahl an Schriften Nietzsches befindet. Geht man nur wenige Schritte weiter, erstreckt sich direkt neben dem historischen Nietzsche-Haus das Dokumentationszentrum als moderner Neubau mit hellen Mauern und großen Fensterfronten. Im Inneren des Gebäudes befinden sich auf drei Etagen lichtdurchflutete Räume, die Platz für eine Bibliothek, ein Archiv, zwei Ausstellungsbereiche und zwei Plenarsäle bieten. In den Fluren stehen Nietzsche-Büsten, an Wänden und Treppen sind immer wieder große Schriftzüge mit Zitaten des Philosophen angebracht.
Die Tagung, geleitet von Edgar Landgraf, Catarina Caetano da Rosa und Johann Szews, beginnt am Donnerstagnachmittag mit verschiedenen Grußworten, unter anderem des Direktors der Friedrich-Nietzsche-Stiftung, Andreas Urs Sommer, sowie dem Vorsitzenden der Nietzsche-Gesellschaft e. V., Marco Brusotti. Die an diesem Wochenende gehaltenen Vorträge zu Nietzsches Technologien sind gegliedert in verschiedene Sektionen, von „Kultur- und Körpertechniken“, „Techniken des 19. Jahrhunderts“ und „Anthropo- und Medientechniken“ über „Techniken der Disziplinierung und Subjektivierung“ bis „Sprachliche und rhetorische Techniken“. So wird der Begriff Technik breit gefasst und bietet Grundlage für verschiedene Auslegungen.

I. Menschliches Denken als Technik
Welche Techniken des Geistes muss der Mensch praktizieren, um wie Nietzsche zu denken? Mit dieser Frage und ihren Implikationen beschäftigt sich Emanuel Seitz, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Basel, in seinem Vortrag Nietzsche, ein Stoiker des Rausches. Die Techniken einer geistigen Übung. Dabei geht es Seitz primär um die Fragen: Was muss ich tun, um Nietzsche zu werden? Kann Nietzsche als Stoiker bezeichnet werden? Zur Beantwortung erläutert Seitz zunächst drei Techniken der geistigen Besinnung der Stoa: die Übung des Denkens, des Begehrens und der Tatkraft. Jene Übungen beziehungsweise Techniken sollen sich erlernen lassen. Sie zielen darauf, sich durch Besinnung eine angemessene Vorstellung vom wahren Wert der Dinge zu machen. Der Mensch soll mithilfe der Übungen zu Werturteilen gelangen, die nicht bloß subjektiv sind, er soll Distanz praktizieren und wie Gott vom Universum nach unten blicken. Durch das Praktizieren jener Techniken des Denkens entsteht eine Art kosmisches Bewusstsein, so lehrt es die Stoa, was zu einer neuen Form der Freiheit im Urteil führe. Erst durch das Praktizieren dieser Übungen sei der Mensch zur Umwertung bestehender Werte befähigt.
Seitz verbindet jene Übungen der Stoa mit Nietzsches eigens gelebter Technik der Philosophie als Lebenskunst, in der es um Taten geht, nicht um Wissen, so Seitz. Er argumentiert, dass Nietzsche zwar zu völlig anderen Ergebnissen kommt als die Stoa, nicht zu einem humanistischen Ideal des Mitleids, sondern zur Selbstzucht und Selbstsucht als Leidenschaft. Nietzsche verachte zwar den Moralismus, beschäftige sich jedoch mit Fragen um den Willen zur kosmischen Gerechtigkeit. Seitz argumentiert daher, dass Nietzsche sehr wohl als Stoiker in Bezug auf die Methode seines Denkens bezeichnet werden könne, ganz im Gegensatz zu den Inhalten seiner Philosophie. Abschließend plädiert er daher ausdrücklich dafür, Nietzsche als Techniker des Denkens ernst zu nehmen.

II. Posthumanistische Perspektiven auf Nietzsche
Passend zu dem diesjährigen Thema des Kongresses beziehen sich einige der Vorträge auf posthumanistische Epistemologie sowie Science und Technology Studies. Besonderen Fokus auf posthumanistische Positionen legt Babeth Nora Roger-Vasselin, die in ihrem Vortrag Einverleibung außer Betrieb. Die Einverleibung als Technik betrachtet Nietzsches Begriff der Einverleibung mit der Figur der Cyborg nach Donna Haraway zu verbinden versucht.
Roger-Vasselin betrachtet Nietzsches Begriff der Einverleibung als Technik der Individuation. So bezeichne Einverleibung, wie ein Organismus seine sinnliche Erfahrung aktiv simuliert, ein gestaltgebender Prozess, den alle Lebewesen teilen. Roger-Vasselin beschreibt diesen Prozess der Einverleibung als Technik, da er nicht natürlich oder uns angeboren sei, stattdessen sei er das Ergebnis einer auf der Individuation beruhenden Erziehung. Bei dieser Technik handele es sich um standardisierte Prozesse durch Formen und Rhythmen.
Doch wie kann jene Technik der Einverleibung im technologischen Zeitalter aussehen? Roger-Vasselin argumentiert in diesem Zusammenhang unter Rückgriff auf die Figur der Cyborg und bezieht sich auf Donna Haraway. Die Cyborg wird von Haraway beschrieben als „ein kybernetischer Organismus, ein Hybrid von Maschine und Organismus, ein Produkt sowohl der sozialen Realität als auch der Einbildungskraft“1, eine Kreatur, die weder natürlich noch künstlich, sondern beides zugleich und nichts allein ist2. Kybernetische Organismen sind für Haraway weder Natur noch Kultur, sondern immer schon Naturkultur3. Konzeptionell lässt Haraway mit der Figur der Cyborg vermeintliche Grenzen zwischen Menschen, Tieren und Maschinen verschwimmen und etabliert ein Denken von Differenz jenseits von Dualismen4: „Eins zu sein ist immer ein gemeinsam-Werden mit vielen“5. Und so spricht sich Roger-Vasselin dafür aus, dass Gemeinschaftsformen im technologischen Zeitalter Kollektive von Cyborgs sein sollten.
Eine weitere posthumanistische Perspektive auf Nietzsche präsentiert Matthäus Leidenfrost in seinem Vortrag Tierhaltung und Zähmung des Menschen. Nietzsche über anthropotechnische Praktiken, in welchem er sich mit dem Verhältnis von Tier, Mensch und Technik bei Nietzsche beschäftigt. Er erörtert, wie Nietzsche selbst den Menschen als krankes Tier bezeichnet habe, welches mit den Werkzeugen der Kultur gezähmt worden sei und sich hinter Kleidung und Moral verberge. In der Herde lebend sei der Mensch defizitär und sei seiner eigenen Anlagen beraubt, so Nietzsche. So leide der Mensch am Leben selbst. An dieser Stelle bezieht sich Leidenfrost auf Peter Sloterdijk, der in diesem Kontext eine Aufforderung an den Menschen formuliert, seine eigene Animalität anzuerkennen und Teil eines offenen bio-kulturellen Seins zu werden. Krankheit ist hier kein starrer Zustand, sie ist Zerfall, aber auch Erkenntnis und Neubeginn, eine Möglichkeit zum Wachstum. Leidenfrost bezieht sich weiter auf aktuelle trans- und posthumanistische Diskurse und auch er verweist an dieser Stelle auf Donna Haraway. Er liest Nietzsches diesbezügliche Überlegungen als eine Einladung an den Menschen, sich im Zeitalter der Perfektion und innerhalb seiner eigenen Domestizierung der eigenen Tierhaftigkeit in einer affektiven Dimension zu öffnen, ganz im Sinne des Endes von Also sprach Zarathustra: „Den wildesten muthigsten Thieren hat er alle ihre Tugenden abgeneidet und abgebraut; so erst wurde er – zum Menschen.“6

III. Ästhetische Erfahrung
Neben den wissenschaftlichen Vorträgen bot der Kongress auch ästhetische Zugänge zu Nietzsches Denken. So wurde die Ausstellung Nietzsches Echo. Bilder der Widersprüche des Malers Conny Gabora eröffnet. Die gezeigten Arbeiten sind von Nietzsche und seinen Gedanken und Lebenskonflikten inspiriert. Sie sollen eine künstlerische Hommage an den Philosophen darstellen. Ferner fand am Freitagabend die deutsche Filmpremiere von Nietzsches Landschaften im Oberengadin von Fabien Jégoudez statt und am Samstagabend gaben die Pianistin Silvia Heyder sowie die Sängerin Julia Preußler ein Konzert, bei dem sie einige ausgewählte von Nietzsches Kompositionen vortrugen. Uns so konnte Nietzsches Denken nicht nur Ausdruck in wissenschaftlicher Form, sondern auch in ästhetischer Erfahrung finden.
IV. Abschluss
Wie können Nietzsches Technologien im technologischen Zeitalter Ausdruck finden? Der Kongress in Naumburg hat gezeigt, wie Nietzsche heute als Techniker des Denkens zu lesen ist, einer Philosophie des Tuns, nicht des bloßen Wissens. Dieses Denken bietet die Grundlage für einen Blick auf den Menschen als ein Wesen, das seine Animalität und seine Einverleibungen anerkennt und sich in Kollektive von Cyborgs und in das offene biokulturelle Geflecht des Seins einschreibt: „Wir sind alle Chimären, theoretisierte und fabrizierte Hybride aus Maschinen und Organismen; in einem Wort, wir sind Cyborgs“7.
Die Photographien stammen von der Autorin. Das Artikelbild zeigt eine Nietzsche-Büste von Fritz Rogge aus dem Jahr 1943 in der ersten Etage des Nietzsche-Dokumentationszentrums.
Literatur
Fink, Dagmar: Cyborg werden: Möglichkeitshorizonte in feministischen Theorien und Science Fictions. Gender Studies. Transcript Verlag.
Haraway, Donna: Die Begegnung der Arten. In: Texte zur Tiertheorie, herausgegeben von Roland Borgards, Esther Köhring und Alexander Kling. Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 19178. Reclam.
Haraway, Donna: Manifestly Haraway. Posthumanities 37. University of Minnesota Press.
Fußnoten
1: „[A] cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as a creature of fiction“ (Haraway, Manifestly Haraway, S. 5; Übersetzung der Redaktion).
2: Vgl. Fink, Cyborg werden: Möglichkeitshorizonte in feministischen Theorien und Science Fictions, S. 9 f.
3: Vgl. ebd. S. 59 f.
4: Vgl. ebd. S.9 f.
5: Haraway, Die Begegnung der Arten, S. 239.
7: „We are all chimeras, theorized and fabricated hybrids of machine and organism; in short, we are cyborgs“ (Haraway, Manifestly Haraway, S. 7; Übersetzung der Redaktion).
Nietzsche und Cyborgs
Der internationale Nietzsche-Kongress 2025
Unter dem Thema Nietzsches Technologien wurden in diesem Jahr wieder internationale Besuchende zur Konferenz der Nietzsche-Gesellschaft nach Naumburg an der Saale eingeladen. In der Zeit vom 16. bis zum 19. Oktober gab es neben verschiedenen Vorträgen, einem Film-Screening sowie einem Konzert außerdem eine Kunstausstellung zu besuchen. Unsere Autorin Emma Schunack war vor Ort und berichtet von ihren Eindrücken. Ihre Frage: Wie können Nietzsches Technologien im technologischen Zeitalter Ausdruck finden?
Redaktioneller Hinweis: Nicht erwähnt wird in dem Tagungsbericht die wichtige „Lectio Nietzscheana Naumburgensis“, mit der Werner Stegmaier am Sonntag Vormittag die Tagung abrundete und das Thema der Konferenz nochmal in ganz anderer Weise aufgriff, indem er nach Nietzsches eigenen „Techniken des Philosophierens“ fragte. Wir haben diesen wichtigen Vortrag inzwischen mit freundlicher Erlaubnis des Autors in voller Länge eigens publiziert (Link).
„Friede mit dem Islam“?
Wanderungen mit Nietzsche durch Glasgows muslimischen Süden: Teil 1
„Friede mit dem Islam“?
Wanderungen mit Nietzsche durch Glasgows muslimischen Süden: Teil 1
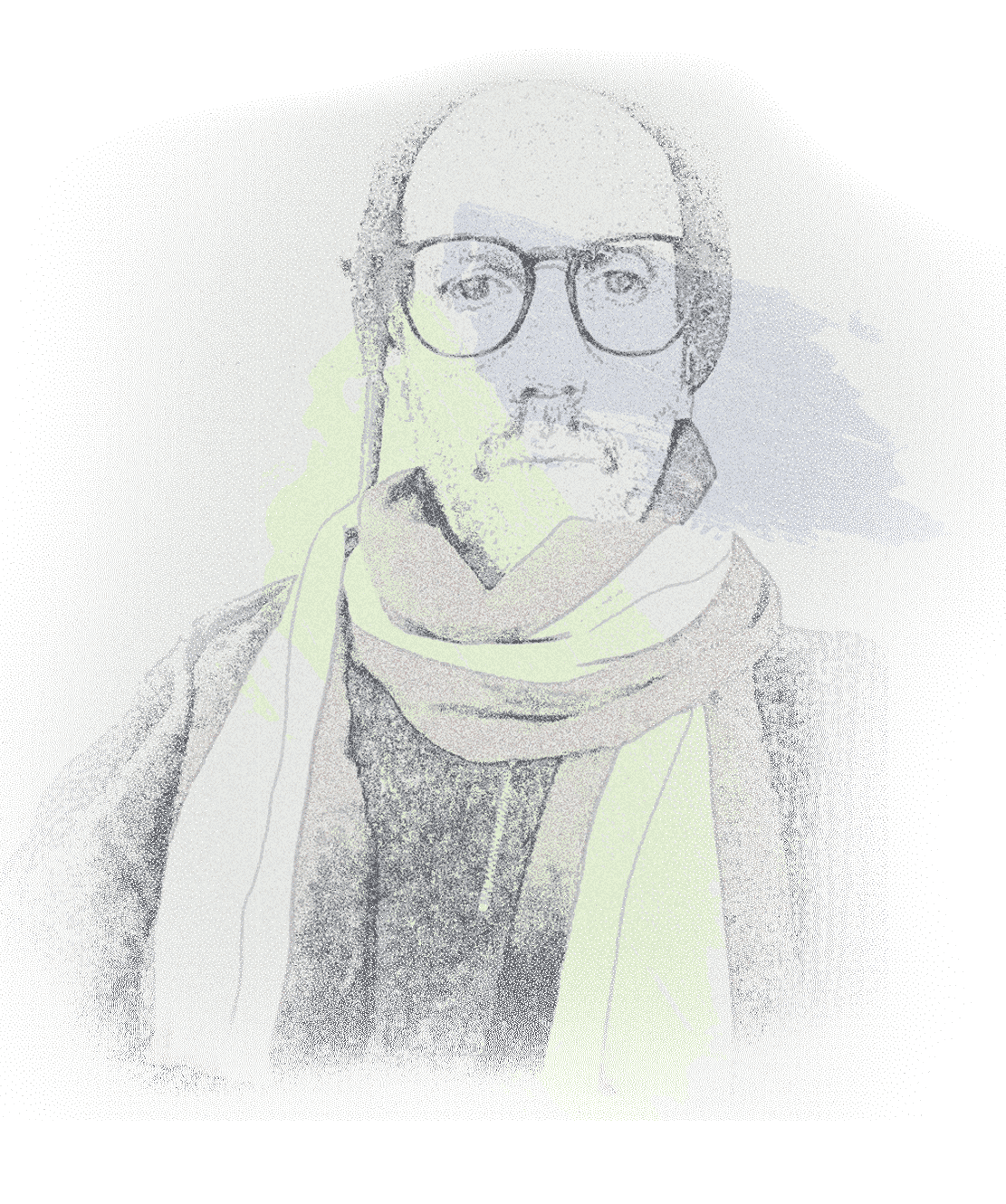

In dem vorerst letzten Beitrag unserer Reihe „Wanderungen mit Nietzsche“ (Link) begibt sich unser Stammautor Henry Holland in eine für die meisten von uns unbekannte Welt. Er begab sich im Spätsommer zu Fuß in den muslimisch geprägten Süden der schottischen Großstadt Glasgow, um dort zwischen Charity-Shops, Moscheen, Buchläden und Restaurants mit den Bewohnern des Viertels ins Gespräch zu kommen und zu erkunden, wie es um den heutigen westlichen Islam bestellt: Wie ticken heutige in Europa lebende Muslime? Wie verstehen sie den Islam? Inwieweit sind sie in die säkulare britische Gesellschaft integriert? Und können Nietzsches Gedanken dabei helfen, ihre Perspektive besser zu verstehen?
Am Anfang seines Zweiteilers gibt Holland zunächst einen kurzen Einblick in den Forschungsstand zu Nietzsches Auseinandersetzung mit dem Islam und seiner Aneignung in der muslimischen Welt. Er berichtet dann über einen Vortrag von Timothy Winter über den französischen Theoretiker und Künstler Pierre Klossowski und dessen Verhältnis zum Bekenntnis Mohammeds. Diese Vorlesung war es, die ihn dazu inspirierte, diese Reise zu unternehmen, die ihn mitten in eines der meistdiskutierten Themen im Europa unserer Gegenwart führte: „Sag, wie hast du’s mit der Religion des Propheten?“ Der Artikel schließt mit dem Beginn seiner Aufzeichnungen.
Aus dem Englischen übersetzt von Lukas Meisner. Zum englischen Originaltext.
I. Vorbereitende Spaziergänge
Ich habe es dem Herausgeber dieses Blogs zu verdanken, dass er, als er nach Essays zu Nietzsches programmatischer Liebe zum Wandern fragte, meinen Vorschlag von Stadtspaziergängen, zu diesem Zeitpunkt noch ungelaufen, unter Muslimen in Südglasgow und evangelikalen Christen in London nicht sogleich zurückwies. Als ich den ersten dieser beiden Spaziergänge unternahm und dessen Reisetagebuch schrieb, erwies sich die islamische Dimension als so faszinierend, dass allein daraus ein zweiteiliger Artikel entstand; die evangelikalen Christen müssen sich damit auf den Seiten meines Notizbuchs gedulden, bis die Zeit für ihre Veröffentlichung reif ist.1
Wie auch andere Nietzsche-Forscher, so weiß mein Herausgeber, dass es zahlreiche Berührungspunkte zwischen Nietzsche und dem Islam gibt, die von denjenigen, die sich beruflich mit dem Philosophen beschäftigen, jedoch gewöhnlich gemieden werden. Ian Almonds hervorragende und kurze Einführung in dieses Feld, die diesen Trend ändern möchte, stellt fest, dass zum Thema im Jahr 2003 „trotz gut über einhundert Referenzen auf den Islam und islamische Kulturen ([den persischen Dichter Hafiz [ca. 1325-1390 u. Z.], Araber, Türken) in der Gesamtausgabe nicht eine einzige Monographie“ existierte.2 Selbst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung konnte Almonds Behauptung eher der Tendenz nach als wörtlich genommen als korrekt gelten. Bereits der Artikel über Nietzsche und den berühmten Poeten Rumi aus dem 13. Jahrhundert, der 1917 vom indisch-muslimischen Philosophen und Dichter Muhammad Iqbal publiziert wurde, stellt eine Studie dar, die sich eingehend mit dem befasst, was der Islam und Nietzsche voneinander gelernt haben. Iqbal verfasste dieses Werk derweil zum Erreichen bestimmter Ziele, nämlich um Nietzsche einem breiteren muslimischen Leserkreis vorzustellen sowie zur Belebung einer antinihilistischen Version des Sufismus.3 Er kann nicht die objektive Vogelperspektive bieten, die Almond mit seinem Beitrag zu fördern versucht. Lobenswert ist, dass Peter Adamson in seiner derzeit achtbändigen Geschichte der Philosophie mehr als 500 Seiten dem Komplex „Philosophie in der islamischen Welt“ widmet. Trotz des totalisierenden Untertitels der Serie – „eine Geschichte ohne jedwede Lücken“ – offenbaren sich gähnende Löcher rund um Nietzsches pulsierendes Werk. Die einzige Referenz, die Adamson bereitstellt, ist Iqbals Bekenntnis zum preußisch aufgewachsenen, später staatenlosen Denker zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wenigstens Roy Ahmad Jacksons Nietzsche and Islam (2007) sollte, seiner Imperfektionen ungeachtet, hier Erwähnung finden, ebenso wie Peter Groffs scharfsinnige Antwort darauf (2010).
Da ich meinerseits eine Ethnografie einer Straße verfassen möchte, die von äußeren Verdächtigungen gesäumt ist, ist es am besten, wenn ich meine Vorbehalte offenlege und meine Position klarstelle. Ich bin ein schottischer weißer Nicht-Muslim; ein Agno-Atheist4, doch unzufrieden damit und daher notorisch flirtend mit dem Glauben, auch wenn meine Wellen des Glaubens in immer kürzeren Abständen zu kommen und zu gehen scheinen. Wie sehr ich mich auch bemühe, ich schaffe es nicht, echte Frömmigkeit auszustrahlen: Wenn ich mich gelegentlich mit Zeugen Jehovas unterhalte, machen sie sich einmal nicht die Mühe, mir ihre Bekehrungsrede zu halten, als würden sie spüren, dass ich reine Zeitverschwendung bin. Seit ich mit viereinhalb Jahren in Edinburgh in die Grundschule kam, blieb der Anteil der Muslime in meiner Klasse in den nächsten sieben Jahren stabil bei etwa fünfundzwanzig Prozent: Shiraz, Asharif, Zahir, Samir und ein einziges Mädchen, Javeria, waren die Menschen hinter dieser Statistik.5 Wir, und ja, die weißen schottischen Kinder fühlten sich wie ein „Wir“, spielten fast täglich mit den muslimischen Jungen auf dem Spielplatz Fußball, wobei die Mannschaften natürlich ausschließlich nach ihren Fähigkeiten ausgewählt wurden, und ich erinnere mich an mindestens eine Einladung zu Zahirs Geburtstagsparty. Aber in den letzten Jahren der Grundschule hatte sich meine Freundesgruppe auf drei oder vier andere nicht-muslimische, weiße schottische Jungen reduziert. Diese unsichtbare Barriere war ebenso sehr durch die Klasse wie durch Religion oder Hautfarbe entstanden. Unsere Schule lag, wo der östliche Rand der neoklassizistischen Neustadt Edinburghs mit ihrer selbstbewussten Mittelschicht auf den westlichen Rand der damaligen Arbeiterviertel Bonnington und Leith traf: Die muslimischen Kinder, die ich kannte, wuchsen größtenteils dort auf, in Arbeiterfamilien. Ich habe heute zu keinem von ihnen mehr Kontakt, aber diesen Menschen habe ich es zu verdanken, dass ich keine Angst vor dem Islam habe. Denn die unaufhörlichen Trommelschläge der extremen Rechten, dass die muslimische Kultur in den kommenden Jahrzehnten die nicht-muslimische Kultur überschwemmen werde – das Geschwätz über Scharia-Diktaturen, die es in Europa angeblich schon gibt, muss ich gar nicht erst wiederholen –, erregen zwar meine Aufmerksamkeit, können mich aber nicht überzeugen.
Bei solchen Kulturkämpfen geht es sicherlich nicht um demografische Fakten, die schwer zu bestreiten sind, sondern um die religiösen Identitäten und die politischen Absichten, mit denen diese Fakten verbunden sind. Wie Ed Husain in seinem Buch Among the Mosques feststellt – einem besorgten Alarmruf eines liberalen Muslims an die Politik über den Zustand des „muslimischen Großbritanniens“ heute –, wuchs die muslimische Bevölkerung Englands in den fünfzehn Jahren bis 2016, in denen die Gesamtbevölkerung Englands um etwa elf Prozent zunahm, fast zehnmal so schnell.6 Die Muslime in Schottland sind zahlenmäßig stärker marginalisiert als im übrigen Großbritannien, da sie etwa einen von 70 Einwohnern ‚Albas‘7 ausmachen, verglichen mit etwa einem von 20 Einwohnern der Gesamtbevölkerung des Vereinigten Königreichs. Dennoch bedeutet die im Vergleich zu nicht-muslimischen Bevölkerungsgruppen höhere Geburtenrate der muslimischen Bevölkerung8, dass die Zahl der Muslime in allen Teilen des Vereinigten Königreichs weiter steigen wird, wobei bis 2031 in einigen Londoner Stadtbezirken und Gebieten von Birmingham, Leicester, Bradford und mehreren anderen englischen Städten eine muslimische Mehrheit erwartet wird.9 In Schottland wird dies erst in einigen Jahrzehnten der Fall sein, aber bereits jetzt ist beispielsweise mehr als jeder vierte Einwohner des Wahlbezirks Pollokshields im Süden von Glasgow ein Moslem.10 Deshalb beschließe ich, meine Wanderung nach Pollokshields und Umgebung zu unternehmen. Diese Reise ist eher durch Statistiken motiviert als durch persönliche Beweggründe. Mein Wunsch, aus erster Hand zu erfahren, wie die Muslime in Glasgow die Welt sehen, verbindet sich mit einer unerwarteten Begegnung auf YouTube und veranlasst mich, den Zug um 9:45 Uhr von Edinburgh Waverly nach Glasgow Queen Street zu nehmen.
II. Lektüre vor der Wanderung
or etwa einem Jahr tauchte in meinem Feed, der wie üblich von reißerischen Überschriften und Indie-Bands der 1990er Jahre geflutet worden war, etwas auf, von dessen Existenz ich bislang nichts wusste: eine aktuelle Keynote-Vorlesung von Prof. Timothy Winter – alias Abdal Hakim Murad – über Pierre Klossowskis „Nietzsche-Interpretation aus einer islamischen Perspektive“. Der Name Klossowski (1905–2001 u. Z.) dürfte denjenigen bekannt vorkommen, die sich wirklich für die französische Theorie begeistern. Als bildender Künstler und Autor trug er in den 1930er Jahren zur avantgardistischen Zeitschrift Acéphale unter der Leitung von Georges Bataille bei (dessen Philosophie in Jenny Kellners POParts-Artikel vorgestellt wurde). Später veranlasste sein 1969 erschienenes Buch Nietzsche und der Circulus vitiosus deus Foucault, Deleuze und andere Größen der Pariser Intellektuellenszene dazu, ihre Haltung gegenüber Nietzsche zu überdenken. Winters Umgang mit dem, was Klossowski und Nietzsche uns und einander erzählen, ist meisterhaft. Er taucht auf ansprechende Weise in das weite Feld der Theorie, des Modernismus, der Religion und der ethnisch geprägten Politik im Globalen Norden und in den kommenden Jahrhunderten ein und überlässt es den intellektuell weniger Begabten, d. h. den meisten von uns, das Kleingedruckte auszubuchstabieren.
In meiner persönlichen Vorstellung des Paris der Deleuze-Ära ist Klossowski eher wegen seiner künstlerischen als wegen seiner philosophischen Genealogie bemerkenswert. Er war der älteste Sohn der Malerin Baladine Klossowska, die den Anhängern der modernen Poesie als letzte Geliebte Rainer Maria Rilkes und Inspirationsquelle für sein spätes Meisterwerk Sonette an Orpheus bekannt ist. Sein jüngerer Bruder war der weitaus bekanntere Maler Balthus, dessen Gemälde heute im MoMA und in der Fondation Beyeler bei Basel hängen; obwohl er erst spät seinen Stil konsolidierte, scheint er seinen Platz im künstlerischen Kanon des 20. Jahrhunderts gefunden zu haben. „Balthus brillanter Bruder“11 muss dagegen noch seinen Platz finden. Obgleich Pierre Klossowski auch als Übersetzer beeindruckend war und die ersten französischen Übersetzungen von Werken Nietzsches, Benjamins und Heideggers verfasste, rangiert er in der Kulturgeschichte nach wie vor meist unter den Fußnoten. Wer ein Spezialist oder Theoretiker mit einer außergewöhnlichen Leidenschaft ist, hat sicher schon von Klossowski gehört; andernfalls gibt es kaum einen Grund, warum man ihn kennen sollte.
Wie Winters weitere Namen vermuten lassen, ist er zum Islam konvertiert; er hat sein gesamtes Erwachsenenleben in diesem Glauben verbracht: 1979 wurde er im Alter von neunzehn Jahren Muslim. Auch Klossowskis Konversion zum Islam im hohen Alter wird von Winter erwähnt; er beschreibt sie als „ein zweideutiges Ereignis, auch wenn es von seinem Bruder Balthus explizit bezeugt wird“.12 Es ist hierbei wichtig zu berücksichtigen, dass Ambiguität in Winters ikonoklastischer Sichtweise auf politische und religiöse aktuelle Ereignisse eine stark positive Konnotation hat. Aussagekräftiger als die Details von Klossowskis persönlichem Glauben sei, was er bezüglich der „Pathologie der modernen Subjektivität“ zu bieten habe, „entliehen zu einem hohen Grad einer ungewöhnlichen Vermählung von Nietzsche und der Heiligen Teresa von Ávila [1515-1582 u. Z.]“.13 Von hier aus wendet sich Winter dem zu, was viele Menschen im Westen als fast unheilbare Wunde und Verlust empfinden – und zeigt auf, wie Klossowski dabei helfen könnte, diese Wunde neu zu empfinden und zu denken. Er bedient sich dabei der Antinomien des Apollinischen und des Dionysischen, deren aus den Fugen geratenes Gleichgewicht Nietzsche in Die Geburt der Tragödie beklagt, und beruft sich auf die „höchst originelle Deutung“, welche Klossowski „Nietzsches Erfahrung der ewigen Wiederkunft“ gebe.14 Winters Diagnose der okzidentalen Malaise lohnt ein längeres Zitat:
Die Nativisten schlagen Alarm: In ganz Europa sind die Geburtenraten der Einheimischen im freien Fall. Wir dürfen dieses Phänomen als „Biopause“ bezeichnen, eine Entwicklung, die in zwei Schritten zu erfolgen scheint. Zuerst unterbricht die postindustrielle, sich säkularisierende Menschheit gewaltsam ihre Symbiose mit den Gliedern der Natur, was ihren rapiden Zusammenbruch bewirkt. Darauf folgt dann die Abkehr der Menschheit selbst von ihrer eigenen Reproduktion. Zerronnen ist die Hoffnung ihrer kalifornischen Vorreiter, die sexuelle Revolution der 1960er Jahre mit einer spirituellen zu verbinden, sie zu sakralisieren. Sie hat schlicht und ergreifend zu einer herabgesunkenen, zukunftslosen Triebhaftigkeit geführt. Das augustinische Ideal einer Fortpflanzung ohne Begehren wurde in sein genaues Gegenteil verkehrt. […] Eine ganze Flotte labiler Archen segelt diesem Europa der Biopause entgegen. An Bord sind Einwanderer, die meist das Mal Ismaels und Hagars tragen, dieser archetypischen Exilanten.15 Diese neuen Europäer legen nicht nur, was ihre Fertilität angeht, keine Biopause ein, sondern bleiben auch in ihren traditionellen Kulturen verwurzelt. Ihre Religiosität nimmt zu, wie der 15. Arabische Jugendreport16 in diesem Jahr nahelegt oder Michael Robbins vom Arab Barometer,17 der […] sagt, dass Jugendliche im Alter zwischen 18 und 29 Jahren an der Speerspitze einer „Rückkehr zur Religion“, die sich quer durch den Nahen Osten und Nordafrika in den letzten zehn Jahren vollzogen habe, stehen würden. Dem widersetzt sich trotzig Europas „ewige Rückkehr“ zu seiner Dichotomie zwischen Selbst und dem Anderen. Überall auf dem Kontinent schießen neue christlich angehauchten Nationalismen wie Pilze aus dem Boden, wir erleben die Wiederkunft einer chronischen Abwehrreaktion gegen die Semitismen: Apoll gegen Dionysos, das Lineare und Verschlossene gegen das Lebendige und Polymorphe – immer dieselbe Leier der europäischen Selbstdefinition seit den Tagen von Euripides. Doch immer mehr stellen sich James Baldwins Frage: Möchte ich wirklich in ein brennendes Haus integriert werden?18
Leser, die vermuten, dass ich für Winter Schleichwerbung mache, mögen seine Glaubwürdigkeit überprüfen. Engagierte Säkularisten könnten von dem, auf das sie stoßen, beunruhigt sein. Jacob Williams betrachtet Winters als einen zentralen Knotenpunkt „in dem [islamischen] traditionalistischen Netzwerk im Westen“, zusammen mit zwei weiteren Denkern, die ebenfalls zum Islam konvertiert sind: Hamza Yusuf (alias Mark Hanson) und Umar Faruq Abd-Allah (Larry Gene Weinman).19 Williams möchte die Beziehungen dieser Denker „zu unterschiedlichen Strömungen innerhalb des westlichen Denkens“ in ihrer Erklärung und Darstellung des Islam untersuchen und dabei aufzeigen, wie sich diese Denker zur „zur traditionalistischen Schule“ verhalten.20 Diese definiert er, in Übereinstimmung mit dem Mainstream der Forschung, als „westliche esoterische Bewegung, die René Guénon [1886-1951 u. Z.] ins Leben rief und die sich um die Wiedergewinnung einer spirituellen Weisheit bemüht, die sich in allen Religionen finde, doch in der Moderne verloren gegangen sei“21. Julian Strube bestimmt „Traditionalismus“ als einen „Oberbegriff für unterschiedliche Autoren, die die Überzeugung eint, dass im Innersten der verschiedenen Traditionen eine ursprüngliche Wahrheit erhalten geblieben ist“. Er untersucht seinerseits die besondere Wendung, die Julius Evola (1898-1974 u. Z.) dem Traditionalismus verlieh. Dieser war, wie zahllose seiner Publikationen belegen, selbst ein begeisterter Nietzscheaner. Strube behauptet, dass der so verstandene Traditionalismus „ein integraler Bestandteil der Neuen Rechten“ seit ihren Anfängen in den 1950er Jahren gewesen sei.22 Evolas berüchtigte politische Ansichten kulminierten etwa in seiner Selbstbezeichnung als „superfascista“23. Aktuelle kritische Forscher sprechen dementsprechend von einer politischen Positionierung Evolas, die „extremer als die offizielle Linie der [italienischen] Faschistischen Partei“ gewesen sei.24 Es wäre jedoch ein unzulässiger Kurzschluss, Winters Politik mit der von Evola gleichzusetzen, und es wäre kontrafaktisch, Winters Weltanschauung als Ablehnung der Moderne abzutun. Im direkten Widerspruch zu Evolas Antidemokratismus verweist Winter auf Forschungen von Sobolewska und anderen, um hervorzuheben, dass, wenn muslimische Einwanderer „die Staatsbürgerschaft erwerben, sie sie im Allgemeinen erstnehmen. Im Vereinigten Königreich erfüllen die [meist muslimischen] Bürger pakistanischer und bangladeschischer Herkunft mit größerer Wahrscheinlichkeit ihre Pflicht, wählen zu gehen, als ihre weißen Landsleute.“24 Ich packe meinen Rucksack für Glasgow und denke weiter über Winters rebellische und aufrichtig vertretene Prophezeiung über die Rolle, die der Islam für Europa und für die Zukunft der Welt spielen wird, nach, wie sie in Ismael und Hagar verkörpert wird.

III. Charity-Shops, Buchläden, Restaurants: Ismael im Albert Drive
Obwohl ich seit ungefähr einem Jahrzehnt zum ersten Mal wieder hier bin, hat Glasgow nichts von seiner Faszination für mich verloren. Es ist der rote Sandstein, aus dem die Stadt seit Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut wurde und der sich in schäbige Mietshäuser, stolze Herrenhäuser im Schottischen Baroniestil und alle möglichen Formen von behauenem Stein dazwischen einfügt, der mich nach Worten suchen lässt, die ich als biblisch bezeichnen möchte: „Habt ihr Augen und seht nicht?“26 Hätte das Schicksal andere Pläne für mich gehabt statt der Erziehung, die ich zwischen der Church of Scotland und den Episkopalen genossen habe, würde ich eine solche Sprache vielleicht als koranisch bezeichnen wollen. Nietzsche stellte sich in einem Brief an seine Schwester vom 11. Juni 1865 eine ähnliche Was-wäre-wenn-Frage:
Wenn wir von Jugend an geglaubt hätten, daß alles Seelenheil von einem Anderen als Jesus ist, ausfließe, etwa von Muhamed, ist es nicht sicher, daß wir derselben Segnungen theilhaftig geworden wären?27
Ich bin an einem besonders heißen Spätsommertag in Pollockshields unterwegs. Die katholische Kirche St. Albert‘s auf halber Strecke des Albert Drive erinnert an eine verblassende christliche Vergangenheit, aber es ist der heutige Islam, der hier ins Auge sticht. Islamic Relief und Ummah Welfare Trust sind zwei offensichtlich islamische Charity-Shops, an denen man vorbeikommt, wenn man vom Bahnhof Pollockshields East in die Gegend eintaucht. Ein Schild im Fenster des ersten Ladens verkündet: „Annahmestopp für Korane, islamische Texte oder Bilderrahmen in Spendenbeuteln.“ Wie gedruckte Bibeln in christlichen und postchristlichen Milieus kaum noch gefragt sind, steht auch der Islam vor der Herausforderung, eine textbasierte Religion in einem weitgehend post-alphabetisierten Zeitalter zu sein.
Während meinem Schaufensterbummel gehe ich in Gedanken weiter die Worte durch, mit denen ich hoffentlich mit den Bewohnern des Viertels ins Gespräch kommen werde. Wenn es darum geht, sie dazu zu bringen, offen über ihren Glauben und ihren Propheten zu sprechen, hilft es dann, Nietzsche zu erwähnen, eine Persönlichkeit, die für die meisten Menschen in diesen Straßen genauso viel bedeutet wie Leana Deeb für mich?28 Noch unentschlossen, welche Strategie ich wählen soll, sehe ich, dass Ummah Welfare in seinem Schaufenster eine altmodische gedruckte Einführung in den Islam für nur zweieinhalb Pfund anbietet. Ich gehe hinein und frage den Ladenbesitzer nach einem Exemplar. Obwohl uns ein anschließender Anruf beim Eigentümer mitteilt, dass diese Einführung nicht vorrätig ist, kommen wir zumindest ins Gespräch.
Atta Ali ist ein geselliger und gastfreundlicher Mann Anfang dreißig29, der mich sogleich hinaus auf den Bürgersteig führt, weil er spürt, dass ich mich dort beim Plaudern wohler fühle. Atta trägt einen vollen langen Bart und ist in einen Salwar Kamiz gekleidet, über dem er ein dickes, grünes Holzfällerhemd trägt, als würden ihn die – für diese Jahreszeit ungewöhnlichen – 26 Grad vor seinem Laden nicht stören. Er erzählt mir, dass er nur nach Pollockshields kommt, um ehrenamtlich zu arbeiten, aber eigentlich in East Renfrewshire, acht Meilen südlich, aufgewachsen sei. Dieses ist besser bekannt als ein jüdisches Viertel. Er scheint seine religiöse Toleranz signalisieren zu wollen, eine notwendige Vorsichtsmaßnahme vielleicht in einer Zeit, in der Vorwürfe des Antisemitismus gegen Europas Muslime unermüdlich sind. Als ich Winter erwähne, gibt Atta zu, dass er den „literarischen Mut“ des allgegenwärtigen Influencers Sam Harris bewundert, obwohl Harris sich im Internet einen Namen vor allem dadurch gemacht hat, dass er den Islam ernsthaft als das unerträgliche Andere darstellt.30
Atta fragt dann, ob Winter ein „Rückkehrer“ (revert) sei. Verwirrt antworte ich, dass Winter tatsächlich zum Islam konvertiert sei. Atta erklärt mir dann eine mittlerweile populäre theologische Sichtweise: Menschen, die als Kinder oder Erwachsene bewusst zum Islam konvertierten, kehrten lediglich zu dem Glauben zurück, den sie schon immer in sich getragen hätten. „Weißt du, wir waren einmal alle Moslems“, wie Atta es ausdrückt. Von dieser bizarren Behauptung überrascht, frage ich doch nicht weiter nach, obwohl ich natürlich neugierig bin. Wann soll das gewesen sein? Zu Lebzeiten des Propheten (ca. 570-632 u. Z.)? Oder gar schon bevor der Prophet inkarniert wurde?
Atta verbindet diese Tatsache mit dem pakistanischen Erbe der meisten Muslime in Pollockshields und erklärt, dass dieses Erbe überwiegend sunnitisch geprägt ist.31 Er ist nicht mit schiitischen Muslimen oder Muslimen anderer „Sekten“ befreundet, sagt aber, dass Schiiten in den örtlichen Moscheen zum Beten kämen, darunter auch in derjenigen, die hundert Meter weiter in einer Seitenstraße liege, und einfach nicht bekannt gäben, dass sie Schiiten seien. Nach dem Gebet zögen sie sich an und gingen leise, um Konflikte zu vermeiden. Attas Verwendung des Begriffs „Sekten“ macht mich auf etwas aufmerksam, das ich bei der Vorbereitung meiner Feldforschung hätte berücksichtigen sollen. Im Gegensatz zu der Art und Weise, wie Christen des 21. Jahrhunderts oft andere Kirchen und Konfessionen wahrnehmen, betrachten die meisten sunnitischen Muslime, ob in Glasgow oder weltweit, Schiiten, Sufis oder andere muslimische Minderheiten nicht als gleichberechtigte Glaubensgenossen, die Respekt verdienen, sondern als Ketzer. Heute können sie im Vereinigten Königreich zwar weitgehend in Frieden ihre alternativen Glaubenspraktiken und Theologien ausüben, aber sie werden in ökumenischen Debatten nicht als gleichberechtigte Partner angesehen.
Ein zu enger Fokus auf islaminternes Sektierertum jedoch würde die andere jüngere und von Fanatismus geprägte Geschichte Glasgows außer Acht lassen. Ich erinnere mich sofort an den antikatholischen Hass in der Stadt in den 1980er Jahren, als mein Bruder und ich noch Kinder waren, und der noch lange danach anhielt. Obwohl mein Bruder in Edinburgh lebte, bloß einen Steinwurf vom Epizentrum dieser Feindseligkeiten entfernt, war er dennoch Fan der Glasgow Rangers, einem Verein, der sein Weltbild auf protestantischem Isolationismus gründet, und bekam regelmäßig Tickets für dessen Heimspiele im Ibrox Stadium. Schon mit dreizehn Jahren war er kritisch genug, um die Lieder, die er dort hörte, nicht gut zu finden, aber natürlich beeindruckten sie ihn: rohe, emotionale Erscheinungen, eine Art besonders brutaler Wille zur Macht. Bis in die 1990er Jahre hinein hörten wir, wenn Robert mich mitnahm, wie Rangers-Fans provokante bis diffamierende Lieder über Bobby Sands sangen – das IRA-Mitglied, das 1981 im Alter von 27 Jahren nach einem 66-tägigen Hungerstreik im Gefängnis starb. Jim Slaven und Maureen McBride, zwei Mitglieder eines Teams von Soziologen, die sich mit Rassismus in Schottland befasst haben, lehnen sogar den „Begriff des ‚Sektierertums‘“ ab, um ein solches Verhalten zu verstehen, denn er
impliziert eine falsche Äquivalenz zwischen den Verhaltensweisen von Protestanten und Katholiken. Beide [Slaven und McBride] kommen darin überein, dass es hier in Wahrheit um Rassismus geht, der sich gegen Menschen von irisch-katholischer Abstammung richtet, und das dieser eine genuin schottische Entwicklung war und keine, die vom britischen Staat aufgezwungen worden wäre.32
Die Augustsonne ist zu stark, als dass ich mich mit dieser unrühmlichen Vergangenheit beschäftigen könnte. Zudem bekomme ich langsam Hunger. Das Café Reeshah in der 455 Shields Road hält sein Versprechen, „authentische asiatische Küche“ zu servieren – in diesem Fall authentische Küche aus Lahore, aus dem pakistanischen Teil des Punjab.33 Im Innenbereich schaffe ich es, den einen von zwei Tisch zu ergattern, der nicht in der Sonne steht; dort versuche ich, den riesigen Teller mit Gemüse-Pakora, der mir serviert wird und offiziell eine „Vorspeise“ ist, als Omen zu verstehen. Nietzsche war so sehr Chronist seiner eigenen Ernährung, insbesondere in Briefen und unveröffentlichten Notizen, dass unorthodoxe Gelehrte behaupten, seine implizite Ernährungsphilosophie könne bisher verborgene Bereiche seines Werks erschließen. Wenn man diese Fragmente erneut liest, tendieren sie eher Richtung Komik als Richtung universelle Magen-Gesetze, vor allem in Anbetracht des drängenden Bewusstseins, das Nietzsche dafür hatte, was ihn seine Café-Mahlzeiten kosteten. Als er im April 1881 aus Italien seiner Mutter und seiner Schwester in Deutschland Bericht erstattet, schwärmt der Essens-Guru:
Die Genueser Küche ist für mich gemacht. Werdet Ihr’s mir glauben, daß ich jetzt 5 Monate fast alle Tage Kaldaunen gegessen habe? Es ist von allem Fleische das Verdaulichste und Leichteste, und billiger; auch die Fischchen aller Art, aus den Volksküchen, thun mir gut. Aber gar kein Risotto, keine Makkaroni bis jetzt! So veränderlich ist es mit der Diät nach Ort und Klima!34

IV. Frittierte Fülle und Wortwörtlichkeit
Angesichts des Chana Masala, dem Kichererbsen-Curry, das in der Folge ebenso großzügig wie das Pakora serviert wird, möchte ich behaupten, dass die „Küche Glasgows“ wie für mich gemacht ist – mit ihrer frittierten Fülle und ihrem globalen Diaspora-Internationalismus. Später freue ich mich, zu entdecken, dass es etwas weiter südlich im Queen‘s Park einen Halal-Fish-and-Chips-Laden gibt. Was den Besitzer und die Mitarbeiter des Café Reeshah angeht, deutet nichts darauf hin, dass diese Männer in den Fünfzigern nicht auch Muslime sind. Aber sie kleiden sich westlich und zeigen keine Anzeichen dafür, dass sie sich an die wortgetreuen Grundsätze halten, denen Atta von Ummah Welfare die Treue schwört.
Ed Hussain kommt zu dem Schluss, dass wörtliche Auslegungen des Korans und der Hadithe35 heute die Lebensentscheidungen britischer Muslime dominieren – und dass das im Großbritannien des 21. Jahrhunderts am häufigsten zitierte Hadith-Kompendium möglicherweise das von Muhammad al-Bukhārī aus dem 9. Jahrhundert ist . Bärte wachsen von selbst, während wortgetreue Muslime auch von der Lehre des zweiten Kalifen, Omar (reg. 634–644 u. Z.), beeinflusst seien, dass Bärte nur einmal im Jahr getrimmt werden sollten.36 Gesichtsbehaarung an sich kann keinen Schaden anrichten, andere Formen des Literalismus hingegen schon. Al-Bukhārī überliefert ein Frage-Antwort-Gespräch zwischen dem Propheten und einer Gruppe ungenannter Gesprächspartner, in dem der Prophet berichtet, dass „die Mehrheit“ der Bewohner des ihm gezeigten „Höllenfeuers“ „undankbare Frauen“ seien. Von seinen Zuhörern zu weiteren Angaben über „widerborstige Weiber“ gedrängt, lässt al-Bukhārī sogar die Frauen unter seinen Zuhörern Mohammed zustimmen, dass „die Aussage einer Frau nur halb so viel zählt wie die eines Mannes“, wobei Mohammed erklärt, dass dies „aufgrund der Unzulänglichkeit des Verstandes einer Frau“ der Fall sei.37 Saqib Qureshi bezeichnet diese „grassierende Misogynie“ in seinem jüngsten muslimischen Beitrag Reclaiming the Faith from Orthodoxy and Islamophobia als ein Konzept, das „dem Koran völlig fremd“ sei.38 Mit solchen Argumenten verbündet sich Qureshi mit einer Minderheit von Intellektuellen am Oxford Institute for British Islam, die für „einen progressiven und pluralistischen muslimischen Glauben, der ausschließlich auf der Souveränität des Heiligen Koran basiert“, eintreten.39
Paigham Mustafa, ein Moslem aus Glasgow und Mitglied des Oxford Institute, musste fast ein Vierteljahrhundert lang extreme Gewaltandrohungen erdulden, weil er öffentlich diesen koranzentrierten Weg eingeschlagen hatte. Nachdem er Artikel veröffentlicht hatte, in denen er die Lehren der Moscheen in Frage stellte, erließ ein Ausschuss, der zwölf Moscheen in Glasgow vertrat, 2001 eine Fatwa gegen ihn. Das Dokument enthielt zwar keine explizite Todesdrohung, verglich Mustafa jedoch mit Salman Rushdie und stachelte damit zu schwerer Gewalt gegen ihn an.40 Mustafa, offensichtlich ein unorthodoxer Freigeist, der sich von der Drohung der Geistlichen nicht einschüchtern ließ, schrieb 2018 in einem auf Facebook veröffentlichten Brief über den Ramadan: „Entgegen der populären Praxis wird rituelles Fasten vom Koran nicht geboten.“41 Mögen Pakoras noch lange zu jeder möglichen Stunde genossen werden. Bevor ich das Café Reeshah verlasse, unterhalte ich mich mit seinem Chef, und wir finden eine gemeinsame Gesprächsgrundlage in den indischen und später pakistanischen Orten, in denen mein Urgroßvater und meine Großeltern jahrzehntelang gelebt und gearbeitet haben, und wo mein Vater geboren wurde: Lahore, Peshawar, Quetta. Was die Nachkommen der Kolonisierten und die Nachkommen der Kolonialisten verbindet und was sie trennt, ist ein und dasselbe.
Da ich mich mit islamischer Theologie bei Weitem nicht gut genug auskenne, um ihre Feinheiten eigenständig zu diskutieren, entscheide ich mich für einen journalistischen Ansatz und gebe meinem jeweiligen Interviewpartner den Raum, ohne Vorurteile zu sagen, was er wirklich denkt. In der Hoffnung, dass mir dies in der selbstbewusst „Islamic Academy of Scotland“ genannten Einrichtung am Maxwell Drive, nur wenige Minuten vom Café Reeshah entfernt, von Nutzen sein könnte, mache ich mich auf den Weg dorthin. Ich bewundere den kunstvollen viktorianischen Eingangsbogen des ehemaligen Pollockshields Bowling Club, aber als ich feststelle, dass die tristen Fertigbauten, in denen die Akademie untergebracht ist, geschlossen sind, kehre ich zum Madni Islamic Book Shop in der Maxwell Road zurück. Neben Brautkleidern und Lifestyle-Accessoires bietet der freundliche Ladenbesitzer dort Literatur in grellen Farben an, die mich an katholische Andachtshefte erinnert. Mir wird etwas mulmig. Ich entscheide mich für Understanding Islam von Maulana Khalid und Sayfulla Rahmani, das sich auf die islamischen Farben Grün und Weiß beschränkt. Als ich bezahlen will, legt der Verkäufer mir noch einen weiteren Brief Illustrated Guide kostenlos dazu. Auf dem Cover sind eine Million Muslime zu sehen, die sich nachts zum Gebet in der Masjid al-Haram, der großen Moschee von Mekka, versammelt haben – die Gläubigen leuchten in fluoreszierenden Farben. Am Sternenhimmel über ihnen strahlt ein fliegender Koran eine Milchstraße aus Licht aus, die unseren Globus umspannt, der sich, entgegen der Intuition, groß über den Menschenmassen und den Hochhäusern der Stadt dreht.
Auch meine beiden anderen Einkäufe vermitteln eine Botschaft, die sich deutlich von dem liberalen und unorthodoxen Islam unterscheidet, mit dem ich mich auf meine Reise vorbereitet habe. Mein Blick fällt auf The Need for Creed – Jinn: Beings of Fire. Diese populäre Dämonologie ist auf dickem Karton gedruckt und in überlangen Reimpaaren geschrieben, die nicht in Versfüße gegliedert sind. Illustriert mit kitschigen KI-Grafiken, verkündet es eine seltsame Theologie: „Dschinns sind sehr hochentwickelt und waren vor uns auf der Erde, doch sie bereiten Harm, / sie führen ein Parallelleben und hängen unterschiedlichen Religionen an – manche auch dem Islam“.42 Eher bedrohlich als nur seltsam ist der Titel Emergence of Dajjal: The Jewish King, eine schmale, groß gedruckte Abhandlung, in der Kapitelüberschriften wie „Die Auslöschung der Juden“ unmissverständlich machen, gegen wen sie sich richtet.43 Diese apokalyptische Literatur in Großdruck handelt von Imam Mahdi, einer Schlüsselfigur der Endzeit, von der jedoch die schiitischen und sunnitischen Muslimen ein völlig unterschiedliches Verständnis haben. Erst später erfahre ich, dass vergleichende Religionswissenschaftler Dajjal in einer groben Entsprechung zum Antichristen der christlichen Tradition sehen, und wundere mich erneut über die Zufälle, die mir meine Reise beschert hat. Ich schlüpfe in die Rolle eines Detektivs, um dieses Belegstück zu erhalten – am besten, ohne den Ladenbesitzer allzu direkt auf seinen Inhalt anzusprechen. Unaufgefordert erzählt er mir, als ich diesen Titel (für 3,50 Pfund) kaufe, dass sie als Kinder in der Elfenbeinküste oft Geschichten über Dajjal gehört hätten, dessen arabischer Name übersetzt „der Betrüger“ bedeutet.

V. Den Glauben bewahren, ungeachtet der Gewalt, die einem entgegengebracht wird
The Jewish King ist die Art antisemitischer Literatur, die sich überhaupt nicht darum bemüht, sich zu verklausulieren. Beiläufiger Antisemitismus unter den Muslimen in Glasgow und Großbritannien ist heute wahrscheinlich genauso verbreitet wie beiläufiger Antisemitismus unter den Christen Europas über Jahrhunderte hinweg bis zur zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Als ich am späten Nachmittag am St. Aloysius College, der Jesuitenschule im Zentrum von Glasgow, vorbeispaziere, kommt mir das Bild in den Sinn, dass die Muslime des 21. Jahrhunderts in Glasgow die Überlegenheit ihres Glaubens ebenso wenig in Frage stellen wie die Jesuitenpatres, die die Schule in den 1860er Jahren an ihrem heutigen Standort gründeten, diejenige des ihrigen. Wenn jedoch säkulare europäische Intellektuelle in den 2020er Jahren darauf bestehen, dass Antisemitismus für Muslime und in der islamischen Kultur tonangebend sei, verschließen sie bewusst mindestens ein Auge. Saqib Qureshi zeigt brillant, dass Muslime in der globalen Geschichte des Antisemitismus nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben.
Während des gesamten Mittelalters und der frühen Neuzeit unterstützten Kirchenführer theologisch die antijüdische Politik, die mit Zwangsmassenbekehrungen, Vertreibungen, Morden und andere Gräueltaten durchgesetzt wurde. Von 1347 bis 1349 wurden Juden in ganz Europa verfolgt und verbrannt, nachdem sie beschuldigt worden waren, durch die Vergiftung von Brunnenwasser die Pest verursacht zu haben; viele Bekehrungen begleiteten diese tödlichen Szenen, sowohl „erzwungene als auch ‚freiwillige‘“44. Als sich die antijüdische Gewalt auch auf Spanien ausbreitete, wurden Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts bis zu einem Drittel der Juden dieses Landes getötet und bis zur Hälfte zwangsweise konvertiert.45 Die genauen Zahlen sind umstritten, aber jüdische Augenzeugenberichte, wie der von Reuven Gerundi, der die Massaker von 1391 überlebte und angab, dass 140.000 Juden in deren Folge zwangsweise konvertiert wurden, müssen ernst genommen werden.46 Der Historiker David Nirenberg argumentiert, ohne notwendigerweise die Genauigkeit dieser Zahlen zu akzeptieren, dass die „massenhaften Konversionen“ von Juden auf der Iberischen Halbinsel in dieser Zeit in erster Linie Menschen betrafen, die „durch den Einsatz von [christlicher] Gewalt“ wurden, und dass diese Gewalt „die religiöse Demographie [der Region] verändert habe“.47
Qureshi stellt dieses blutige Erbe den „so gut wie nicht vorhandenen“ Zwangskonvertierungen gegenüber, die von Muslimen zur Zeit des Propheten und in dem Jahrhundert nach seinem Tod durchgeführt wurden. Qureshi behauptet, es gebe „keinen Beleg dafür, dass Mohammed irgendwen zur Konversion gezwungen habe“, und stützt sich dabei auf die Forschungsergebnisse von Asma Afsaruddin und Heather Keaney, um hinzuzufügen, dass bis zum Jahr 750 u. Z. „weniger als zehn Prozent der nichtarabischen Bevölkerung“, die vom entstehenden Islamischen Reich unterjocht worden war, zu der damals neuen Religion konvertiert war.48 Dieser Standpunkt wird von Sarah Stroumsa unterstützt, die „Zwangsbekehrungen“ im mittelalterlichen Islam als „nicht die Regel, sondern eine seltene Ausnahme“ bezeichnet.49 Wie Qureshi betont, ist es „amüsant und seltsam“, dass die allgemeine Meinung Zwangsbekehrungen in erster Linie mit dem Islam in Verbindung bringt, während es die christlich geprägte spanische Inquisition (1478–1834 u. Z.) war, die die größte gewaltsame Bekehrungskampagne in der Geschichte der Menschheit darstellt.50 Viele Belege deuten darauf hin, dass sowohl Juden als auch Muslime massiv unter dieser Gewalt gelitten haben. Trotzdem weigerten sich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Zwangskonvertierten, ihren alten Glauben aufzugeben, und praktizierten mit geschickten Ausflüchten weiterhin eine Art Krypto-Judentum und einen Krypto-Islam.51
Diese Geschichte enthält eine Allegorie, die lautstark Gehör verlangt. So sehr Populisten und Rechtsextreme auch antimuslimische Ressentiments schüren und ein Maß an Assimilation fordern, von dem sie selbst wissen, dass es nicht erreicht werden kann, reagieren die muslimischen Bevölkerungsgruppen in Pollockshields, Madrid oder Leipzig nicht damit, dass sie zum Säkularismus konvertieren oder ihre Koffer packen und wegziehen. Angesichts der vorsätzlichen Taubheit einiger politischer Führer muss wiederholt werden: Muslime betrachten Pollockshields und ähnliche Orte zu Recht als ihre Heimat. Im abschließenden Teil dieses Essays wenden wir uns Nietzsches überraschender Auseinandersetzung mit dem Islam und Pierre Klossowskis künstlerischen und muslimischen Reaktionen darauf zu. Jenseits der Lebendigkeit des roten Sandsteins und der von Möwen frequentierten Bürgersteige erinnert hier vieles daran, dass Heimat nicht zuletzt ein intellektueller, spiritueller und für manche ein Ort stolzer Religiosität ist, der nicht getrennt von rein physischen Gebieten existiert, sondern diese erweitert.
Alle Bilder sind Fotos des Autors. Das Titelbild zeigt das Schaufenster des Islamic Relief Shops im Albert Drive.
Bibliographie
Adamson, Peter: Philosophy in the Islamic World: A history of philosophy without any gaps, Volume 3, Oxford University Press: 2018.
Afsaruddin, Asma: The First Muslims: History and Memory. Oneworld, Kindle: 2013.
Almond, Ian: ‘Nietzsche’s Peace with Islam: My Enemy’s Enemy is my Friend’. In: German Life and Letters 56, no. 1 (2003), 43-55.
Ames, Christine: Christian Violence against Heretics, Jews and Muslims. In: M. S. Gordon, R. W. Kaeuper & H. Zurndorfer (Hg.): The Cambridge World History of Violence, II, 500–1500. Cambridge University Press: 2020.
Davidson, Neil & Satnam Virdee: Introduction. In: Understanding Racism in Scotland (hg. v. Davidson and Virdee). Luath: 2018.
Elshayyal, Khadijah: Scottish Muslims in numbers: Understanding Scotland’s Muslim population through the 2011 census. Alwaleed Centre for the Study of Islam in the Contemporary World, University of Edinburgh: 2016.
Friedmann, Yohanan: Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition. Cambridge University Press: 2003.
Groff, Peter: Nietzsche and Islam [Besprechung von Nietzsche and Islam von Roy Jackson]. In: Philosophy East & West Volume 60, Number 3, July 2010.
Harvey, Leonard. P: Fatwas in Early Modern Spain. In: The Times Literary Supplement,
26.02.2006, Antwort auf Trevor J. Dadson: The Moors of La Mancha. In: The Times Literary Supplement, 10.02.2006.
Hopkin, Peter (Hg.): Scotland’s Muslims Society: Politics and Identity. Edinburgh University Press: 2017.
Husain, Ed: Among the Mosques: A Journey Around Muslim Britain. Bloomsbury: 2021.
Jackson, Roy: Nietzsche and Islam. Routledge: 2007.
Keaney, Heather N.: ‘Uthman ibn ‘Affan’: Legend or Liability? Oneworld Publications, Kindle: 2021.
Klossowski, Pierre: Nietzsche and the Vicious Circle, übersetzt & eingeleitet von Daniel Smith, University of Chicago: 1997.
Klossowski, Pierre: Nietzsche und der Circulus vitiosus deus. Übers. v. Ronald Vouillé. Matthes & Seitz: 1986.
Klossowski, Pierre: Der Baphomet, übers. v. Gerhard Goebel. Rowohlt: 1987.
Netanyahu, Benzion: The Origins of the Inquisition in Fifteenth Century Spain. Random House: 1995.
Nirenberg, David: Mass conversion and genealogical mentalities: Jews and Christians in fifteenth-century Spain. In: Past & Present 174 (2002), S. 3-41.
Qasmi, Matloob Ahmed: Emergence of Dajjal: The Jewish King. Adam Publishers: 2013 f.
Qureshi, Saqib Iqbal: Being Muslim Today: Reclaiming the Faith from Orthodoxy and Islamophobia. Rowman & Littlefield: 2024.
Robbins, Michael: MENA Youth Lead Return to Religion. In: Arab Barometer, 23.03.2023, https://www.arabbarometer.org/2023/03/mena-youth-lead-return-to-religion/.
Ruby, Ryan: Brilliant Brother of Balthus. In: The New York Review, 08.08.2020, https://www.nybooks.com/online/2020/08/08/pierre-klossowski-brilliant-brother-of-balthus/.
Sobolewska, Maria, Stephen D. Fisher, Anthony F. Heath & David Sanders: Understanding the effects of religious attendance on political participation among ethnic minorities of different religions. In: European Journal of Political Research 54, Nr. 2 (2015), S. 271-287.
Staudenmaier, Peter: Evola’s Afterlives: Esotericism and Politics in the Posthumous
Reception of Julius Evola. In: Aries 25:2 (2025), S. 163-193.
Stroumsa, Sarah: Conversions and Permeability between Religious Communities. In: Schriften des Jüdischen Museums Berlin (2014), S. 32-39.
Strube, Julian: Esotericism, the New Right, and Academic Scholarship. In: Aries 25, 2 (2025), S. 304-353, doi: https://doi.org/10.1163/15700593-02502006.
Swindon, Peter: ‘‘You will get your head chopped off” – Scots Muslim writer threatened by extremists. In: The Herald, 03.06.2018, https://www.heraldscotland.com/news/16266154.you-will-get-head-chopped-off---scots-muslim-writer-threatened-extremists/.
The Pew Research Centre: The future of the global Muslim population. Projections for 2010–2030. In: Population Space and Place, 13(1), (2011), S. 1-221.
Williams, Jacob: Islamic Traditionalists: “Against the Modern World?”. In: Muslim World 113, Nr.. 3 (2023), S. 333-354.
Winter, Timothy: Klossowski’s Reading of Nietzsche From an Islamic Viewpoint. 2025. [Unveröffentlichtes Manuskript, das Winter mit Henry Holland im Oktober 2025 teilte, mit einem Text, der Winters auf YouTube gehaltener Vorlesung ähnelt, aber leicht davon abweicht.]
Yılmaz, Feyzullah: Iqbal, Nietzsche, and Nihilism: Reconstruction of Sufi Cosmology and Revaluation of Sufi Values in Asrar-i-Khudî. In: Open Philosophy 6, (2003), S. 1-20, https://doi.org/10.1515/opphil-2022-0230.
Zaman, Moazzam: The Need for Creed — Jinn: Beings of Fire, Maktaba Dar-Us-Salam: o. J.
Fußnoten
1: Anm. d. Red.: Der zweite Bericht soll im Juni 2026 erscheinen.
2: Ian Almond, Nietzsche’s Peace with Islam, S. 43. Zitate aus englischen Texten wurden von der Redaktion ins Deutsche übersetzt.
3: Zu Iqbal und Nietzsche, s. Feyzullah Yılmaz, Iqbal, Nietzsche, and Nihilism. Zum hier diskutierten 1917er Artikel ad Nietzsche und Rumi s. ebd., S. 4 und 10-13.
4: Dieser unverblümte Neologismus soll meine eigene religiöse Position verdeutlichen: Ich bin zu sehr Atheist, um mich mit dem Titel „Agnostiker“ zu begnügen, bin aber dennoch unbeeindruckt von den Argumenten meines Verstandes für meinen Atheismus. Sie scheinen nur einer Version meines „Selbst“ zu dienen und nicht einer universellen Wahrheit. Daher der Begriff Agno-Atheist.
5: Kinder in Schottland beginnen die Primarschule zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Jahren, abhängig von ihrem Geburtsdatum.
6: Vgl. Husain, Among the Mosques, Introduction.
7: Alba ist das gälische Wort für Schottland, s. Khadijah Elshayyal, Scottish Muslims in numbers, S. 8.
8: Dokumentiert in einer detaillierten Studie, die von Ed Husain als „unparteiisch“ beschrieben wird: The Pew Research Centre, The future of the global Muslim population, S. 15.
9: Vgl. Husain, Among the Mosques, Introduction.
10: Khadijah Elshayyal, Scottish Muslims in numbers, S. 8.
11: S. für mehr Informationen zu Pierre Klossowskis Biographie auch Ryan Ruby, Brilliant Brother of Balthus.
12: Aus Winters YouTube-Vorlesung, 40:16, https://www.youtube.com/watch?v=wC8YJfyOkOY&t=356s.
13: Ebd., 2:46.
14: Aus dem Abriss von Klossowskis engagiertem Verhältnis zu Nietzsche, den Klossowskis Übersetzer Daniel Smith in seiner englischen Übersetzung von dessen Hauptwerk gibt (The Vicious Circle, S. viii).
15: „Die drei großen abrahamitischen Religionen“ kommen darin überein, dass Ismaels der Sohn von Abraham und Hagar ist. Es ist bemerkenswert, dass Hagar, der Torah zufolge, (zunächst) keine Jüdin ist. Sie ist eine „Konkubine“ bzw. Sexsklavin, die Abraham in Ägypten als Magd für seine kinderlose Frau Sarah erworben hatte und die ihm Sarah dann überreichte, damit er mit ihr einen Erben zeugt. Als sie jedoch selbst schwanger wurde, fing Sarah an, Hagar garstig zu behandeln und setzte durch, dass sie mit ihrem kleinen Sohn in die Wüste vertrieben wurde. Dort befahl ihr „der Engel Gottes“, in ihre ägyptische Heimat zurückzukehren, wo sie Ismael aufzog und er zum Stammvater der Araber wird. Diese Bibelstelle (Gen. 16, 1-16 & 21, 8-21) ist eine Basis für Winters Verständnis von Ismaels und Hagars als „Exilanten“. (Vgl. die Einträge zu Hagar und Ismael in der Encyclopaedia Britannica.)
16: Anm. d. Red.: Gemeint ist der Fifteenth Arab Youth Survey, der 2023 von der in Dubai ansässigen Unternehmsberatung ASDA’A BCW durchgeführt wurde (Link).
17: Michael Robbins, MENA Youth Lead Return to Religion.
18: Winter, Klossowski’s Reading, 3:11-5:21.
19: Jacob Williams, Islamic Traditionalists: “Against the Modern World?”, S. 335 f.
20: Ebd., S. 335.
21: Ebd., S. 333.
22: Julian Strube, Esotericism, the New Right, and Academic Scholarship, S. 305.
23: Zit. n. Williams, Islamic Traditionalists, S. 333.
24: Peter Staudenmaier, Evola’s Afterlives: Esotericism and Politics in the Posthumous Reception of Julius Evola, S. 170.
25: Sobolewskas Forschung, wie sie von Winter referiert wird, in einem unpublizierten Manuskript der bereits genannten Videovorlesung, welche Winter im Oktober 2025 freundlicherweise mit mir teilte. Der Text des Manuskripts unterscheidet sich geringfügig vom gesprochenen. S. Timothy Winter, Klossowski’s Reading of Nietzsche From an Islamic Viewpoint, S. 2; vgl. Maria Sobolewska, Stephen D. Fisher, Anthony F. Heath und David Sanders, Understanding the effects of religious attendance on political participation among ethnic minorities of different religions, S. 271-287.
26: Markus 8, 18.
27: Brief Nr. 1865, 469.
28: Deeb ist eine erfolgreiche junge muslimische Influencerin, deren YouTube-Kanal mehr als 1,5 Millionen Abonnenten zählt. Man betrachte etwa ihr Video darüber, „was bei der Oxford-Debatte wirklich passierte“ aus dem Juli 2025 (Link).
29: Ich habe diesen Namen und die Namen mehrerer anderer im Text erwähnter Personen geändert, um ihre Identität zu schützen.
30: In Videodebatten taucht Harris stets prominent auf, etwa mit Titeln wie „Wie man den Islam widerlegt“, https://www.youtube.com/watch?v=PpWN1lOM1fE. Aber seine erfolgreichsten Kritiker, darunter Jonas Čeika, der bereits in POParts vorgestellt wurde (hier und dort), finden zumindest in ihren eigenen Kreisen mehr Gehör mit ihrer Kritik am Szientismus, den sie als Kernstück aller Polemiken von Harris betrachten. Vgl. A Critique of Sam Harris' ‘The Moral Landscape’.
31: Mehr schottische Muslime haben ihre Wurzeln in Pakistan als in irgendeinem anderen Land, s. Scotland’s Muslims Society: Politics and Identity, herausgegeben v. Peter Hopkin, 6 f.
32: Neil Davidson & Satnam Virdee, Introduction, S. 2.
33: Die philosophische Frage der Authentizität, insbesondere in Bezug auf Nietzsche, ist umstritten und komplex. Wir sind dankbar, dass Paul Stephan ihr eine ganze Doktorarbeit gewidmet hat.
34: Aus einer Postkarte an Franziska und Elisabeth Nietzsche, geschrieben am 6. April 1881 (Link).
35: Wörtlich übersetzt bedeutet Hadith „Bericht“ und bezieht sich auf die ursprünglich mündlich überlieferten Geschichten über Mohammed und seinen engsten Kreis, die ein oder zwei Jahrhunderte nach dem Tod des Propheten erstmals in separaten schriftlichen Sammlungen zusammengestellt wurden. Ed Husain erörtert den heutigen Einfluss der Hadithe von Mohammed al-Bukhārī (gestorben 870 u. Z.) in mehreren Abschnitten seines Buches Among the Mosques, darunter auch in Kapitel 1.
36: Ebd., Kapitel 5.
37: Muhammed al-Bukhārī, 52 Witnesses, Sunnah.com, abgerufen am 29. November 2022, http://sunnah.com/bukhari: 2658. Zit. n.: Saqib Iqbal Qureshi, Being Muslim Today, S. 100 f.
38: Ebd., S. 100 f.
39: OIBI website, https://oibi.org.uk/, Zugriff am 1. Oktober 2025.
40: Vgl. Peter Swindon, ”You will get your head chopped off” – Scots Muslim writer threatened by extremists.
41: Musatafa, zitiert nach ebd.
42: Moazzam Zaman, The Need for Creed — Jinn: Beings of Fire, ohne Nummerierung der Seiten.
43: Matloob Ahmed Qasmi, Emergence of Dajjal: The Jewish King, S. 66.
44: Vgl. Christine Ames, Christian Violence against Heretics, Jews and Muslims, S. 476 und 467, Fn. 17.
45: Vgl. Qureshi, Being Muslim Today, S. 214.
46: Vgl. Gerundi, zitiert in David Nirenberg, Mass conversion and genealogical mentalities: Jews and Christians in fifteenth-century Spain, S. 9.
47: Ebd., S. 10 & 3-41.
48: Vgl. Qureshi, Being Muslim Today, S. 216-219; Afsaruddin, The First Muslims: History and Memory, Kapitel „The Age of the Successors“, E-Book Abs. 13.3 und Heather N. Keaney, Uthman ibn ‘Affan: Legend or Liability?, Kapitel „Conquests“, E-Book Abs. 7.30.
49: Sarah Stroumsa, Conversions and Permeability between Religious Communities, S. 34. Dazu, wie sowohl sunnitische als auch schiitische Rechtsschulen Juden, Christen und einigen anderen religiösen Gruppen erlauben, ihre religiöse Identität zu bewahren, indem sie ihnen einen besonderen Schutzstatus gewähren, vgl. Yohanan Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition.
50: Vgl. Qureshi, Being Muslim Today, S 214 f.
51: Das Phänomen des Krypto-Judentums ist ein zentrales Thema in Benzion Netanyahus The Origins of the Inquisition in Fifteenth Century Spain, s. xvi-xviii. Zum Krypto-Islam s. L.P. Harvey, Fatwas in Early Modern Spain.
„Friede mit dem Islam“?
Wanderungen mit Nietzsche durch Glasgows muslimischen Süden: Teil 1
In dem vorerst letzten Beitrag unserer Reihe „Wanderungen mit Nietzsche“ (Link) begibt sich unser Stammautor Henry Holland in eine für die meisten von uns unbekannte Welt. Er begab sich im Spätsommer zu Fuß in den muslimisch geprägten Süden der schottischen Großstadt Glasgow, um dort zwischen Charity-Shops, Moscheen, Buchläden und Restaurants mit den Bewohnern des Viertels ins Gespräch zu kommen und zu erkunden, wie es um den heutigen westlichen Islam bestellt: Wie ticken heutige in Europa lebende Muslime? Wie verstehen sie den Islam? Inwieweit sind sie in die säkulare britische Gesellschaft integriert? Und können Nietzsches Gedanken dabei helfen, ihre Perspektive besser zu verstehen?
Am Anfang seines Zweiteilers gibt Holland zunächst einen kurzen Einblick in den Forschungsstand zu Nietzsches Auseinandersetzung mit dem Islam und seiner Aneignung in der muslimischen Welt. Er berichtet dann über einen Vortrag von Timothy Winter über den französischen Theoretiker und Künstler Pierre Klossowski und dessen Verhältnis zum Bekenntnis Mohammeds. Diese Vorlesung war es, die ihn dazu inspirierte, diese Reise zu unternehmen, die ihn mitten in eines der meistdiskutierten Themen im Europa unserer Gegenwart führte: „Sag, wie hast du’s mit der Religion des Propheten?“ Der Artikel schließt mit dem Beginn seiner Aufzeichnungen.
Aus dem Englischen übersetzt von Lukas Meisner. Zum englischen Originaltext.
Die Barbaren des 21. Jahrhunderts
Narzissmus, Apokalypse und die Abwesenheit des Anderen
Die Barbaren des 21. Jahrhunderts
Narzissmus, Apokalypse und die Abwesenheit des Anderen


Die Diagnose unserer Zeit: keine heroischen Barbaren, sondern Selfie-Krieger. Dieser Essay, den wir mit dem zweiten Platz des diesjährigen Eisvogel-Preises (Link) auszeichneten, spürt Nietzsches Vision der „stärkere[n] Art“1 nach und zeigt, wie sie in einer narzisstisch geprägten Kultur in ihr Gegenteil verkehrt wird – Apokalypse als Pose, der Andere als blinder Fleck. Doch anstelle des großen Bruchs eröffnet sich eine andere Möglichkeit: eine „barbarische Ethik“ der Verweigerung, der Ambivalenz, der Beziehung. Wer sind die wahren Barbaren des 21. Jahrhunderts – und brauchen wir sie überhaupt?
I. Der Barbar als Denkfigur zwischen Kritik und Projektion
Der Begriff des „Barbaren“ ist in der Kultur- und Ideengeschichte eine semantische Scharnierfigur zwischen Abgrenzung und Erwartung, zwischen Identitätsstiftung und transgressivem Wunschdenken. Nietzsche verleiht dem Begriff in seinen späteren Schriften eine zukunftsgerichtete Funktion: Die kommenden Barbaren sollen nicht nur Zerstörer sein, sondern auch Träger einer neuen Stärke, einer regenerativen Kulturmacht. Doch was meint diese Vision, wie lässt sie sich angesichts aktueller gesellschaftlicher, politischer und psychologischer Phänomene wie Populismus, Selbstdarstellungskultur und antiintellektuellen Bewegungen deuten?
Nietzsches oft als prophetisch empfundene Rhetorik birgt eine problematische Tendenz: Die Sehnsucht nach „Überwindung“ der Gegenwart kann selbst Ausdruck von Ohnmacht und mangelnder Adaptationsfähigkeit sein. Das Denken des radikalen Bruchs ersetzt dann die konkrete Kritik und Handlungsmächtigkeit durch eine ästhetisierte Apokalypse. Dies gilt es kritisch zu analysieren.
Der Begriff bárbaros stammt etymologisch aus dem Altgriechischen: „Bar-bar“ imitierte die Sprache der Nicht-Griechen. Der Barbar war somit der sprachlich Fremde, der außerhalb der kulturellen Ordnung stand. Aus dieser sprachlichen Differenz entwickelte sich sukzessive eine moralische und zivilisatorische Wertung: Der Barbar wurde zum Unzivilisierten, zum Bedrohlichen, zum Gegenbild des „Wir“.
In dieser historischen Semantik liegt der Ursprung einer Struktur kollektiver Identitätsbildung durch Abgrenzung. Der Barbar dient als Negativfolie, durch die sich ein kulturelles „Wir“, eine Gruppenidentität, konstituieren kann. Diese Dichotomie zwischen Eigenem und Fremdem, Innen und Außen, zeigt sich bis heute in politischen Diskursen, etwa in nationalistischen, antiintellektuellen und populistischen Bewegungen. Wie Giorgio Agamben und Achille Mbembe bereits analysierten, ist die Figur des Barbaren eine biopolitische Markierung, die Ausschluss organisiert, Gewalt legitimiert und den Ausnahmezustand zum Normalfall macht.2
II. Nietzsche und die Ambivalenz des Barbarischen
Nietzsche stellt den Begriff des Barbaren in einen anderen Zusammenhang. Für ihn ist der Barbar nicht primär der Unterentwickelte, sondern der Ungebrochene. V. a. im Nachlass und in der Genealogie erscheint der Barbar als Träger eines rohen, ungezügelten Willens zur Macht, der der modernen Gesellschaft – durch Moralisierung, Ressentiment und Schwäche – abhandengekommen ist.3 Wer mag da nicht an gegenwärtige Präsidenten und Despoten, aber auch die zelebrierte Selbstdarstellung der eigenen Besonderheit auf Social-Media-Plattformen denken? Diese Barbaren des 21. Jahrhunderts erscheinen einigen von uns als Leitbilder, als Hoffnungsträger – anderen jedoch als Menetekel. Dabei entsteht, gleich, welchem Lager man sich zuordnet, stets eine Dialektik der Abgrenzung.
Doch die Sehnsucht nach einem kulturellen Bruch, nach einer „stärkeren Art“, wird nicht von einer konkreten Theorie der Transformation getragen. Vielmehr flüchtet sie sich (wie bereits Nietzsche) in das Imaginäre des Bruchs, das a priori die tatsächliche politische und kulturelle Arbeit substituiert. Die „Barbaren“ erscheinen als Heilsbringer ex negativo: Ihre Größe ist nicht gestaltet, sondern erhofft. Diese Philosophie der Hoffnung durch Verwerfung ist letztlich ein Zeichen philosophischer Hilflosigkeit, ein apokalyptisches Sich-Sehnen nach dem Anderen. Doch die verwirklichte Dystopie der modernen Barbarei – sichtbar in der Narzisstifizierung der Gesellschaft, in politischen Drohgebärden und im Krieg – ist weder strategisch geplant noch kalkuliert oder erwartet: Sie bricht vielmehr als unvorhersehbare Realität über uns herein, erwächst aus komplexen Dynamiken gesellschaftlicher Entwicklung und eskaliert in Gestalten, die weder politisch noch kulturell in ihrer Tragweite vorausgesehen werden konnten.
III. Die neuen „Barbaren“: Populismus, Narzissmus und Querdenkertum
In der Gegenwart begegnen uns identitätskreierende Zusammenschlüsse, die sich selbst als barbarisch – im Sinne Nietzsches – inszenieren. Die Querdenkerbewegung, Konspiratisten-Gruppierungen oder auch die an ein Helden-Epos glaubende Anhängerschaft eines Trump, Putin und anderer autoritär-populistischer Strömungen stilisieren sich als Widerstand gegen Dekadenz, Eliten, Moderne. Doch sie bleiben in der Logik des Ressentiments gefangen. Was sie kritisieren, ist oft weniger das System, als vielmehr ihre eigene Marginalisierung darin.
Die postmoderne Gesellschaft ist über den Sinnverlust hinaus zunehmend von einer narzisstischen Selbstverliebtheit, die jede Alterität zum Verschwinden bringt, bedroht. Es scheint, als sei die radikale „Barbarei“, die Nietzsche sich erhoffte, nicht eingetreten – stattdessen hat sich eine weichgespülte, performative Variante des Barbaren durchgesetzt: der narzisstische Konsument, der alles Andere seinem Selbstverwirklichungspathos unterordnet.
Nietzsche diagnostizierte eine Kultur, in der die großen Erzählungen versiegen und die transzendentalen Fundamente einstürzen. Er erwartete als Antwort darauf nicht einen Rückzug, sondern eine neue Art Mensch, die sich nicht an Werten orientiert, sondern Werte setzt. Heute sehen wir das Gegenteil: Die spätmoderne Gesellschaft ist von einem Willen zum Image durchzogen. Es geht nicht mehr um das Sein, sondern um das Sichtbarsein. Der Mensch stilisiert sich selbst zur Marke, die nur funktioniert, solange sie Begehrlichkeit erzeugt.
Hier wird Nietzsches Konzept der Selbstüberwindung pervertiert: Nicht mehr das Werden, das Wachstum, das Risiko steht im Vordergrund, sondern eine narzisstische Selbstaffirmation, die alles Andere – im Sinne Byung-Chul Hans – verdrängt. In Die Austreibung des Anderen beschreibt Han eine Gesellschaft, die das Fremde, das Unverfügbare, das Irritierende systematisch ausschließt, um ein narzisstisch gespiegeltes Selbst aufrechtzuerhalten. In dieser Welt ist der Andere nicht mehr eine Herausforderung oder eine Chance zur Entwicklung, sondern ein Funktionsobjekt: bewertet, benutzt, beseitigt.
Der neue Barbar ist kein Krieger mehr. Er tritt als Kurator seiner eigenen Sichtbarkeit auf. Seine Waffen sind Filter, Hashtags und Algorithmen. Diese Barbarei ist still, glatt, affirmativ – und genau darin radikal. Es ist die Barbarei der Optimierung, in der der Andere statt zerstört zu werden eher in Bedeutungslosigkeit verschwindet. Beziehungen werden zum Projekt, Menschen zu Ressourcen, Intimität zur Ware.
Han spricht hier von der neoliberalen Vernutzung des Anderen. Der Andere erscheint nicht mehr als radikale Differenz, als Widerständigkeit, sondern wird durch ein Netz der Kontrolle, der Bewertung, der Vergleichbarkeit in eine ökonomische Struktur überführt. Der neue Narzissmus ist nicht (nur) pathologisch – er ist systemisch.
Nietzsche beklagte eine „Verweichlichung“4 des Menschen. Heute haben wir es mit einer Verflüssigung zu tun: Nichts bleibt, alles fließt, alles muss performen. Die Barbaren des 21. Jahrhunderts kommen nicht mit dem Schwert: Sie halten den Selfie-Stick hoch. Sie zerstören nicht Gebäude, sondern Bedeutungsräume.
IV. Die narzisstische Kultur als nihilistische Fortsetzung
Man könnte versucht sein, diese narzisstische Kultur als das genaue Gegenteil von Nietzsches Barbaren zu deuten. Doch sie ist vielmehr eine Konsequenz des von ihm beschriebenen Nihilismus: Wenn keine übergeordneten Werte mehr existieren, wird das Ich zum alleinigen Maßstab. Doch was wie eine Befreiung aussieht, ist in Wahrheit eine neue Form der Versklavung – eine Gefangenschaft im Eigenen.
Nietzsches Vision einer großen Gesundheit, einer affirmativen Existenz, setzt den Anderen voraus: als Widerstand, als Grenze, als Dialogpartner. Die narzisstische Kultur hingegen kennt nur das Echo. In der narzisstischen Dynamik wird das Andere nicht integriert oder überboten – das Andere wird so auf seine Spiegelfunktion reduziert, dass es eliminiert wird. So ist die gegenwärtige Barbarei eine Barbarei der Beziehungslosigkeit.
Die narzisstische Gesellschaft steht nicht nur in der Tradition der Aufklärung, sondern auch in derjenigen deren ihres paradoxen Zerfalls. Die Emanzipation des Subjekts hat in eine Isolation geführt. Soziale Netzwerke suggerieren Verbindung, erzeugen aber Vereinzelung. Der Andere wird zum Screen – seine Tiefe verschwindet. Nähe wird simuliert, während echte Begegnung unmöglich wird, die ständige Sichtbarkeit ersetzt die Subjektivität. Der Mensch wird zum Objekt seiner eigenen Überwachung. Der narzisstische Blick nach innen ist keine Selbstreflexion mehr, sondern ein permanentes Scannen nach Anschlussfähigkeit und Anerkennung.
Diese Bewegungen schaffen keine neue Kultur. Sie rufen nicht zur Selbstüberwindung, sie rufen zur Projektion. Ihre Revolte ist keine schöpferische Tat, sie ist Ausdruck von Unfähigkeit zur Gestaltung. Selbstermächtigung wird ersetzt durch eine performative Opferhaltung, die allzu leicht mit Aggression und Gewaltbereitschaft kompensiert wird.
Auch im narzisstischen Selbstinszenierungskomplex der „Selfie-Kultur“ zeigt sich eine scheinbare Subjektivierung, die aber vielmehr Ausdruck einer systemischen Ohnmacht scheint. Die „Marke Ich“ wird zur Kompensationsstrategie in einer entgrenzten Welt. Diese Form des digitalen Barbarentums ist jedoch nicht stark, sondern schal – eine Farce der Authentizität.
Nietzsche kritisiert die Schwäche der Moderne, verabsolutiert aber zugleich eine unkonkrete Hoffnung auf einen Bruch. Diese Dialektik mündet in ein paradoxes Verhältnis: Der Ruf nach der „stärkeren Art“ ist Ausdruck der Erfahrung, selbst nicht gestalten zu können. Die Philosophie des Übermenschen gerät so zur Philosophie der Selbstentmächtigung, die ihre eigene Wirksamkeit nur noch durch ihren Gegensatz denken kann. Diese freiwillige Aufgabe der Handlungskompetenz kann in depressives Erstarren, in eine passiv-aggressive Verweigerungshaltung dem Fremden gegenüber münden, während gleichzeitig das „Andere“, das Identifikation erlaubende, Fremde, in Errettungsphantasien idealisiert wird.
Statt im Modus konkreter Praxis verharrt auch der zeitgenössische Barbarenbeschwörer in einer Ästhetik des Umsturzes. Die produktive Kraft der Philosophie wird durch eine Mythologie des Bruchs ersetzt. Walter Benjamin nannte dies die „linke Melancholie“: das Festhalten an revolutionären Gesten ohne revolutionäre Wirkung.5
Nietzsches Idee einer „stärkeren Art“ bleibt selbst in der Schwebe zwischen Überwindungsphantasien und resignativer Kulturkritik. In der Vorstellung, dass „nur die Barbaren uns retten können“, steckt eine Verweigerung der Adaptation: Die Gegenwart wird nicht als gestaltbar gedacht, sondern als dekadent, verfallen, dem Untergang geweiht.
Eine gegenwartsbezogene Philosophie muss jedoch zur Kritik und zur Gestaltung fähig sein. Der Blick auf das „Barbarische“ darf nicht zur mythologischen Figur verkommen, sondern muss als Spiegel dienen: Was fehlt uns, dass wir uns nach Zerstörung sehnen? Warum glauben wir, nur von außen könne die Kraft kommen, die wir in uns nicht mehr finden?
V. Die Möglichkeit einer neuen Barbarei: Transformation statt Transgression
Statt einer Rückkehr zur Gewalt oder zum symbolischen Individualismus, braucht es heute vielleicht eine radikale Rehabilitierung des Anderen. Der „Barbar“ der Gegenwart könnte nicht der sein, der zerstört, sondern jener, der sich der totalen Instrumentalisierung verweigert – der in seiner Existenz das Andere verkörpert: Unverfügbarkeit, Ambivalenz, Widerstand.
Eine neue Barbarei müsste die Systeme der Bewertung sprengen. Sie müsste dem narzisstischen Blick das Verstummen entgegensetzen. Vielleicht sind es die Schwachen, die Ambivalenten, die Unpassenden, die heute in der Lage wären, eine neue Form von Beziehung zu ermöglichen – nicht durch Macht, sondern durch Präsenz. Eine „barbarische Ethik“ wäre dann keine Ethik der Gewalt, sondern eine Ethik des Nicht-Funktionierens.
Die Figur des Barbaren verweist historisch auf Ausgrenzung, symbolische Gewalt – und zugleich auf die immer wiederkehrende Hoffnung auf Neuanfang. Nietzsche hat diese Figur philosophisch überhöht und sie zu einer Projektionsfläche für die Überwindung der Moderne gemacht. Doch in dieser Überhöhung liegt eine doppelte Gefahr: Die Erneuerung wird externalisiert – sie soll von außen kommen, in Gestalt des „anderen Menschen“. Und sie wird ästhetisiert – als heldenhafter Akt, als Pathos des Bruchs.
Gegen dieses Denken im Bruch plädiert eine Ethik der Transformation: Sie nimmt das Bestehende ernst, nicht weil es gut ist, sondern weil es real ist. Transformation beginnt nicht mit Gewalt. Sie beginnt mit Aufmerksamkeit. Sie ist ein leiser, langwieriger, konfliktreicher Prozess, der Irritationen zulässt und Ambivalenzen aushält. Im Gegensatz zur transgressiven Geste, die das Gesetz missachtet, sucht die Transformation nach anderen Regeln, nach anderen Formen des Umgangs mit Macht, Verletzlichkeit und Verantwortung.
Transformation bedeutet, den Anderen statt als Hindernis als Möglichkeit zu begreifen. Sie bedeutet, sich jenseits der Inszenierung als Marke als Beziehung zu denken. Und sie bedeutet, den Schmerz der Gegenwart nicht mit der Hoffnung auf eine utopische Zukunft zu betäuben: Aus dem Schmerz heraus ist die Arbeit der Veränderung zu beginnen. Sie ist nicht weniger radikal als der Umsturz – aber sie ist langsamer, tiefer, und nachhaltiger.
Was wir heute brauchen, sind keine Barbaren, sondern Transformatoren: Menschen, die bereit sind, mit den Ruinen der Moderne weiterzubauen – ohne Zynismus, ohne Heilsversprechen, mit einem Sinn für das Mögliche im Wirklichen. Das erfordert nicht heroischen Bruch, sondern radikale Geduld, nicht Apokalypse, sondern kulturelle Arbeit. Die eigentliche Stärke liegt eben nicht in der Inbrunst des Umsturzes, sondern in der Fähigkeit zur Dauer – und in der Kunst, trotz allem nicht nur zu hoffen, sondern zu handeln.
Marion Friedrich, geboren 1973 in Deutschland, studierte in La Laguna (Spanien) Psychologie und anschließend in Augsburg (Deutschland) Philosophie. In ihrem Promotionsstudium an der Universität Augsburg beschäftigte sie sich insbesondere mit erkenntnistheoretischen Fragen der Neurophilosophie und der noetischen Anthropologie. Seit 2007 lehrt sie neben ihrer psychotherapeutischen Tätigkeit in ihrer eigenen humanistischen Praxis an der Universität Augsburg mit Schwerpunkten in Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Emotionstheorien und Künstlicher Intelligenz. Ihre aktuellen Forschungsinteressen umfassen die Philosophie des Geistes, KI-Ethik und die Psychologie der Liebe. 2024 erschien von ihr der zusammen mit Joachim Rathmann und Uwe Voigt verfasste Band Ego oder Öko? Narzissmus und die ökologische Krise bei Reclam.
Quellen
Agamben, Giorgio: Homo Sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Frankfurt a. M. 2002.
Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften III. Frankfurt a. M. 1991.
Han, Byung-Chul: Die Austreibung des Anderen. Gesellschaft, Wahrnehmung und Kommunikation heute. Frankfurt a. M. 2016.
Ders.: Psychopolitik. Neoliberalismus und die neuen Machttechniken. Frankfurt a. M. 2014.
Mbembe, Achille: Kritik der schwarzen Vernunft. Berlin 2017.
Das Artikelbild wurde von der Autorin mit Hilfe von ChatGPT erstellt.
Fußnoten
1: Nachgelassene Fragmente 1887 11[31].
2: Vgl. Agamben, Homo Sacer und Mbembe, Kritik der schwarzen Vernunft.
3: Vgl. u. a. Nachgelassene Fragmente 1885 34[112] und Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 11 und I, 16.
4: Vgl. etwa Nachgelassene Fragmente 1887 10[2].
Die Barbaren des 21. Jahrhunderts
Narzissmus, Apokalypse und die Abwesenheit des Anderen
Die Diagnose unserer Zeit: keine heroischen Barbaren, sondern Selfie-Krieger. Dieser Essay, den wir mit dem zweiten Platz des diesjährigen Eisvogel-Preises (Link) auszeichneten, spürt Nietzsches Vision der „stärkere[n] Art“1 nach und zeigt, wie sie in einer narzisstisch geprägten Kultur in ihr Gegenteil verkehrt wird – Apokalypse als Pose, der Andere als blinder Fleck. Doch anstelle des großen Bruchs eröffnet sich eine andere Möglichkeit: eine „barbarische Ethik“ der Verweigerung, der Ambivalenz, der Beziehung. Wer sind die wahren Barbaren des 21. Jahrhunderts – und brauchen wir sie überhaupt?
