Nietzsche POParts
Sind nicht Worte und Töne
Regenbogen und Schein-Brücken
zwischen Ewig-Geschiedenem?
Nietzsche
POP
arts
Nietzsche

Sind

nicht

Worte


und

Töne
Regenbogen
POP

und

Scheinbrücken

zwischen

Ewig-

Geschiedenem
arts

Zeitgemässer Blog zu den Erkenntnissen Friedrich Nietzsches
Artikel
_________
Gespräch mit Barbara Straka
Barbara Straka im Gespräch zu ihrem Buch Nietzsche forever?
„Es geht nicht mehr um Monumentalisierung! Es geht Künstlern heute darum, Nietzsche menschlich zu machen, damit man sich mit ihm neu auseinandersetzen kann.“
Barbara Straka im Gespräch zu ihrem Buch Nietzsche forever?


Im vergangenen Jahr publizierte die Kuratorin und Kunsthistorikerin Barbara Straka eine zweibändige Monographie mit dem Titel Nietzsche forever? Friedrich Nietzsches Transfigurationen in der zeitgenössischen Kunst, in der sie Nietzsches Bedeutung für die bildenden Künste der Gegenwart darlegt. Nachdem Michael Meyer-Albert ihrem Werk in den letzten Wochen eine zweiteilige Rezension widmete (Teil 1, Teil 2), folgt nun ein Interview, das unser Autor Jonas Pohler mit der Autorin in Potsdam führte. Er diskutierte mit ihr über ihr Buch, aber auch über das nicht immer einfache Verhältnis zwischen Philosophie und gegenwärtiger Kunst.
1. „In dieser überbordenden Fülle der Konsumkultur ist es praktisch kaum noch möglich, so etwas wie ein Erkenntnisinteresse an Kunst heranzutragen.“
Jonas Pohler: Sie haben für den Umschlag Ihrer Bücher1 einen Souvenirladen gewählt.
Barbara Straka: Nein, das ist kein Souvenirladen.
JP: Was ist das?
BS: Das ist kein Souvenirladen. Drehen Sie mal bitte um. Da sehen Sie das gesamte Werk, Nietzsche Car [siehe das Artikelbild] und daraus ist es ein Ausschnitt.
JP: Warum haben Sie sich trotzdem für dieses Bild entschieden?
BS: Ja, das ist ein Teaser, ein Aufmacher, ein Appetit-Häppchen, könnte man sagen. Es kommt an verschiedenen Stellen vor. Zum Beispiel im Titel des Buches, Nietzsche forever? Das Fragezeichen ist von mir, aber „Nietzsche forever“ ist von Thomas Hirschhorn, denn es steht als ein handgeschriebenes Pappschild mit drei oder vier Nietzsche-Porträts auf dem Car. Da ist ein rotes Schild zu sehen und stellt eben diese Frage: Hat das eine überzeitliche Gültigkeit? Hat Nietzsche eine überzeitliche Gültigkeit und wie geht es mit der Kunst zu Nietzsche weiter? Das möchte ich gerne dem Betrachter oder den späteren Kunstwissenschaftlern überlassen.
JP: Das ist ein Auto, welches voll ist mit allen möglichen (Nietzsche-)Devotionalien, zum Beispiel Hello Kitty2. Haben Sie es ausgewählt, weil es die Gegenwart der Nietzsche Rezeption so gut veranschaulicht? Sehr überladen, teilweise kommerzialisiert, es gibt irre viel … Sie schreiben auch, dass das Car Stillstand symbolisiert, weil das Auto nicht mehr fahren kann.
BS: Naja, man könnte jetzt auch fragen: Warum ist es denn zum Stillstand gekommen? Es ist überschüttet! Es ist überschüttet mit Kitsch und Devotionalien, aber die sind nicht nur Nietzsche-basiert, sondern sie sind auch – hier von der amerikanisierten japanischen Kultur repräsentiert, nämlich diesem Hello Kitty – Symbol. Hello Kitty als Manga-Gesicht, das mit dem Kindchenschema arbeitet und die Leute in seinen Bann schlägt, ist ein Sinnbild geworden für die internationale Pop-Art- und Pop-Kultur und zwar eine sehr triviale, eine die Infantilisierung der Gesellschaften abbildende, popularisierte Kunst. Ich würde nicht abstreiten, dass es auch Kunst ist. Natürlich ist es auch Kunst. Es gibt genügend Künstler, die so arbeiten, wie zum Beispiel Takashi Murakami, die haben Weltruhm erlangt. Aber in dieser überbordenden Fülle der Konsumkultur unserer Zeit ist es praktisch kaum noch möglich, so etwas wie ein Erkenntnisinteresse an Kunst heranzutragen. Und das ist auch die zentrale Frage, die Thomas Hirschhorn, so wie ich ihn verstanden habe, stellt. Wie schaffen wir es in dieser spätkapitalistischen Zeit, zu den wesentlichen Fragen wieder vorzudringen, uns quasi durchzuwühlen und dann an Nietzsche vielleicht hängen zu bleiben und ihn auch wirklich wieder zu lesen? Hirschhorn sagt nicht, ja so ist es, das ist alles ganz furchtbar, das ist der Endpunkt und der nihilistische Abgesang, sondern er spielt ganz im Sinne …
JP: … es gibt also ein positives Potenzial!
BS: Richtig, er spielt dem Betrachtenden die Rolle zu: Setz’ dich damit auseinander! Lies! Lies ihn! Und das finde ich großartig. Da ist nicht nur ein didaktisches Moment drin, aber nicht in dem Sinne der belehrenden „Schautafel-Ästhetik“, wie man es früher in den 70er Jahren den Künstlern vorgeworfen hat, sondern ein emanzipatorisches Moment. Das spricht sowieso für Hirschhorn: Die Materialien, die er verwendet, sind meistens ganz einfache, die jeder kaufen kann. Er hat ein ganz, wie soll man sagen, soziales Verständnis von Kunst. Er macht wirklich Kunst für die Menschen. Und er will auch im Sinne von Joseph Beuys zeigen, dass im Grunde genommen jeder Mensch ein Künstler sein kann. Die Materialien sind nicht teuer, sondern man kann sie sogar im Baumarkt kaufen: Klebefolie, Holz, Alufolie, alles Mögliche – und das ist seine Botschaft. Die Nietzsche-Rezeption ist heute insofern gefährdet, weil sie durch die popularisierte Rezeption, dazu gehören dann auch all diese Fakes, droht verschüttet zu werden. Das Kern-Icon, nämlich Hello Kitty, diese kleine Katze, kriegt den Nietzsche-Bart angeklebt. Das heißt, da hat schon eine Amalgamierung stattgefunden. Das ist schon eine Mutation.
JP: … aber der Bart zum Beispiel ist auch eine Erinnerung!
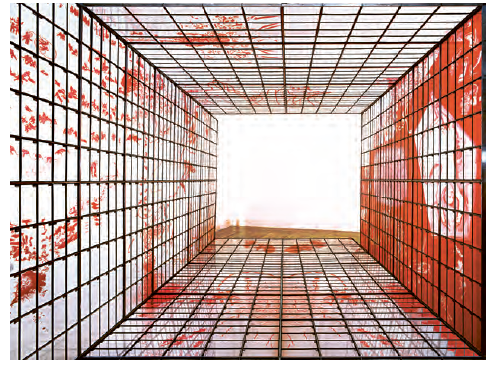
2. „Texte, Texte, Texte!“
BS: Nietzsche selber wird sehr oft verballhornt. Es ist eine Motivation meinerseits gewesen, dass ich diese populistische Reduktion so nicht stehen lassen wollte. Mein Eindruck war, dass seit der 1994er Weimarer Ausstellung [Für F. N. – Nietzsche in der bildenden Kunst der letzten 30 Jahre], in welcher viele Karikaturen ausgestellt waren, dass die Nietzscheforscher oft diesen witzigen, irgendwie niedlichen und komischen Nietzsche lieber gesehen haben als den ernsthaften.3 Es ist ein Eindruck von mir gewesen, dass diese populistische Rezeption sich seit dieser Zeit schon als ein Hauptstrang entwickelt.
JP: Sie haben den Eindruck, dass diese Popularisierung begrüßt wird?
BS: Ja, es ist leichte Kost.
JP: Aber auch unter Forschern? Nietzsche wird doch oft als ein strenger Philosoph, zum Teil schon klassischer Philosoph dargestellt und so hatte ich mir auch seine „Verehrer“ vorgestellt, die sich dann von dieser populären Kunst eher abgestoßen fühlen.
BS: Ja, da muss man unterscheiden. Ich habe von den klassischen Nietzsche-Forschern geredet, die sich die ganze Zeit mit Nietzsches Texten beschäftigen. Texte, Texte, Texte! Einer der Ausstellungsmacher in Weimar hat noch im Jahr 2000 gesagt, Nietzsche ist Text. Wenn solche Leute Bilder von Nietzsche sehen, dann wollen sie natürlich etwas haben, was ein bisschen leichtere Kost ist, sozusagen zur Entspannung. Auf jeden Fall ist diese humoristische Auseinandersetzung mit Nietzsche eine willkommene Möglichkeit zu popularisieren. Sie suchen sich dann genau das raus, womit sie selber Spaß haben. Sie haben gar keine Fragen an die Künstler, sondern sie suchen in der Kunst das, was sie selber schon wissen. Auf der anderen Seite die Kunsthistoriker – in solchen Kreisen herrscht dann wieder ein abgehobener Kunstbegriff vor, was meine These untermauert, dass Kunst und Philosophie einfach neue Begegnungsebenen brauchen und einen neuen Dialog: Sie wissen zu wenig voneinander. Zwischen dem Kunstbetrieb, der Entwicklung zeitgenössischer Kunst, ihrer Theoriebildung und der klassischen Philosophie liegen Welten.
JP: Woran liegt es, dass sich die interdisziplinäre Arbeit zwischen der zeitgenössischen Kunst und zum Beispiel der akademischen Philosophie so schwer gestaltet? Sie schreiben an einer Stelle:
Hat die kunsthistorische Rezeption bis 2000 immerhin einige, bereits arrivierte Künstlerpositionen im Blick, so bleibt die philosophische Nietzscheforschung weiterhin ignorant bis skeptisch [...]. Es ist erstaunlich, dass noch am 100. Todestag Nietzsches von einer fachwissenschaftlichen Wirkungsanalyse, geschweige denn von einer breiteren Kenntnisnahme zeitgenössischer Kunst zu Nietzsche, nicht die Rede sein kann[.] (S. 39)
Gleichzeitig, schreiben Sie, gibt es den Vorwurf an die moderne Kunst, sie sei zum Teil „deutungslos, [und] ambivalent“ (S. 40).
BS: Man redet nicht umsonst vom „Betriebssystem Kunst“. Es ist ein in sich geschlossenes System, das um sich selber kreist und die Philosophie ist es eigentlich auch. Und hin und wieder kollidieren sie miteinander. Da gibt es dann sozusagen Berührungspunkte, die ich hier nun auch versucht habe anzuzetteln, buchstäblich. Aber man betrachtet sich aus der Distanz und nimmt natürlich nur ausschnitthaft wahr. Auch Philosophen haben da ein großes Nachholbedürfnis oder einen Nachholbedarf, den sie vielleicht gar nicht unbedingt erkennen oder dessen sie sich gar nicht unbedingt bewusst sind. Sie sind irgendwo stehen geblieben auf einer bestimmten Stufe, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Das ist eben nicht ihr Feld. Also, vom Kunstverständnis eines klassischen Philosophen oder Nietzsche-Forschers kann man gar nicht verlangen, dass es sich auf der gleichen Höhe wie die zeitgenössische Kunstentwicklung bewegt. Das geht gar nicht. Das kann ich auch niemandem zum Vorwurf machen; sie haben auch gar nicht so viel Zeit. Sie sind Forscher und die Künstler haben auch nicht so viel Zeit; die lesen dies und jenes und integrieren es dann. Und dann gibt es eben diese punktuellen Funkenschläge … Natürlich gibt es auch Künstler, die mit Philosophen zusammengearbeitet haben, wie zum Beispiel Hirschhorn – und da wird es dann natürlich fruchtbar. Da werden die Sachen dann auch wirklich komplex. Sowas würde ich mir noch häufiger wünschen! Das ist ja auch eine Anregung, das Buch soll eine Anregung sein, ins Gespräch zu kommen miteinander. Aber bislang war es eben so, dass die Begegnungen überwiegend zufällig waren. Ausgrenzung kann man nicht nur den Philosophen und Nietzsche-Forschern vorwerfen, sondern auch den Kunsthistorikern. Die waren genauso ausschnitthaft unterwegs …, aber immer wurde überwiegend die sogenannte „Galerie-Kunst“ ausgeblendet. Das ist eben der Punkt. Und das war mein Nachholprojekt, dass ich mit Werken von über 220 Künstler:innen jetzt alles mal zusammengetragen habe, was nach 1945 entstand.
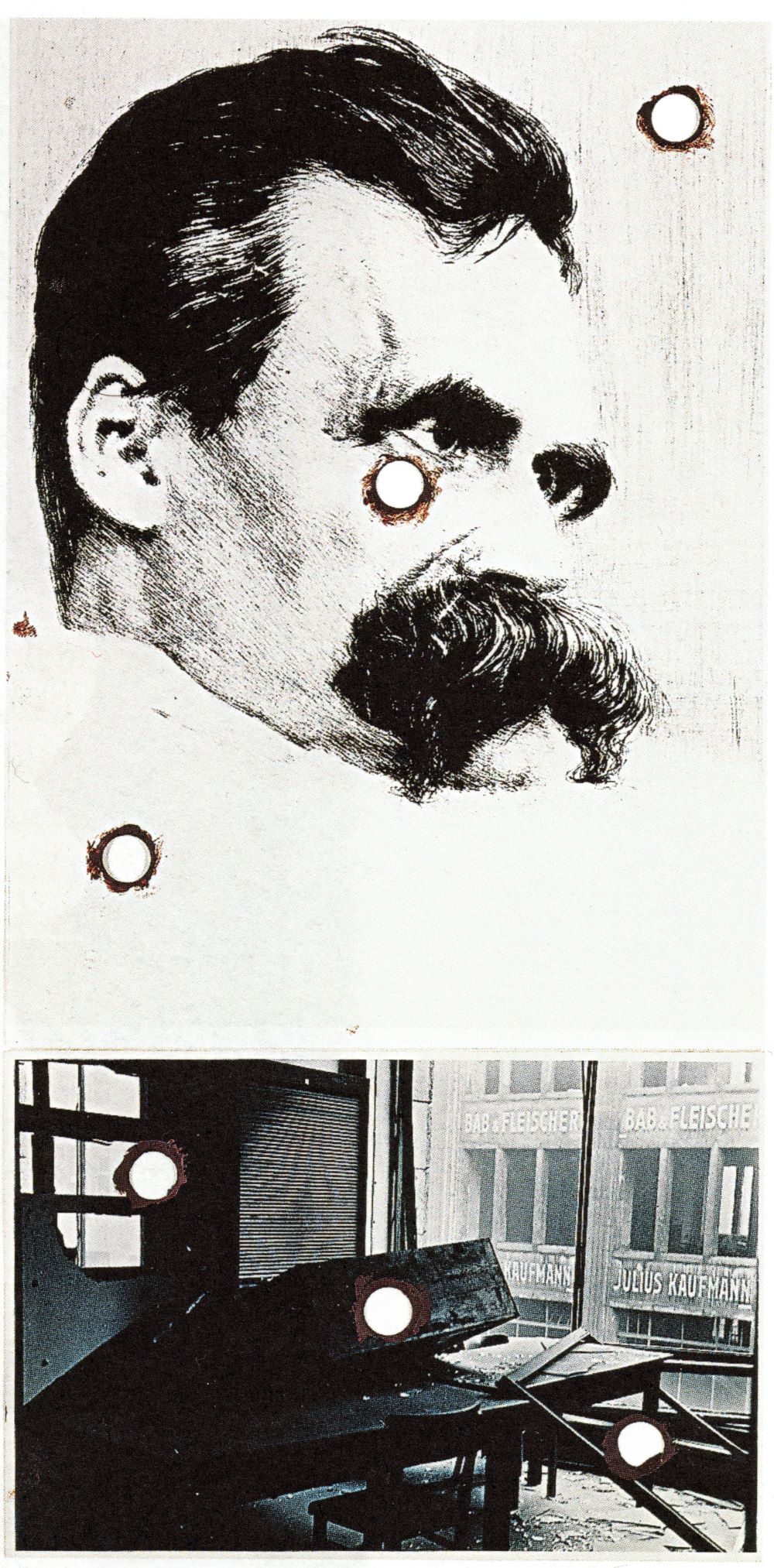
3. „Alles, was sich jetzt festbeißt an einer These, an einer Disziplin, an einer Überzeugung, ist nicht zeitgemäß!“
JP: Was könnte die Philosophie von der modernen Kunst lernen oder was glauben Sie, könnte aus einer Zusammenarbeit entstehen? Sie hatten in Ihrem Buch für Ausstellungen plädiert, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sie denken, dass diese als Format ein gutes Mittel wären, um die genannten Verbindungen zu schaffen. Andererseits habe ich den Eindruck, ihnen haftet immer noch etwas sehr Exklusives und Begrenzendes an und dass das, was man „Kulturbetrieb“ nennt, eine große Rolle spielt.
BS: Erst einmal geht es überhaupt um die Öffnung. Es geht darum, diese engen akademischen Grenzen aufzumachen. Ich will mich nicht in allgemeinen Sätzen verhaken, aber die akademischen Disziplinen sind sehr darauf bedacht, ihre Fachgrenzen zu halten, sie gehen ungern in andere Gefilde. Es geht aber um Dialoge, um eine Haltung, die aktuelle Phänomene, die unsere Zeit, Gesellschaft, Politik und Geschichte prägen, auch horizontübergreifend reflektiert. Es geht darum, Themen nicht nur von einer Seite anzuschauen, sondern, im Sinne Nietzsches, den Wahrheitsbegriff zum Beispiel als etwas Prismatisches zu sehen. Dass ich lerne, unterschiedliche Aspekte, Bereiche, Themen, einfach die Vielfalt eines Phänomens zu erkennen. Also alles, was sich jetzt festbeißt an einer These, an einer Disziplin, an einer Überzeugung, ist nicht zeitgemäß! Heute geht es um eine große Öffnung, es geht um Bewegung, es geht um Multidisziplinarität, es geht um Zusammenarbeit, es geht letztendlich auch um das Wissen, dass Innovation nur entstehen kann, wenn möglichst viele verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten.
JP: Ganz im Sinne von Nietzsche eigentlich. Er hat selbst dafür plädiert. Ich hatte den Eindruck, dass Sie genau das in ihrem Buch darstellen wollten, diesen Facettenreichtum, der ganz verschiedene Formen annehmen kann.
BS: Ja, genau. Es gibt nicht das eine gültige Nietzschebild, das gibt es nicht.
JP: Dem würde ein Wissenschaftler wahrscheinlich widersprechen.
BS: Ja, der würde immer noch suchen.
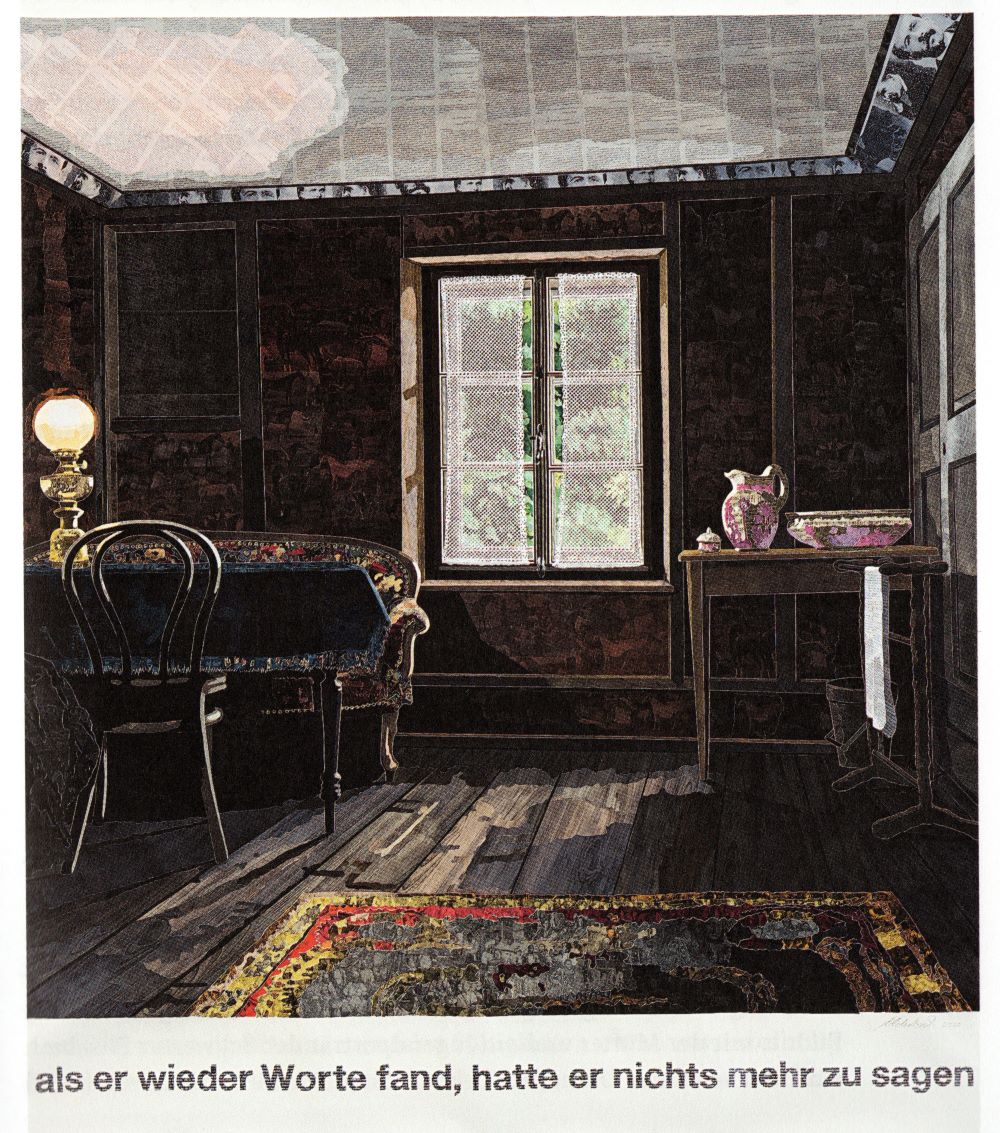
4. „Es geht nicht um eine Monumentalisierung von Nietzsche – es geht um sehr vielschichtige Perspektiven.“
JP: Ein anderes Werk aus Ihrem Buch ist von Katharina Karrenberg [vgl. Abb. 1]. Hier geht es, glaube ich, nicht um Zerstörung.
BS: Nein, da geht es um Entwicklung und Prozess.
JP: Ich hatte Schwierigkeiten, mir das Werk vorzustellen.
BS: Ja, das glaube ich gerne.
JP: Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Raum? Bei ihr? Ist es im Atelier, was ist das?
BS: Katharina Karrenberg war das erste Mal eingeladen bei meiner Ausstellung Artistenmetaphysik – Friedrich Nietzsche in der Kunst der Nachmoderne mitzumachen, die war im Jahr 2000 in Berlin. Weil ich sie vorher schon kannte, wusste ich, dass sie sich sehr viel und explizit mit Philosophie auseinandersetzt und permanent am Lesen ist, von neuester Literatur bis zu Sachbüchern. Ich habe sie damals eingeladen und wusste gar nicht, was sie macht. Dann hat sie eine ganze Wand gestaltet, mit vielleicht 60 Arbeiten. Das sind so kleine Täfelchen.
JP: Die war fertig? Oder hat sie sie live gestaltet?
BS: Nein, das hat sie zu Hause in ihrem Atelier gemacht. Und dann wurde es im Ausstellungsraum im Haus am Waldsee [Berlin] im Obergeschoss ausgestellt. Sie hat einen ganzen Raum für sich bekommen und da ging es um ZARA & TUSTRA. Sie hat die Figur Zarathustra auseinandergenommen und daraus zwei comicähnliche Figuren gemacht, die anknüpfen an große Paare in der Kulturgeschichte, wie Dante und Vergil oder Faust und Mephisto. Zwei Figuren, die eine Reise antreten und die Künstlerin wusste natürlich am Anfang gar nicht, wohin die Reise geht. Sie hat erst das Zarathustra-Motiv in der Ausstellung durchexerziert. Dann haben wir eine Weile gar nichts mehr voneinander gehört und irgendwann las ich, sie habe weitere Ausstellungen gehabt und inzwischen war das Ganze auf über 800 Teile angewachsen. Heute sind es über 2000! Es ist eine Reise durch die Geschichte geworden. Man folgt den Figuren bis zur Auflösung. Irgendwann taucht auch die Künstlerin selber auf. Es ist ein Eintauchen, ein Abtauchen, ein Auftauchen, ein Verwandeln. Es ist sehr nietzscheanisch gedacht, im Sinne dieser ewigen Bewegung, ewigen Wiederkehr – der Gedanke kommt natürlich auch zum Vorschein. Sie hat alle Entwicklungen der Moderne und der Postmoderne in diesem Werk reflektiert bis hin zu politischen Themen, ich sag jetzt mal ein Beispiel: Gaza. Die Dinge sind immer noch im Fluss. Ich habe sie vor zwei Jahren besucht am Tempelhofer Ufer in Berlin, Kreuzberg. Sie lebt in diesem Werk. Es ist ein Lebenskunstwerk geworden. Aber man kann sich das wirklich so vorstellen, es ist überall. Es hat sich wie ein Strom durch die ganze Wohnung entwickelt und ist total faszinierend, total faszinierend! Man kann das in wenigen Worten gar nicht zusammenfassen. Wenn man selbst da durchgeht, ist man wie in einem Rausch. Das Betrachten ist eine rauschhafte Erfahrung. Beim Gegenüber muss dann natürlich wieder das Reflektieren einsetzen, um sich darin überhaupt zu verorten und wiederzufinden. Im Prinzip ist es nicht abgeschlossen, aber sie will das jetzt. Es ist im Grunde genommen ein offenes Kunstwerk, nach dem Begriff von Umberto Eco. Ein offenes Kunstwerk, das sich permanent verändert, wie Nietzsche gesagt hat: ein sich selbst gebärendes Kunstwerk. Kurz und gut: eines der komplexesten konzeptuellen, intellektuell hochkarätigen Werke, das in einem völligen Gegensatz zu der einen oder anderen kleinen Zeichnung zu Nietzsche steht, die es auch gibt, die aber nicht minder intensiv wirken kann. Die Werke haben alle ihre Berechtigung. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich immer wieder versucht habe zu betonen: Ein Hauptwerk kann auch eine kleine Zeichnung sein. Es geht nicht um Monumentalität. Ich störe mich an dem Begriff, denn es geht nicht um eine Monumentalisierung von Nietzsche – es geht um sehr vielschichtige Perspektiven.
JP: Sie schreiben am Anfang Ihres Buches:
[F]ür die Gliederung der Themenkomplexe wurde ein Clustermodell gewählt, in dessen Mittelpunkt jeweils die bedeutendsten Werke stehen, die eine ikonografische Weiterentwicklung des Motivs mit vielschichtigen Bezügen zu anderen Positionen aufweisen[.] (S. 5)
Und am Ende:
So bleibt es an den Rändern der Themengruppen bei einer Grauzone, besser: einer notwendigen Unschärfe, die der Komplexität der Kunst geschuldet ist oder sich vielmehr ihr verdankt[.] (S. 722)
Wenn Sie sagen, es gibt einen Cluster, heißt das, es gibt auch einen Mittelpunkt? Das erinnert an die Familienähnlichkeiten von Wittgenstein oder die Prototypensemantik. Es gibt Prototypen und bestimmende Merkmale.
BS: Das ist etwas anderes. Also es gibt nicht ein bestimmendes Merkmal bei mir, sondern bei mir ist ja die Komplexität das Kriterium für den Mittelpunkt eines Clusters! Es ist nicht ein Typ! Nein, nein, um Gottes Willen! Das wäre wieder eine Festlegung! Es geht um Komplexität und es geht darum, dass in ein Werk, wie in dieses von Karrenberg, sehr viele Dinge einfließen! Sie hat ein umfangreiches Wissen und reflektiert das sozusagen durch den Fokus Nietzsche in ihrer Kunst. Aber es ist kein Prototyp! Das ist einzigartig, sowas gibt es nicht nochmal!
JP: Ist das ein Zentrum, kann man das sagen, oder stimmt das auch nicht?
BS: Ja, aber einige der Kapitel haben zwei oder drei Zentren. Das kommt vor. Warum? – Weil sie sich eben auch vermischen. Ich hatte geschrieben, dass es sein kann, dass ein Künstler auch einem anderen Kapitel zuzuordnen gewesen wäre. Ich habe mich dann aber für eins entschlossen. Und damit meinte ich auch diese Unschärfe der Ränder. Ich musste mir anschauen, was hat der Künstler im Großen und Ganzen gemacht, und dann hat sich das herauskristallisiert, dass ich ihn einem Hauptthema zugeordnet habe. Aber mit Bezügen zu dem einen oder anderen weiteren Thema und darauf habe ich dann verwiesen. Das ist, glaube ich, was das Buch aus meiner Sicht durchaus interessant macht. Man kann blättern, man kann woanders weiterlesen und, wenn man sich für dies oder das interessiert, sieht man, dass es noch einen Bezug zu einem anderen Kapitel gibt.
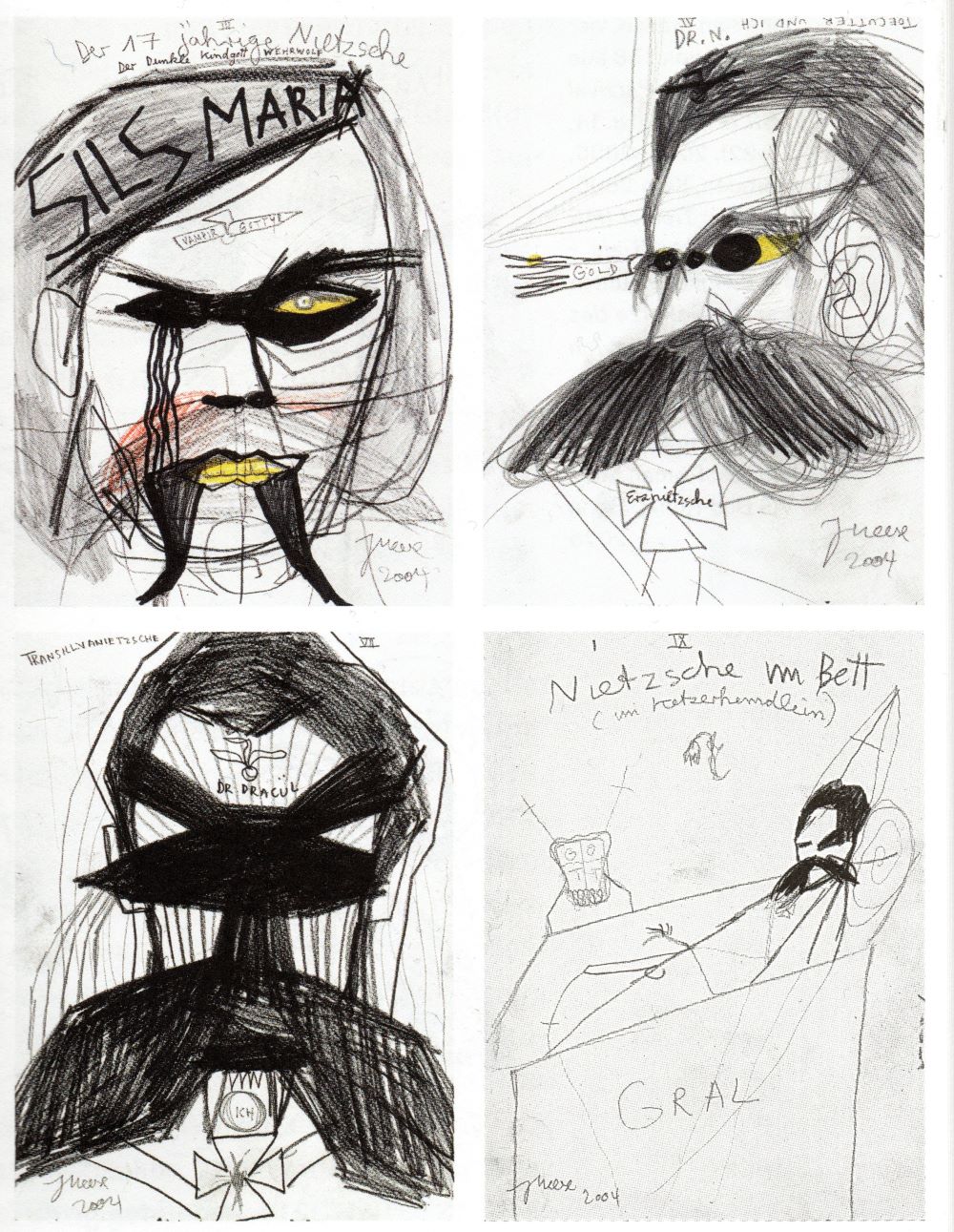
5. „… die ungeheure Empathie, die da drin steckt!“
JP: Statt des Begriffs „Zentrum“ bemühe ich mal das Bild vom Kristall. Er kann von vielen Seiten verschieden stark angestrahlt werden, brechen und reflektieren. Wenn wir jetzt nicht von den wichtigsten Werken sprechen wollen, sondern von diesen Kristallen … Wo finden wir sie? Sie hatten vorhin von subjektiven und objektiven Eigenschaften gesprochen.
BS: Einige sind schon angesprochen worden. Natürlich Thomas Hirschhorn, natürlich Katharina Karrenberg, natürlich auch Wolf Vostell, ganz klar. Dann natürlich Joseph Beuys, Sonnenfinsternis und Corona [Abb. 2]. Das ist ein Startpunkt gewesen, für die Künstler seiner Generation und der nachfolgenden Generation, sich neu mit Nietzsche auseinanderzusetzen. Bei Beuys ist es aber so, dass er noch mit einem Bein in der Vergangenheit steht. Indem er das Bildnis von Hans Olde aufgreift – den schon dem Tod nahestehenden oder nahegekommenen Nietzsche 1899 –, die Radierung aber herumdreht (Olde hat die Radierung seitenverkehrt dargestellt, das geht durch das drucktechnische Medium gar nicht anders), dreht Beuys Nietzsche wieder zurück. Das heißt, er ist bei Beuys wieder so zu sehen, wie Olde ihn gesehen und fotografiert hatte ... Nur eine Kleinigkeit, aber sie ist wichtig für die Bemerkung, dass die Künstler Anfang der 60er, 70er Jahre noch den authentischen Nietzsche gesucht haben. Sie wollten wirklich das richtige Nietzschebild. Sie wollten ihn wieder zum Thema machen und waren auf der Suche nach dem richtigen Bild. Das macht Beuys in gewisser Weise schon durch diese kleine Umkehrung. Er konfrontiert dieses Bildnis mit einer zerstörten Druckerei, einem verwüsteten Büro, das in der Reichskristallnacht in Berlin im Zeitungsviertel zu Bruch gegangen ist und gegenüber ist ein jüdischer Firmenname zu sehen. Man weiß sofort, was da los ist. Es ist Pogrom. Wieland Schmied hat dazu geschrieben, dass Beuys die Wunde schmerzhaft offenhält. Das heißt, zu der Zeit war die große Frage, ob man sich überhaupt wieder mit Nietzsche beschäftigen kann oder ob er ein für alle Mal verbrannt ist, weil Nietzsche damals noch nicht rehabilitiert war. Beuys hat trotzdem den Weg bereitet, sich mit ihm wieder auseinandersetzen zu können und parallel kommen dann Colli und Montinari mit der kritischen Studienausgabe.
JP: Historisch ist das sicher interessant, aber mich würde die aktuelle Zeit, das heißt seit den 90ern, interessieren.
BS: Da würde ich auf jeden Fall noch einen Künstler nennen, das ist Marcel Odenbach. Er hat während der Corona-Zeit in Sils Maria gelebt und in dem Nietzsche-Zimmer gearbeitet. Das Werk heißt Ausblick ohne Gott [Abb. 3] – eine riesige Fotoarbeit, die digital erstellt wurde. Da sieht man das Nietzsche-Zimmer, wie man es kennt ... und jedes Detail auf dieser scheinbar echten, aber digitalen Fotografie ist in sich eine Collage aus weiteren Motiven. Zum Beispiel Nietzsches Familie, Nietzsches Briefe, Nietzsches Kompositionen. Das sieht man erst, wenn man vor dem Bild steht. Das ist sehr groß, das ist wandfüllend. Das heißt, dass über ein einziges Bild sozusagen der ganze Philosoph erschlossen werden kann und dazu gehört auch diese Textzeile: „Als er wieder Worte fand, hatte er nichts mehr zu sagen.“ – Klar, Nietzsche konnte nach seinem Anfall, als er in Turin war, nicht sprechen, aber als er wieder Worte fand, hatte er nichts mehr zu sagen. Das spielt auf die Episode der Turiner Pferdeumarmung an.4 Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass das Ganze eine riesige Collage ist. Es sieht aus wie ein ganz normales Foto, aber auch in dem Teppich und überall sind Details versteckt. Oben ist ein Fries und dieser Fries ist ein Portrait neben dem anderen. Interessanterweise ist auch ein Fake dabei. Das ist wie ein Mosaik von Nietzschetexten, Fotos, Reisen, Freunden, Verwandten, Bekannten, Wagner … Das taucht alles da auf und auch immer wieder das Pferd. Ich glaube, hier auf der linken Seite, das sind alles Pferdebilder. Also die berühmte Episode, als er in Turin ein Pferd umarmt haben soll, dabei zusammenbrach und dann wahnsinnig wurde.
JP: Wen sollte man noch kennen?
BS: Jonathan Meese ist überhaupt nicht wegzudenken aus der Rezeption [vgl. Abb. 4]. Dann sollte man unbedingt die Serie der ägyptisch-kanadischen Künstlerin Anna Boghiguian kennen. Sie hat eine wunderbare Serie gemacht, die heißt An Incident in the Life of a Philosopher [Abb. 5]. Da geht es nur um seine letzten Tage in Turin, diese schicksalhafte Episode, die für ihn bis hin zu einer, wie soll man sagen, metaphorischen Auflösung der Erscheinungen reicht, die er da erlebte und die ihn dazu führte, sich später in seinen Wahnsinnsbriefen als Dionysos und der Gekreuzigte in einer schizoiden Doppelrolle zu sehen.
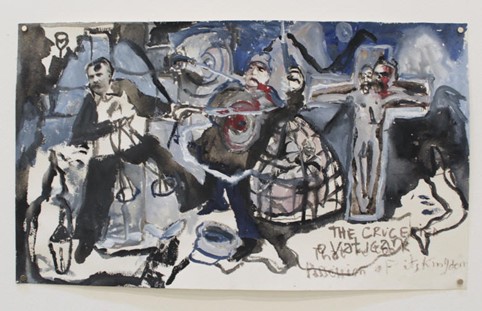
JP: Was macht dieses Werk so besonders?
BS: … die ungeheure Empathie, die da drin steckt: auf der einen Seite das Nachvollziehen dieser Episode, auf der anderen Seite die künstlerisch freie Interpretation und wie sie arbeitet. Sie arbeitet mit Collageelementen, die zum Teil Authentizität suggerieren. Dann wieder ganz freie Interpretation. Sie spinnt diese Legende quasi weiter. Die Frage: Wie hätte sich das zugetragen haben können? Dann kommen aber auch, wie im Film, Rückblenden rein. Plötzlich taucht Lou von Salomé auf und dieses berühmte Trio infernal, sage ich immer gern, mit Paul Reé. Sie wollten am liebsten in Paris eine Wohngemeinschaft gründen, aber das war zu damaligen Zeiten alles sehr, sehr schwierig. Nietzsche hatte diese Pläne, aber dabei gab es sehr viel Eifersucht und sehr viele Missverständnisse, sodass diese Freundschaft bald daran zerbrochen ist. Aber auf dem Weg zu seinem Wahnsinn begegnet ihm quasi noch mal diese Rückblende. Und das stellt sie alles dar. Sie hat parallel dazu ein Gedicht gemacht, wo sie eben den Vorfall, so wie sie ihn empfindet, schildert. Eine große Künstlerin, die auch schon auf der Biennale in Venedig war. Sie ist inzwischen schon eine ältere Dame, Anna Boghiguian, eine ganz große Künstlerin. Dann natürlich Felix Droese, ein Beuys-Schüler, der schon in den 80er Jahren diese Blindzeichnungen gemacht hat. Das ist in dem Kapitel Being Nietzsche [Abb. 6]. Das heißt also, wie weit treiben Künstler …
JP: … ich erinnere mich, ein Künstler, der sich in Nietzsche hineinversetzte.
BS: Richtig, also wie weit treiben sie dieses Moment von Identifikation? Dahinter steht natürlich die Frage: Wie kann ich Nietzsche wirklich verstehen? Also eben nicht nur seine Texte, sondern wie kann ich diesen Menschen verstehen in seiner ganzen Tragik? Wie kann ich auch den wahnsinnigen Nietzsche, der ja hin und wieder auch interessante Sachen gesagt hat, wie kann ich den auch verstehen? Und das hat Droese schon in den 80er Jahren für sich so beantwortet, dass er sich selber die Augen verbunden hat. Dann die inneren Bilder, die er im Kopf hatte, nachdem er die damals neu erschienene Nietzsche-Biografie von Curt Paul Janz gelesen hatte, diese drei Bände, sozusagen vor sein geistiges Auge gerufen und mit Blindzeichnungen zu Papier gebracht hat. Da sind so intensive Sachen entstanden, total intensive Bilder, die sind ganz zart, weil es ganz helle Bleistiftzeichnungen sind. Sie sind nicht so expressiv wie Meese sie zeichnet, sondern suchende Zeichnungen, könnte man sagen. Ein suchender Strich und trotzdem verdichtet sich das zu unglaublichen Bildern oder geradezu Visionen, wo man eine Schlüssellochperspektive einnimmt und in dieses Krankenzimmer schaut. Oder einmal liegt unten auf dem Boden eine Figur, also Nietzsche, auf dem Krankenlager, und von oben kommt eine schwarze Spinne, die sich gefährlich nähert. Das ist natürlich wiederum das Symbol der Mutter, die Spinne als das Muttertier, die ihn bis zum Tod nicht losgelassen hat, obwohl sie schon 1897 verstorben war. Das ist auch eine ganz, ganz große Leistung, eine sehr große Serie von 151 Zeichnungen.
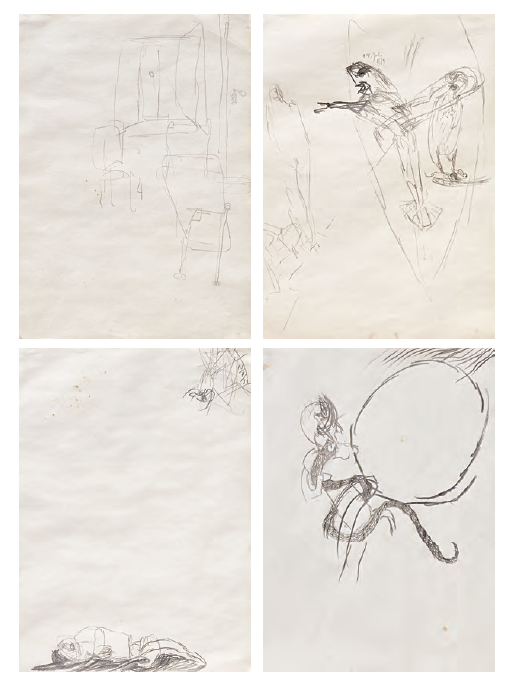
6. „Die Kunst und die Philosophie sind Möglichkeiten, letztendlich zu einer lebensbejahenden Position zu kommen.“
JP: Zu Beginn des Buches und auf dem Titel schreiben Sie „Nietzsche forever?“ und beantworten die Frage am Ende des Buches mit „Nietzsche forever!“, also mit einem Ausrufezeichen. Im Buch haben Sie die Frage selbst schon formuliert, wie es um die Zukunftsfähigkeit dieses Sujets in der zeitgenössischen Kunst bestellt ist. Welche Faktoren sehen Sie da aktuell? Was fehlt jetzt?
BS: Ich glaube, dass das Thema weiterhin bearbeitet wird, denn ich hatte, nachdem das Buch abgeschlossen war, ungefähr zehn neue Werke gefunden, die sich in die von mir gefundenen 14 Themengruppen einsortieren lassen würden. Eins davon war zum Thema Sexualität, ein anderes darüber, welche Relikte es gibt. Das wäre in dem Sinne aber nichts Neues gewesen. Also, dass jetzt noch ein ganz neues Thema kommt, glaube ich eher nicht. Vielleicht „Nietzsche und die Naturwissenschaften“ oder so etwas. Da gibt es jetzt einen Forscher, der untersucht Nietzsches Äußerungen zum Klima, andere fragen nach Nietzsches Einstellung zum Essen – diese ewige Suche nach der passenden Diät: Was bekömmlich für ihn ist, genauso wie er immer auf der Suche nach dem richtigen Ort war, wo er in Ruhe schreiben konnte, wo er seine Kopfschmerzen und ewige Erkrankung, seine Übelkeit und was er alles hatte, besser in den Griff kriegt. Es kann sein, dass Künstler das irgendwann mal aufgreifen. So weit sind sie aber noch nicht … Die Kunstentwicklung oder die Rezeption, die Künstler gegenüber Nietzsche machen, und die biografische Nietzsche-Forschung sind ja nicht auf demselben Level. Das heißt, wenn jetzt ein junger Wissenschaftler plötzlich eben Nietzsches Äußerungen zum Klima untersucht, dann dauert das eine Weile, ehe das von Künstlern rezipiert wird, wenn sie das per Zufall vielleicht erfahren.
JP: Arbeiten denn Künstler so, dass sie erstmal lesen?
BS: Es kann über mehrere Wege passieren. Es kann sein, dass sie bei Nietzsche selber nachlesen, wo er sich auf seinen Reisen zum Beispiel über das Klima im Oberengadin äußert. Und wenn jetzt einer naturwissenschaftlich interessiert ist, dann kann es durchaus sein, dass er über Nietzsche selber dazu kommt oder aber durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Ein Beispiel ist die Berliner Künstlerin Tyyne Claudia Pollmann – mit diesen zwei großen, ganz frühen digitalen Werken.

JP: Ist das eine Animation?
BS: Das ist alles am Computer generiert. „Photobased Art“, sagt man heute – auf Fotografien basierend, aber alles am Computer gebaut. Sie hat damals, 2000, mit den neuesten amerikanischen Programmen gearbeitet und ist auch ein Beispiel dafür, dass eine Wissenschaftlerin, nämlich eine Medizinerin, sich mit Nietzsche auseinandersetzt und auch mit der Art, digitale Kunst zu machen. Das heißt also jemand, die in diese Gefilde vorstößt und auch diesen Ausspruch von Nietzsche, Kunst unter dem Blickwinkel der Wissenschaft und Wissenschaft unter dem Blickwinkel der Kunst zu betrachten,5 ernst nimmt. Dafür ist sie ein leuchtendes Beispiel.
JP: Können Sie die Zukunftsfähigkeit Nietzsches als Sujet weiter erläutern?
BS: Das ist eine zentrale Frage, die auch diese Künstlerin stellt, die an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee eine Professur hat. Nietzsche bynite [Abb. 7] und transfigure nietzsche: Da steckt der Begriff der Transfiguration drin, der im Werk natürlich mehrere Ankerpunkte hat. (Das als Nebenbemerkung, denn es geht in meinem Buch um Transfigurationen). Transfigurationen sind Veränderungen der Figur Nietzsches durch die Blicke der Künstler. Aber Transfiguration ist auch ein Begriff, den Nietzsche selber anwendet. Sie haben in der Einleitung wahrscheinlich seine Auseinandersetzung mit Raffael [Trasfigurazione di Gesù] gesehen, wo er dieses Motiv für sich als eine Ikone angesehen hat.6 Die Transfiguration ist sozusagen das Synonym für Nietzsches gesamte Philosophie geworden. Er begreift Philosophie und letztlich auch die Kunst als eine Möglichkeit, das Leben auf der Erde, das menschliche Leben in seiner ganzen Problematik, Hässlichkeit, kriegerischen, furchtbaren Ausprägung zu bejahen, indem man es sozusagen transfiguriert. Die Kunst und die Philosophie sind Möglichkeiten, letztendlich zu einer lebensbejahenden Position zu kommen. Das ist der Kern der nietzscheanischen Philosophie, seine Lebensphilosophie: seine Lebensbejahung, trotz aller Misslichkeiten und Umstände.
JP: Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Nietzsche in 20 Jahren in der Kunst dargestellt werden wird?
BS: Nein, also ich persönlich nicht. Damit kommen wir jetzt doch noch mal auf das Thema des Fakes. Ich sehe momentan diese Überschwemmung durch Fakes. Da gibt es auch einige Künstler, die mit Fakes arbeiten, wie beispielsweise Michael Müller, der diese Geburtstagsparty für Nietzsche [Erste und zweite kleine Probe für Nietzsches Geburtstagsparty 2313, 2015] organisiert hat. Ein Berliner Künstler, auch ein sehr, sehr wichtiger international arbeitender Künstler. Michael Müller stellt sich diese Fragen und er bezieht tatsächlich Fakes mit ein. Ich habe ihn darauf angesprochen: „Herr Müller, das ist ein Fake, das ist nicht Nietzsche-authentisch“. – „Ja“, sagte er, „aber mich interessiert genau diese Veränderung, in die Zukunft projiziert“. Er projiziert das wirklich in die Zukunft und sagt im Grunde genommen: auch im Jahr 2313 wird uns Nietzsche noch beschäftigen und er hat diese Performances organisiert, diese Events, wo für diese in der weiten Zukunft liegenden Ereignisse geprobt wird – die Probe als künstlerisches Ereignis. Ihn interessiert die Zukunft des Nietzsche-Bildes. Er ist einer der wenigen bis jetzt, die quasi den Fake gleichsetzen mit den überlieferten Bildern und sagt: „Wir erkennen das an und da darf man gespannt sein …“ Aber ich vermute, dass irgendwann die authentischen Bilder in der Unterzahl sein werden, dass man sie mit der Lupe wird suchen müssen und dass vielleicht in 20 Jahren das Nietzsche-Bildnis sich vollkommen von dem authentischen Philosophen verabschiedet hat. Da gibt es heute schon genügend Beispiele, wo er als Bodybuilding-Star oder so etwas dargestellt wird – so hat er ja niemals ausgesehen. Das ist der Pop Art zuzuschreiben; die interessiert sich nicht für den authentischen Nietzsche. Es geht eben gerade nicht mehr um Monumentalisierung! Es geht heute darum, Nietzsche menschlich zu machen, damit man sich mit ihm wieder neu auseinandersetzen kann. Weg von der Idealisierung, weg von der Monumentalisierung! Ihn sozusagen runterholen auf die Ebene des Dialogs, ihm begegnen. Es gibt sehr viele Beispiele dazu, wo Künstler ihn buchstäblich als Menschen von heute zeigen, als Sportler, als Dialogpartner, als Partygänger und ihn in ein modernes Outfit stecken mit Sneakern an den Füßen oder im Bikerdress. Kann man gut finden, kann man drüber lachen, aber diese Ebene ist jetzt dran! Und eine Idealisierung und Monumentalisierung ist die neue Gefahr der Pop Art, der popularisierenden Kunst, denn da wird er wieder zum Superstar. Nietzsche Superstar, Nietzsche als Superman und so weiter. Das ist alles zu finden und das muss man mit Vorsicht genießen. Es geht gegen die Richtung, die ich mir wünsche, dass man von diesem populären Denken ein bisschen wegkommt und mehr Ernsthaftigkeit diesem Thema angedeihen lässt.
JP: Ja, ich persönlich glaube, es braucht so einen Mittelweg. Einerseits darf Nietzsche nicht zu exklusiv sein, andererseits nicht trivial.
BS: Gerade die zeitgenössischen Werke suchen neue Wege, ihn für andere Zielgruppen aufzubereiten …, gerade diese Verjüngung, die er durchmacht, diese Modernisierung und Verjüngung, die spricht natürlich eine neue Zielgruppe an. Da bin ich ganz offen, wenn er jetzt seinen altertümlichen Gehrock ausgezogen bekommt.
Barbara Straka, geb. 1954 in Berlin, studierte Kunstpädagogik/Germanistik und Kunstgeschichte/Philosophie in Westberlin. Sie initiierte als Kuratorin und Kunstvermittlerin seit 1980 Ausstellungen und Großprojekte zeitgenössischer Kunst im In- und Ausland. Sie war Direktorin des ‚Haus am Waldsee Berlin – Ort internationaler Gegenwartskunst‘, Präsidentin der niedersächsischen Kunstuniversität HBK Braunschweig sowie Referentin für Kultur- und Kreativwirtschaft und für Internationales beim Senat Berlin. Sie ist Autorin und Herausgeberin zahlreicher Veröffentlichungen zur Kunst nach 1945 (www.creartext.de).
Jonas Pohler wurde 1995 in Hannover geboren. Er studierte Germanistik in Leipzig und schloss das Studium mit einem Master zum Thema „Theorie des Expressionismus und bei Franz Werfel“ ab. Er arbeitet jetzt in Leipzig als Sprachlehrer und engagiert sich in der Integrationsarbeit.
Literatur
Straka, Barbara: Nietzsche forever? Friedrich Nietzsches Transfigurationen in der zeitgenössischen Kunst. Basel: Schwabe Verlag 2025.
Abbildungsverzeichnis
Artikelbild:
Thomas Hirschhorn: Nietzsche Car, 2008, mixed media, Programa Allgarve de Arte Contemporânea, Antiga Lota no Passeio Ribeirinho, Protimão, Portugal. Courtesy Fondation Jan Michalski pour l´écriture et la littérature, Montrichter (CH), Foto: Romain Lopez © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 661.
Abbildung 1:
Katharina Karrenberg: R_A_U_S_CH_PASSAGE, Innenansicht, 2000-2004, Pigmenttinte, Transparentpapier, Acryl, Buchbinderleinen, Aluminium, Eisen, L: 560 x B: 400 cm (innen: 300 cm) x H: 330 cm (innen: 300 cm) © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 490.
Abbildung 2:
Joseph Beuys: Sonnenfinsternis und Corona, 1978, 2-teilige Fotocollage m. Ölfarbzeichnung, 37 x 18 cm, Sammlung Jörg Schellmann, München, Foto: Schellmann Art © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 117.
Abbildung 3:
Marcel Odenbach: Ausblick ohne Gott, 2019/2021, Collage, Fotokopien, Bleistift, Tinte auf Papier, 179,5 x 147,5 cm, Privatsammlung, Foto: Vesko Gösel, Courtesy Galerie Gisela Capitain, Köln © Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 343.
Abbildung 4:
Jonathan Meese: Vier Zeichnungen von 20 aus der Nietzsche-Serie (Nr. III, IV, VII, IX), 2004, Filzstift, Buntstift, Bleistift auf Papier, je 27,8 x 20,9 cm, Fotos: Jochen Littkemann © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 149.
Abbildung 5:
Anna Boghiguian: Eine Arbeit aus der Serie An Incident in the Life of a Philosopher, 2017, Mischtechnik und Collage © Anna Boghiguian. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 560.
Abbildung 6:
Felix Droese: aus dem Zyklus Ohne Titel (‹Ich bin tot, weil ich dumm bin, ich bin dumm, weil ich tot bin.›), 1981, vier Blindzeichnungen von 151 (Nr. 21, 26, 19, 144), Bleistift auf Papier, je 29,5 x 21 cm, Fotos: Manos Meisen © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 617.
Abbildung 7:
Tyyne Claudia Pollmann: Nietzsche bynite, 2020, Computersimulation, Cibachrome, 81 x 153 cm. © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka, Nietzsche forever?, S. 396 f.
Fußnoten
1: Vgl. den zweiten Teil der Rezension von Michael Meyer-Albert (Link).
2: Vgl. die entsprechende Abbildung im ersten Teil der Rezension von Michael Meyer-Albert (Link).
3: Anm. d. Red.: Vgl. etwa auch die Zeichnungen von Farzane Vaziritabar anlässlich der Tagung Nietzsches Zukünfte 2024 in Weimar (Link).
4: Vgl. dazu detailliert den zweiten Teil der Rezension von Michael Meyer-Albert.
5: Vgl. Die Geburt der Tragödie, Versuch einer Selbstkritik, 2.
6: Vgl. Menschliches, Allzumenschliches II, Der Wanderer und sein Schatten, 73.
„Es geht nicht mehr um Monumentalisierung! Es geht Künstlern heute darum, Nietzsche menschlich zu machen, damit man sich mit ihm neu auseinandersetzen kann.“
Barbara Straka im Gespräch zu ihrem Buch Nietzsche forever?
Im vergangenen Jahr publizierte die Kuratorin und Kunsthistorikerin Barbara Straka eine zweibändige Monographie mit dem Titel Nietzsche forever? Friedrich Nietzsches Transfigurationen in der zeitgenössischen Kunst, in der sie Nietzsches Bedeutung für die bildenden Künste der Gegenwart darlegt. Nachdem Michael Meyer-Albert ihrem Werk in den letzten Wochen eine zweiteilige Rezension widmete (Teil 1, Teil 2), folgt nun ein Interview, das unser Autor Jonas Pohler mit der Autorin in Potsdam führte. Er diskutierte mit ihr über ihr Buch, aber auch über das nicht immer einfache Verhältnis zwischen Philosophie und gegenwärtiger Kunst.
Dionysos als rolling stone
Versuch mit Rock-Musik Nietzsche zu verstehen
Dionysos als rolling stone
Versuch mit Rock-Musik Nietzsche zu verstehen
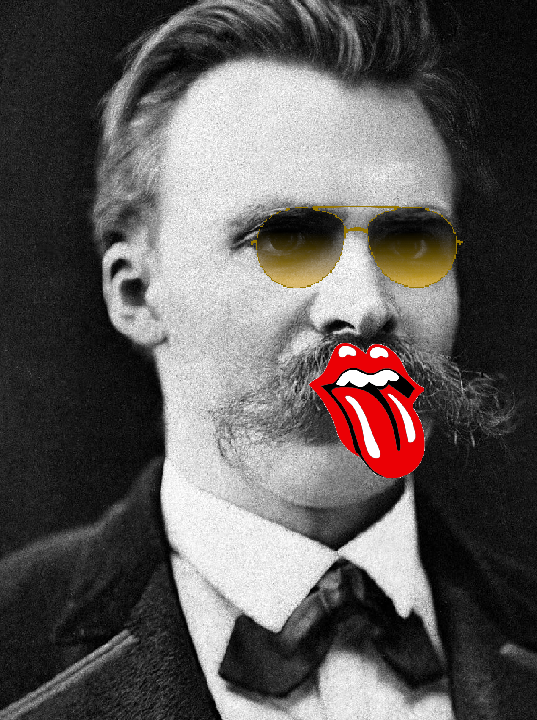

Einerseits hilft Nietzsches Unterscheidung des Apollinischen und des Dionysischen die Entwicklung der Rock-Musik der Rolling Stones intern wie extern zu verstehen. Andererseits spiegelt sich Nietzsches Philosophie in ihren Liedern an vielen Stellen. Vor allem aber wird sie durch die Stones auch erhellt, lässt sich durch deren Lieder zeigen, was Nietzsche denkt – ein apollinischer Akt. Wenn sich Nietzsche ästhetisch am Rausch orientiert, dann kann man von den Stones auch lernen, wie man dionysisch Nietzsches Dichtung rezipiert. Es geht also nicht allein darum, mit Nietzsche die Stones zu verstehen, sondern umgekehrt: mit den Stones Nietzsche.
Eine eingelesene Version des Artikels mit Clips der zitierten Songs finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie und auf Soundcloud.
If you meet me, have some courtesy / Have some sympathy, and some taste. Wenn man dazu nicht in der Lage ist, droht der Teufel mit der Zerstörung der Existenz: Or I’ll lay your soul to waste . . . – Sympathy for the Devil vergleicht Jochen Hörisch mit der „besten Schubert-Schumann-Mahler-Tradition des deutschen Kunstliedes“1.

1. Der Teufel und die letzten Menschen
Wer soll dieser Teufel sein? Also singt Jagger: I rode a tank, held a general’s rank / When the blitzkrieg raged. – Nach Friedrich Kittler beruhte der Erfolg der Blitzkriege auf dem UKW-Funk. Ergo: „Alle Autoradios, die uns zum Sound der Stones an ihre geliebte Cote d’Azur trugen, haben nur dieses Betriebsgeheimnis des Blitzkriegs übernommen.“2 Hat der Teufel den Stones den Weg geebnet?
Wer ist dieser Teufel? Kurt Flasch erläutert seine Herkunft: Nicht das Judentum, nicht der Islam, die „Christen waren es, die ihn erhoben zum mächtigsten Gegenspieler Gottes. [. . .] [A]ber er sah ihm auch verdammt ähnlich.“3
Das unterstellt Nietzsche den Christen, während die Buddhisten den Teufel nicht nötig haben: „[M]an hatte einen übermächtigen und furchtbaren Feind, – man brauchte sich nicht zu schämen, an einem solchen Feind zu leiden.“4
Wer ist der Teufel? Für Flasch der Helfer Gottes! Für Nietzsche eine Ausrede! In der Mitte des Liedes findet sich die Erklärung: Who killed the Kennedys? When after all / It was you and me.
Wer ist der Teufel? Die Mitmenschen, die sich des Teufels im Sinne Nietzsches als Ausrede bedienen! Nach Zarathustra wäre das „der letzte Mensch, der Alles klein macht.“5 Sind wir alle Teufel, just as every cop is a criminal?
Die Stones setzen Nietzsches Bemerkung um: „Das Schlimmste aber sind die kleinen Gedanken. Wahrlich besser noch bös gethan, als klein gedacht!“6
So spiegelt das Lied auf der LP Beggars Banquet den unruhigen Geist von 1968. Der Teufel tritt als ein Herr mit Manieren auf: Please allow me to introduce myself / I’m a man of wealth and taste. Sind die reichen Kapitalisten die Teufel?
Stehen die Stones auf der Seite der protestierenden Jugend? In der Monarchie nannte man solche Leute ‚Gesindel‘. Gespielt entsetzt sich Nietzsche: „[I]ch fragte einst und erstickte fast an meiner Frage: wie? Hat das Leben auch das Gesindel nöthig?“7
Gehören zum Gesindel auch Aussteiger oder Absteiger? Bob Dylan erzählt 1965 im Song Like a Rolling Stone von einer sozial gestrauchelten Dame:
You used to laugh about
Everybody that was hanging out.
Now you don’t talk so loud,
Now you don’t seem so proud
About having to be scrounging your next meal.
So fragt Dylan im Refrain:
How does it feel, how does it feel?
To be on your own, with no direction home,
A complete unknown, like a rolling stone.
Am Abstieg der Dame haben Männer einen wesentlichen Anteil:
You used to be so amused
At Napoleon in rags and the language that he used
Go to him he calls you, you can’t refuse
When you ain’t got nothing, you got nothing to lose
You’re invisible now, you’ve got no secrets to conceal.
Die Wendungen des Textes erfordern eine Reflexion wie viele Lieder Dylans, die zum kritischen Nachdenken anregen, weniger zum hingebungsvollen Mitsingen.
2. Bob Dylans apollinische Balladen oder dionysisch „lauter werden“ (Grace Slick)
War den Stones dieses Lied zu apollinisch? Nietzsche unterscheidet nämlich zwei ästhetische Formen, die dionysische und die apollinische. Apollo als Gott der bildnerischen Künste tröstet mit der Kunst den Menschen angesichts von dessen isolierter Existenz. Nietzsche schreibt: „Apollo [. . .] zeigt uns, mit erhabenen Gebärden, wie die ganze Welt der Qual nöthig ist, damit durch sie der Einzelne zur Erzeugung der erlösenden Vision gedrängt werde“8.
So bemerken Max Horkheimer und Theodor Adorno über Odysseus während der Vorbeifahrt an der Insel der Sirenen: „Der Gefesselte wohnt einem Konzert bei, reglos lauschend wie später die Konzertbesucher, und sein begeisterter Ruf nach Befreiung verhallt schon als Applaus.“9
Die Stones spielten Like a Rolling Stone selbst auf verschiedenen Konzerten und sogar zusammen mit Dylan, unter anderem 1998 auf einem Konzert in Buenos Aires, bei dem das Publikum ausgelassen mitsingt, sich gar nicht apollinisch verhält, um zu reflektieren, was ihm vorgesungen wird, sondern dionysisch.10 Dionysos, der Gott des Rausches, lässt den Menschen seine isolierte Existenz vergessen. Nietzsche schreibt: „Unter dem Zauber des Dionysischen schließt sich nicht nur der Bund zwischen Mensch und Mensch wieder zusammen.“11
Dagegen Herbert Marcuse: „Die ‚Gruppe‘ [. . .] ist ‚totalitär‘ [. . .]. Zwar nehmen die Zuhörer aktiv an einem solchen Spektakel teil: die Musik bewegt ihre Körper, macht sie ‚natürlich‘. Aber ihre (buchstäblich) elektrische Erregung nimmt oft hysterische Züge an.“12
Marcuse mokiert sich über die Bemerkung von Grace Slick von Jefferson Airplane: „Unser ständiges Lebensziel, sagt Grace mit völlig ausdrucklosem Gesicht, ist, lauter zu werden.“13
Freilich hätte Marcuse von Arthur Danto lernen können, dass das dionysische Element der Kunst keineswegs irrational ist. So Danto 1965:
Nietzsche Kategorienpaar [apollinisch / dionysisch] mit Rationalität und Irrationalität gleichzusetzen wäre allzu vordergründig. Letztlich handelt es sich beim Träumen um nichts Rationaleres als beim Tanzen, und die Musik [. . .] ist auch nicht weniger rational als die Dichtung.14
Dylans Lied setzen die Stones 1972 mit Tumbling Dice einen programmatischen Song entgegen: Aus dem rollenden Stein wird ein taumelnder Würfel, auch ein sozialer Außenseiter:
Women think I’m tasty, but they’re always tryin’ to waste me
And make me burn the candle right down,
But baby, baby, I don’t need no jewels in my crown.
Frauen wollen den attraktiven Mann binden, der sich zum damaligen Zeitpunkt noch mit Finanz- und Drogenproblemen herausreden kann:
Honey, got no money,
I’m all sixes and sevens and nines.
Say now, baby, I’m the rank outsider,
You can be my partner in crime.
Bekommt sie dann wenigstens das, was Nietzsche dichtet:
Sie hat jetzt Geist – wie kam’s, dass sie ihn fand?
Ein Mann verlor durch sie jüngst den Verstand,
Sein Kopf war reich vor diesem Zeitvertreibe:
Zum Teufel ging sein Kopf – nein! nein zum Weibe!15
Jagger war ein homme des femmes, der die männliche Sexyness jener Zeit wie kaum ein zweiter verkörperte und dementsprechend vergöttert wurde. Weil er die viel zu vielen Angebote immer nur partiell annehmen kann, verliert er seinen Verstand nicht: Baby, I can’t stay, you got to roll me / And call me the tumblin’ dice.
Das sich unendlich wiederholende Got to roll me, keep on rolling erinnert umso mehr an Like a Rolling Stone, damit an den Namen der Band, und diverse Formen von Außenseiterexistenzen, die die Stones in ihren Anfängen selber waren und die sie noch 2023 in Whole Wide World thematisieren:
When the whole wide world’s against you
And you're standing in the rain,
When all your friends have let you down
And treat you with disdain.

3. Dionysischer Abschied von apollinischer Reflexion
Im Mai 1965 veröffentlichen die Stones Satisfaction, in dem es heißt:
When I'm watchin’ my T.V.
And a man comes on to tell me
How white my shirts can be
But he can’t be a man ‘cause he doesn’t smoke
The same cigarettes as me
I can't get no …
Schon damals verklausulieren die Stones ihre Liedtexte stellenweise so, dass sie verwirrend wirken. Das Lied kritisiert apollinisch den Konsum.
When I’m ridin’ round the world [. . .]
I’m tryin’ to make some girl
Who tells me: “Baby better come back maybe next week,
‘Cause you see, I’m on a losing streak”.
Zur damaligen sexuellen Revolution gehört auch die Verweigerung, wenn die umworbene Dame keine Lust hat trotz Anti-Baby-Pille, die nach Hans Blumenberg „die einzige wirklich bedeutende Veränderung des menschlichen Verhaltens in unserem Jahrhundert“16 hervorruft.
Andererseits lassen sich Rock-Konzerte als Wiederkehr alter Traditionen der dionysischen Feste verstehen. So schreibt Nietzsche:
Aus allen Enden der alten Welt [. . .] können wir die Existenz dionysischer Feste nachweisen [. . .]. Fast überall lag das Zentrum dieser Feste in einer überschwänglichen geschlechtlichen Zuchtlosigkeit, deren Wellen über jedes Familienthum [. . .] hinweg flutheten[.]17
In der Antike hatte man ein positives Verständnis von sexueller Lust, die nicht wie im Christentum als Sünde entwertet wird. Negativ ist vielmehr, so Michel Foucault wenn „man gegenüber den Lüsten passiv bleibt.“18
Das ursprüngliche Lied Satisfaction aus dem Jahr 1965 klingt dabei als ein apollinischer Protestsong ähnlich den Liedern Dylans. Später transformieren die Stones das Lied so, dass es einen dionysischen Charakter erhält, der das Publikum mitreißt und mitsingen lässt, z. B. im Konzert Havana Moon 2016.19
Natürlich gab es seit den Anfängen der Stones schon starke dionysische Tendenzen. So singt Jagger 1967: Let’s spend the night together now. Und er sagt, worum es geht:
This doesn’t happen to me every day, oh my,
No excuses offered anyway, oh my,
I'll satisfy your every need
And now I know you will satisfy me.
Oh come on now
Oh baby, my, my, my …
Dabei war die Prüderie in den sechziger Jahren weit verbreitet. So könnte man meinen, dass Zarathustras Forderung immer noch relevant ist wie 1967, als die US-Regierung glaubte den Vietnamkrieg zu gewinnen. Also sprach Zarathustra:
So will ich Mann und Weib: kriegstüchtig den Einen, gebärtüchtig das Andre, beide aber tanztüchtig mit Kopf und Beinen. Und verloren sei uns der Tag, wo nicht Ein Mal getanzt wurde!20
Die Rock-Musik war auch die Musik des Vietnam-Krieges. Zum Krieg gehört der Tanz wie der Rausch mit Haschisch und LSD. So musste Jagger 1969 zugeben: Now you can’t (always get what you want), yeah, / And if you try sometimes, you just might find: / You get what you need.
Dabei bleibt man nicht ganz erfolglos, wie Camus bemerkt: „Seine Auflehnung [. . .] so stark wie möglich empfinden – das heißt: so intensiv wie möglich leben.“21 Das berühmte Trotzdem, das Camus den Nazis entgegenschleuderte, veralltäglichen die Stones. Widerstand findet im Kleinen statt.
Im Konflikt der Geschlechter bekommt man nicht, was man will, zieht sich vielmehr Verletzungen zu. So lässt Nietzsche Ariadne klagen: „[M]ein Henker-Gott! . . . / Nein! / Komm zurück! / Mit allen deinen Martern! / […] Mein Schmerz! / Mein letztes Glück!“22 Die Stones singen:
And I saw her today at the reception.
In her glass was a bleeding man.
She was practiced at the art of deception.
Well, I could tell by her blood-stained hands.
Nietzsche lamentiert über George Sand: „Das Schlimmste freilich bleibt die Weibskoketterie mit Männlichkeiten, mit Manieren ungezogener Jungen. – Wie kalt muss sie bei alledem gewesen sein, diese unausstehliche Künstlerin!“23
Die Rock-Musik, ob vor dem Grammophon oder in der Arena, ist Trost und Ablenkung. So schreibt Nietzsche über die dionysische Kunst: „[W]ir werden gezwungen, in die Schrecken der Individualexistenz hineinzublicken – und sollen doch nicht erstarren.“24 Oder etwas einfacher und trotzdem hoch dionysisch: You can’t always get what you want.
Probleme, sexuelle Anspielungen diskret äußern zu müssen, sind 1981 weitgehend verschwunden – allerdings sicher nur in der westlichen Welt. Die Stones sind aber fast auf der ganzen Welt populär und geben überall Konzerte. So durchzieht ein Doppelsinn Start Me Up. Harmlos klingt der Anfang des Liedes: If you start me up, / I'll never stop. Doch gleich folgen anzüglichen Worte: I've been running hot, / You got me ticking, now don't blow my top. Unzweideutig ist die folgende Zeile: You make a grown man cry.
Das Lied gipfelt in dem eindeutigen Satz, den man freilich harmlos lesen könnte, wenn die Stones nicht manchmal halbnackt auf der Bühne turnten: You, you make a dead man come.
Lässt sich dadurch Nietzsche Gedicht verstehen:
„Die Welt ist tief,
„Und tiefer als der Tag gedacht.
„Tief ist ihr Weh –,
„Lust – tiefer noch als Herzeleid:
„Weh spricht: Vergeh!
„Doch alle Lust will Ewigkeit –,
„– will tiefe, tiefe Ewigkeit!“25
Allerdings entsteht Lust im Spiel mit der Unlust. Daher folgt nach Vladimir Jankélévitch die ironische Liebe dem Prinzip „Wenig von allem, und nicht: Alles von Einem.“26
Dann erhalten Bemerkungen in Start me up einen nichttechnischen Sinn: My eyes dilate, my lips go green, / My hands are greasy, she’s a mean, mean machine.
Ist das diskriminierend? Wenn man es harmlos versteht, nicht wenn man es anzüglich liest. Derart lässt sich Nietzsche interpretieren:
Damit es Kunst giebt, […] dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich: der Rausch. Der Rausch muss erst die Erregbarkeit der ganzen Maschine gesteigert haben: eher kommt es zu keiner Kunst. Alle [. . .] Arten des Rausches haben dazu die Kraft: vor Allem der Rausch der Geschlechtserregung[.]27
4. Sweet Sound of Heaven „jenseits von Gut und Böse“
Kehren sich die Stones in den letzten Jahren vom Dionysischen ab? So beginnt das gospelartige Sweet Sound of Heaven aus dem Jahr 2023 mit: Bless the Father, bless the Son.
Aber schwerlich kann man den Stones vorwerfen, was Nietzsche moniert:
[D]ie Künstler aller Zeiten [. . .] sind die Verherrlicher der religiösen und philosophischen Irrthümer der Menschheit, und sie hätten dies nicht sein können ohne den Glauben an die absolute Wahrheit derselben[.]28
In der Tat wird man von absoluten Wahrheiten in den Liedern der Stones kaum etwas finden. Das Dionysische ist ein Relativismus. Das Apollinische in der Kunst neigt zu unveränderlichen Wahrheiten. Doch Jagger singt:
No, I’m not, not goin’ to Hell
In some dusty motel [. . .]
I’m gonna laugh, [. . .], I’m gonna cry.
Eat the bread, drink the wine
‘Cause I'm finally, finally quenchin’
My thirst, yeah.
Und was wünschen sich die Stones? I want to be drenched in the rain of your heavenly love.
Das klingt hypererotisch, fast pornographisch. Und gar nicht demütig, sondern sündhaft:
And we all feel the heat
Of the sun,
Let us sing, let us shout,
Let us all stand up proud,
Let the old still believe
That they’re young.
Denn der Stolz bzw. der Hochmut ist die höchste christliche Todsünde.
Auch Nietzsches Gedicht Sils-Maria bezweifelt Selbstverständlichkeiten:
Hier sass ich, wartend, wartend, – doch auf Nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Geniessend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.
Da, plötzlich, Freundin! wurde Eins zu Zwei –
– Und Zarathustra gieng an mir vorbei . . .29
Die Rock-Musik hatte von Anfang an dionysische Züge, aber auch immer noch einen apollinischen Charakter, der sich bei den Stones im Laufe der Jahrzehnte zunehmend verliert. Es geht immer mehr um den Rausch, nicht mehr um die Reflexion. Wo sich diese noch in den Texten hält, liegt das mehr an der Doppeldeutigkeit, die zu reflektieren dionysisch zunehmend überflüssig wird wie in Nietzsches Sils-Maria, wenn man darauf verzichtet, es zu reflektieren und man es als eine Art Rock ‚n‘ Roll genießt.
Artikelbild
Die Stones an einer Leipziger Hauswand in der Wurzener Straße, gemalt von einem unbekannten Künstler, photographiert von Paul Stephan, der hier fast jeden Tag vorbeifährt.
Literatur
Adorno, Theodor W. & Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung (1944), Frankfurt a. M. 1971.
Blumenberg, Hans: Beschreibung des Menschen. Aus dem Nachlass. Frankfurt a. M. 2006.
Camus, Albert: Der Mythos von Sisyphos (1942). Hamburg 1959.
Danto, Arthur C.: Nietzsche als Philosoph (1965). München 1998.
Flasch, Kurt: Der Teufel und seine Engel. Die neue Biographie. München 2015.
Foucault, Michel: Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit 2 (1984), Frankfurt a. M. 1989.
Hörisch, Jochen: A Man Of Wealth And Taste. Jaggers Lucifer trifft Goethes Mephisto. In: Albert Kümmel-Schnur (Hrsg.): Sympathy for the devil. München 2009.
Jankélévitch, Vladimir: Die Ironie (1964). Berlin 2012.
Kittler, Friedrich: When The Blitzkrieg Raged. In: Albert Kümmel-Schnur (Hrsg.): Sympathy for the devil. München 2009.
Marcuse, Herbert: Konterrevolution und Revolte (1972). Frankfurt a. M. 1973.
Fußnoten
1: A Man Of Wealth And Taste, S. 29.
2: When The Blitzkrieg Raged, S. 139.
3: Der Teufel und seine Engel, S. 77.
5: Also sprach Zarathustra, Vorrede, Abs. 4.
6: Also sprach Zarathustra, Von den Mitleidigen.
7: Also sprach Zarathustra, Vom Gesindel.
8:Die Geburt der Tragödie, Abs. 4.
9: Dialektik der Aufklärung, S. 34.
10: Vgl. diesen Mitschnitt des Konzerts auf YouTube. Die Stones traten in Buenos Aires in kurzer Folge fünf Mal hintereinander auf und erreichten dabei insgesamt 272.000 Zuschauer. Aus der Aufzeichnung des letzten dieser Konzerte machten sie einen Konzertfilm.
11: Die Geburt der Tragödie, Abs. 1.
12: Konterrevolution und Revolte, S. 135.
13: Ebd., S. 135, Fußnote.
14: Nietzsche als Philosoph, S. 66.
15: Die fröhliche Wissenschaft, Vorspiel, Nr. 50.
16:Beschreibung des Menschen, S. 479.
17: Die Geburt der Tragödie, Abs. 2.
18: Der Gebrauch der Lüste, S. 35.
19: Vgl. diesen Mitschnitt des Konzerts auf YouTube. Dem Konzert in der Hauptstadt Kubas, trotz des Einschreitens des Vatikan am Karfreitag zelebriert, wohnten 500.000 begeisterte Fans bei, es wurde als Kinofilm aufgezeichnet.
20: Also sprach Zarathustra, Von alten und neuen Tafeln, Abs. 23.
21: Der Mythos von Sisyphos, S. 56.
22:Dionysos-Dithyramben, Klage der Ariadne.
23: Götzen-Dämmerung, Streifzüge, Abs. 6.
24: Die Geburt der Tragödie, Abs. 17.
25: Also sprach Zarathustra, Das Nachtwandler-Lied, Abs. 12.
26: Die Ironie, S. 35.
27: Götzen-Dämmerung, Streifzüge, Aph. 8.
28: Menschliches, Allzumenschliches I, Aph. 220.
29: Die fröhliche Wissenschaft, Liedes des Prinzen Vogelfrei, Sils-Maria.
Dionysos als rolling stone
Versuch mit Rock-Musik Nietzsche zu verstehen
Einerseits hilft Nietzsches Unterscheidung des Apollinischen und des Dionysischen die Entwicklung der Rock-Musik der Rolling Stones intern wie extern zu verstehen. Andererseits spiegelt sich Nietzsches Philosophie in ihren Liedern an vielen Stellen. Vor allem aber wird sie durch die Stones auch erhellt, lässt sich durch deren Lieder zeigen, was Nietzsche denkt – ein apollinischer Akt. Wenn sich Nietzsche ästhetisch am Rausch orientiert, dann kann man von den Stones auch lernen, wie man dionysisch Nietzsches Dichtung rezipiert. Es geht also nicht allein darum, mit Nietzsche die Stones zu verstehen, sondern umgekehrt: mit den Stones Nietzsche.
Eine eingelesene Version des Artikels mit Clips der zitierten Songs finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie und auf Soundcloud.
Monumentalitätsprobleme. Nietzsche in der Kunst nach 1945
Gedanken zum Buch Nietzsche forever? von Barbara Straka II
Monumentalitätsprobleme. Nietzsche in der Kunst nach 1945
Gedanken zum Buch Nietzsche forever? von Barbara Straka II


In Barbara Strakas neu erschienenem Buch Nietzsche forever? wird der Frage nachgegangen, wie Nietzsche in der Kunst des 20. Jahrhunderts, insbesondere derjenigen nach 1945, rezipiert wird. Dabei stellt sich allerdings bei der Rezeption der Rezeption von Nietzsche die Frage, ob der Philosoph in seiner Monumentalität aus dem Blick gerät. Zeigt das ein grundsätzliches Problem der heutigen Zeit mit Monumentalität? Michael Meyer-Albert plädiert jedenfalls, von Nietzsche ausgehend, gegen Straka für einen „postmonumentale Monumentalität“ als Gegenentwurf zum ästhetischen Postmodernismus. Im ersten Teil des Zweiteilers widmete er sich ihrem Buch, nun akzentuiert er seine Gegenposition.
III. Pferdeumarmung
Besondere Deutungskraft für den philosophisch interessierten Leser gewinnt Strakas Beobachtung, dass es vor allem bestimmte Details aus dem Werk und Leben Nietzsches waren, die für die Kunst nach 1945 entscheidend wurden. Zentral dafür ist die Geste der Umarmung eines Pferdes. Im Januar 1889, so lautet eine Anekdote, die sich vermutlich so oder so ähnlich abspielte, sah Nietzsche in Turin, wie ein Kutscher ein Pferd malträtierte. Er lief zu dem Pferd, umarmte es und schützte es so vor den Schlägen. Ab dieser Szene, die für einiges Aufsehen sorgte, wurde an Nietzsche eine geistige Zerrüttung wahrgenommen und er verbrachte sein Leben in pflegerischer Betreuung.
Straka erfasst diesen Augenblick in Nietzsches Leben prägnant: „Nach dem Turiner Vorfall gab es den Philosophen Nietzsche nicht mehr.“ (S. 517) Die Bedeutung für die Rezeption Nietzsches liegt darin, dass seine Philosophie der Lebensbejahung, die mitunter schon vorher, aber vor allem in seinem späten Denken oftmals in eine Willensmetaphysik mit sozialdarwinistischen Zügen verfiel, einen biographischen Kontrapunkt erhält. Die Wahrheit des Lebens siegte über eine Philosophie des unbedingten Siegens. Straka resümiert:
Die „Turiner Pferdeumarmung“ ist eine Legende, aber sie ist nicht dazu geeignet, Nietzsche in der zeitgenössischen Kunst wieder zu einem Mythos zu machen oder zu einer Kultfigur zu stilisieren; sie macht ihn erst eigentlich zum Menschen, weil sie den Sturz eines im Wahn selbst ernannten Gottes vorführt. Damit kommt ihr innerhalb der Themen und Motive der jüngeren Kunst zu Nietzsche eine Schlüsselrolle zu. […] [F]ür die Nachwelt ist Nietzsche kein Gescheiterter, setzte sein geistiger Zusammenbruch in Turin keinen Endpunkt, sondern einen Ausgangspunkt zu einer neuen, empathischen Sicht auf Person, Leben und Werk.1
Nietzsche erscheint nun nicht mehr als ein Monstrum an Kreativität, das eine prekäre triumphalistische Lebensphilosophie verkörperte, sondern als verletzlicher Denker, der unter massiven gesundheitlichen Problemen (etwa Clusterkopfschmerzen) litt und sozial ortlos zu einem steten Reisen als Suche nach erträglichen und erschwinglichen Aufenthaltsorten gezwungen war. Entscheidend für die Rezeption wurden dabei von Hans Olde 1899 gefertigten Fotoaufnahmen, die den Pflegefall Nietzsche dokumentieren und die „bis heute maßgeblich zu einer überzeugenden Typisierung des Philosophen beigetragen“ (S. 568) haben.
Die Geste der Pferdeumarmung widerlegt implizit die extremistischen Äußerungen des späten Nietzsches, der die zu verklärende Verletzlichkeit des wahrheitsfähigen Tieres falsch zu einer Ontologie des Chaos substanzialisierte, die dann einen letalen Naturalismus als Willen zur Macht legitimiert. Der kranke Nietzsche ist nicht der wahre, aber der wahrere Nietzsche. Die Schwäche eines Nietzsches Bildes, das dessen Scheitern im Leben betont, ist allerdings das Ausblenden einer starken Lebendigkeit, um die es diesem Leben letztlich ging. Der sensible Ikonoklasmus dekonstruiert mit dem Kult sogleich die Ermunterung. Für Straka grenze es an Zynismus, dass die zeitgenössischen Darstellungen eines vitalistischen Nietzsches keinen Bezug mehr auf die Bilder von Olde aufweisen (vgl. S. 664).
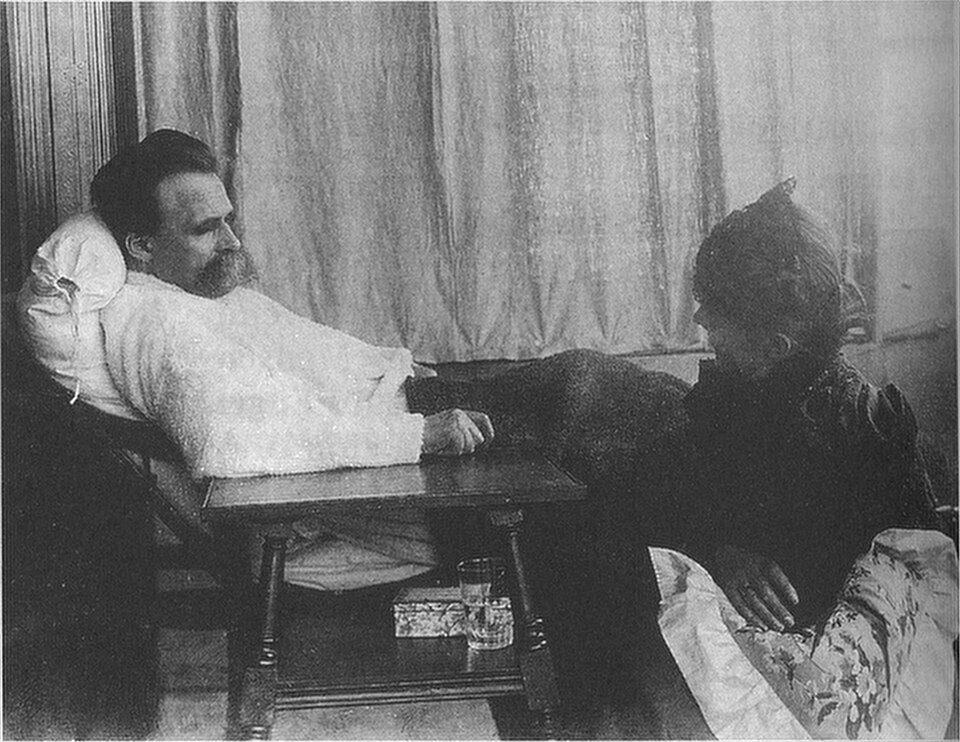
IV. Ein neuer Nietzsche-Kult?
Wo Kult war, soll Mensch werden: So ließe sich der Weg beschreiben, den Nietzsche in der Kunst hinterlassen hat. Dabei drängt sich bei der Rezeption der Rezeption der Kunst die Beobachtung auf, dass Nietzsche womöglich zum zweiten Mal einem Kult zum Opfer gefallen ist. Er wurde in den Künsten zunächst über-, sodann untermonumentalisiert. Nietzsche wird Mensch als Leidender, Kranker, Zerbrechlicher und Nietzsche wird Mensch in den vielfältigen Verallzumenschlichungen, die in der Pop-Kultur am ausdrücklichsten erscheint, jedoch auch den Zugang zu Nietzsche in der ambitionierteren zeitgenössischen Kunst dominiert. Straka bejaht diese Tendenz:
Heroismus, Pathos und Monumentalisierung, die den Nietzsche-Kult nach 1900 charakterisierten, sind differenzierteren Darstellungen eines widersprüchlichen, anstößigen, aber auch menschlichen, persönlichen, ja privaten Nietzsche gewichen, der auf keinen Denkmalsockel mehr passt.2
Diese Tendenz des Antimonumentalen lässt sich aber nicht nur als wohltuende Neutralisierung von überzogenen Deutungen begreifen, als „Endphase der Dekonstruktion des einstigen Kultbildes Nietzsche“ (S. 663), sondern sie trägt Züge eines neuen Kultes. Er lässt sich als ein Derivat einer die gesamte Moderne umfassenden ikonoklastischen Kulturbewegung begreifen. Alles Alte wird vor den Richtstuhl der Vernunft gezogen. So erhält der Wert des Neuen die höchste Wertigkeit. Kultur als Imitation des Vortrefflichen weicht einer zwanghaften Freiheit, die nur als Innovation an sich glauben kann und sich als Distanz von konkurrierender Innovation als Innovationsinnovationen selbstreferentiell dynamisiert. Man imitiert sich selbst in seiner weltlosen und weltarmen Innovation, um sich auf dem Markt der Aufmerksamkeit als Kult zu stabilisieren. Man wird selbst zu einer Kultur, die sich imitiert, weil die Imitation von vergangener kultureller Größe, die über Realitätsresonanz funktionierte, tabuisiert ist. Nonsens verpflichtet.
Vier Merkmale zeichnen moderne Traditionsphobie auf dem Gebiet der Kunst aus: Sie sakralisiert erstens die spektakelhaften Exzesse der subjektiven Kreativität -– exemplarisch etwa Damien Hirsts For the Love of God (2007; Link) oder Wim Delvoyes Cloaca (2000; Link) –, die um Aufmerksamkeit buhlen, zuungunsten der klassischen Kulturdynamik von ehrfürchtiger Nachahmung und behutsamer Variation, die innerhalb eines Dekorums um beseelende Emotionalität ringen, sie verleiht zweitens Sinn durch plakathafte Konzepte, sie schafft drittens Aufmerksamkeit durch die neue Macht der Ausstellung als Qualitätszuschreibung und sie verkörpert viertens eine informelle Moral, die das „Gutsein“ von Werken durch die simple Umwertung des Stellenwertes „entartete Kunst“ gewinnt:
A) Fuck it! Just express yourself!
Der neue Kult des Antimonumentalistischen wird als Sakralisierung der Kreativität deutlich in den Werken, die keine Welt, sondern nur noch sich selbst als Hyperkreativität ausstellen. Nietzsches Denken wird hier insoweit rezipierbar, als sich in diesem eine legitimierende Idee für die selbstreferentielle Spektakelkreativität finden lässt. Nietzsches „Umwertung der Werte“ wird als Lizenz verstanden, die „konventionellen“ Muster der kanonischen Werke zu verwerfen und einen frivolen Perspektivismus zu verfolgen, bei dem die maximale Originalität als Phänotyp einer kreativen Lebendigkeit erscheint. Dabei wird der Devise gefolgt: Aufmerksamkeitserzeugung durch Erregung und nicht mehr das traditionelle Entwickeln von erstaunlicher Emotionalität. Ein Beispiel hierfür sind etwa die Blätter Der Dunkle Kindgott, Transsilvannietzsche und DR. N. von Jonathan Meese (vgl. S. 151), von denen Straka entzückt ist: Jonathan Meese gelinge es, Nietzsche bis zur Kenntlichkeit zu entstellen (vgl. S. 153).
B) Readymade-Content
Der Bezug auf Nietzsche als den Philosophen der Maske wird in dem Kontext der zeitgenössischen Kunst selbst wieder zu einer Maske. Dabei ist der Pop-Nietzsche explizit, was der neue Kunstnietzsche in der Regel implizit ist: Aura-Marker für die eigenen Produkte. Nietzsche dient als Readymade-Content für inhaltslose Kunst. Man lagert an ihn eine Tiefe der Werke aus, die die Werke selbst nicht mehr besitzen. Vorbei ist damit die kanonische Autorität der Werke, von denen Mörike dichtete: „Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst.“ An Nietzsche wird ein Inhalt delegiert, um sich der Verantwortung der Formen für das „sinnliche Scheinen der Idee“ (Hegel) zu entziehen. Man kann die Werke nur noch als „Konzept“ „verstehen“. Sie werden zu puren Zeichen, zu denen es keine Sprache gibt. Ihre Konzeption sagt, was sie bedeuten sollen. Ihre hyperkreative Hermetik entschlüsselt sich der Hermeneutik einer Ausdrücklichkeit ohne Anschaulichkeit.
Beispiele: Felix Droeses Zeichnungen aus dem Zyklus Ohne Titel („Ich bin tot, weil ich dumm bin, ich bin dumm, weil ich tot bin.“) aus dem Jahr 1981 (vgl. S. 614 ff.) zeigen unbeholfene Skizzen, die von dem Künstler im Dunkeln hergestellt wurden, wobei er, so sein Konzept, intensiv an Nietzsche dachte. Stephan Hubers Zitronenstadel (ursprünglich: „Zarathustra im Zitronenstadel“), aus dem Jahr 2005 zeigt eine Bretterbox, aus der im Allgäuerdialekt aus „Also sprach Zarathustra“ zitiert wird (vgl. 464 f.; Link).
C) „Ausstellungsmacht“ (Heiner Mühlmann)
Werke, die keine Welt mehr ausstellen, werden durch den Ort ihrer Ausstellung zu Werken. Die Präsentation im Museum, im öffentlichen Raum oder auch in einem Buch über zeitgenössische Kunst verleiht die Würde des Hochkulturellen.3 Die implizite Kompetenz des ästhetischen Werkes weicht dem seelischen Zustand der „Ausstellungstrance“ (Mühlmann), die pseudokulturelles Wasser zum hochkulturellen Wein veredelt. Der Sockel, von dem alle monumentalistischen Werke heruntergeholt werden sollen, lebt so versteckt fort in dem Gestus der Präsentation. Nachdem das dekorative Ornament zu „abstrakter Kunst“ geadelt wurde, wird das Museum als Installation von Kasimir Malewitschs4 Werkkonzept zu dem weißen 3-D-Quadrat als Kunstwerkernennungskunstwerk. Kunst ist die Macht des Raumeffektes. „Das Museum stellt nichts mehr aus. Es stellt sich selbst aus.“5 Es kommt in dieser Ausstellung der bloßen Aura der Ausstellung zu inhaltsloser, uninformativer kultureller Imitation, die als „selfish cultural variant“6 (Mühlmann) die wertvollen Kapazitäten des Nachahmens, aus denen etwas zu lernen wäre, besetzt. Sloterdijk ergänzt Mühlmanns Beobachtungen:
Der Weg der Kunst folgt dem Gesetz der Veräußerlichung, das die Macht der Nachahmung gerade dort beweist, wo die Nachahmung am heftigsten geleugnet wird: Es führt von den Künstlern, die Künstler nachahmen, über die Aussteller, die Aussteller nachahmen, zu den Käufern, die Käufer nachahmen. Aus der Devise l’art pour l’art ist vor unseren Augen das Konzept the art system for the art system geworden.7
D) Ententartete Kunst
Der neue Kult des Antimonumentalistischen manifestiert eine Aufladung von Sinn und Wert durch Moral. Nicht das Gutgemachte, sondern das Gute dominiert. Das ästhetische Gebilde wird mit Qualität aufgeladen, weil es in der Tradition der ehemals „entarteten Kunst“ steht.8 Ein „gerahmtes Ornament“ (Mühlmann) kann so als antifaschistische „abstrakte Kunst“ erscheinen. Die Wahrheit der Antinazikunst ist so das Gute, für das sie steht. Nach einer vertiefenden Resonanz in Realitäten wird nicht gefragt. Das Fehlen der Bezüge durch das Werk wird extern durch die Rituale der Rezeption nachgeliefert. Eine moralische Sichtweise auf die Kunst als ententartete stabilisiert sie tribalistisch. Nach innen sendet sie Harmonie, nach außen Aggression. Auf Kritik an dem Mangel an Gehalt wird maximal-moralisch reagiert, indem nicht auf den Einwand eingegangen wird, sondern eine Unterstellungsautomatik in Gang kommt, die etwa Kritik an den zeitgenössischen Werken als bloße „gerahmte Muster“ (Mühlmann) in die hochproblematische Tradition der faschistischen Propaganda rückt.
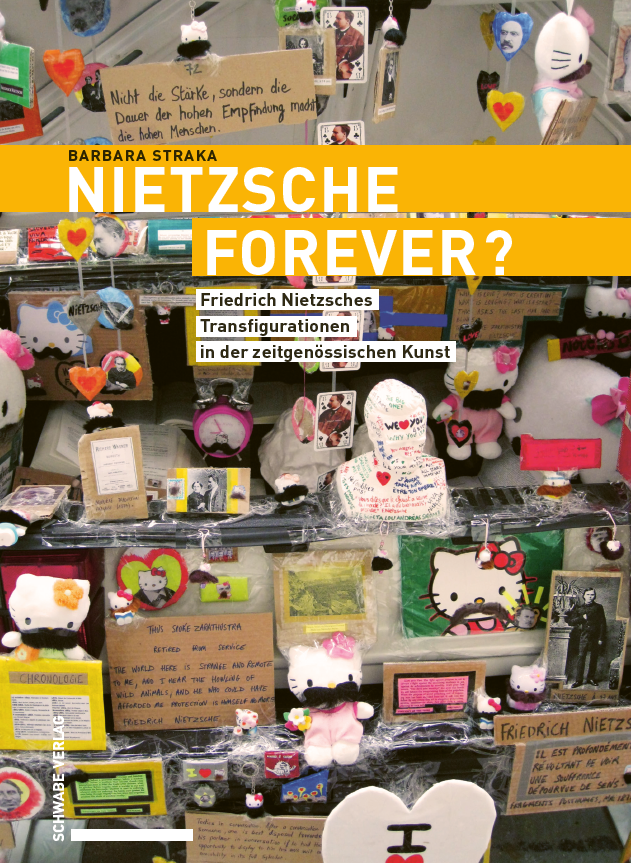
V. Der Kampf um Monumentalität
Genau diese Moralisierung des Ästhetischen ist es, die Strakas Buch insoweit motiviert, als sie sich gegen die Ansichten Christian Saehrendts positioniert; ausdrücklich am Ende ihres Buches in den Danksagungen (vgl. S. 739). Saehrendt, ein Stammautor dieses Blogs, spreche sich lautstark in mitunter schwer erträglichen Trump’schen Tönen für eine Remonumentalisierung Nietzsches aus – „Make Nietzsche great again!“ (vgl. S. 585) –, gerne als großes Denkmal über der Saale. Straka hingegen wehrt sich mit einem differenzierteren, aber auch sehr affirmativen Blick auf den Kunstbetrieb gegen diese – wohl als bewusste Provokation cum grano salis zu nehmenden – Töne und wittert in Saehrendts Äußerungen, seine polemische Zuspitzung in nur schwer erträglicher Weise spiegelnd, gar eine Aktualisierung der Verächtlichmachung der modernen Kunst als „entartete“ (vgl. S. 598).
Vielleicht ließe sich diese Konstellation nutzen, um einen erweiterten Begriff für das Verständnis von Rezeption zu gewinnen? Geht es bei dem Gegensatz von Straka und Saehrendt, insofern er den ihm von Straka unterstellten Standpunkt überhaupt so vertritt, nicht um mehr als Ästhetik? Zeigt sich an dieser besonderen Konfrontation um das Erbe Nietzsches nicht auch der allgemeine Riss, der durch die westliche Welt geht und sich in einem nicht mehr nur kalten Kulturkampf verkörpert? Steht dabei nicht die Frage im Hintergrund, ob bei dem modernen Kampf um den Kampf um die Anerkennung eher die Gerechtigkeit im Sinne von antimonumentalistischer Gleichbehandlung oder eher die monumentalistische Einzigartigkeit im Sinne von Brillanz zu betonen sei? Ließe sich womöglich von Nietzsche ein umfassender Begriff von Monumentalität gewinnen, der bei diesem Kulturkampf ausgeblendet wird?
Die Frage, wie Nietzsche in der Kunst erscheint, ist eine Frage nach der Form der Beziehung, die zur Tradition eingenommen wird. Indem der monumentalistische Nietzsche in den Künsten nach 1945 dekonstruiert wird, wird eigentlich das Monumentalistische als Bezugsform zur Tradition dekonstruiert.
Passenderweise hat Nietzsche selbst einen Essay verfasst, der der Frage der Beziehung zur Tradition nachgeht. Er unterscheidet dabei in seiner zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung mit dem Titel Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben aus dem Jahr 1874 drei Weisen des Umgangs mit der Geschichte: Einen antiquarischen Umgang, der das Vergangene pietätvoll überblickt und bewahren möchte; einen monumentalistischen Umgang, der noch Großem strebt und das Vergangene als Motivation und Vorbild instrumentalisiert; und einen kritischen Umgang, der unter der Vergangenheit leidet und sich davon emanzipieren möchte. Nietzsche kritisiert dabei vor allem die Dominanz des antiquarischen Umgangs mit der Geschichte in seiner Zeit. Durch diese von Hegel philosophisch inszenierte Einstellung werden die Zeitgenossen in die Haltung von Zuschauern bei einem Drama gebracht, an dem sie selbst mitspielen. Der Glaube, nur Zuschauer der eigenen Geschichte zu sein, demoralisiert und erzeugt Zynismus.9
Nietzsches Unzeitgemäße Betrachtung ins Zeitgemäße übersetzt, zeigt eine heutige Überbetonung der kritischen Umgangsweise mit der Tradition, allerdings ohne ein Leiden an dieser. Sie stabilisiert sich in einem Kult der absoluten Innovation. Die Idee kanonischer Klassizität als bewundernswerte Imitationsvorlage fällt aus. Es soll alles vom Sockel gestoßen werden. Es darf keine Übermenschen und Überwerke geben, weil der Schock des Herrenmenschentums und seiner Werke zu tief sitzt. Es fehlt so ein positiver Bezug zur Monumentalität. Dieser Mangel schafft dann als Kompensation einen Neomonumentalismus, der die Züge areflexiver, trotziger Selbstbejahung trägt und nach einer modernisierten Größe strebt, ohne sie zu können. Die Wahrheit des Antimonumentalistischen in der Ästhetik ist die Empathie für die Zeit und eine Sensibilität für ihre Darstellungsart. Die Wahrheit des Neomonumentalistischen ist eine Kritik an der Ausblendung von historischer Größe und der Sinn für das Erhabene. Was fehlt ist eine wohltemperierte Monumentalität.

VI. Postmonumentale Monumentalität
Vielleicht ließe sich, einem Hinweis in Sloterdijk Notizbüchern folgend,10 die These aufstellen, dass das Erhabene, das Nietzsche zuerst in der Kunst verortete und dann in der Religion kritisierte, in der Phase seiner monumentalistischen Rezeption auf die Erhabenheit des Staates und des Militärs umgewertet wurde. In der Phase der antimonumentalistischen Rezeption wurden diese Formen der Erhabenheit kritisiert, aber damit das Erhabene überhaupt ausgeblendet. Was beide Phasen so unterschlagen, ist die Erhabenheit der Evidenz, die bei dem postwagnerischen Nietzsche ins Zentrum rückt und postmetaphysische hohe Töne in der Philosophie erlaubt. Das, was den hohen Ernst verdient, was das Wirkmächtigste ist und höheren Rang beanspruchen kann – auch in den egalitären Zuständen des überkorrekten, überempfindlichen konsensualen Zeitgeistes –, ist die Macht der Wahrheit. Gott ist tot, die Kunst ist Opiat, der Staat Bürokratie und das Militär ein Ort vormoderner Heroik. Aber in der Wahrheit schlägt das Herz der modernen Erhabenheit. Paradoxerweise zeigt sich diese „Wahrheitserhabenheit“ (Sloterdijk) bei Nietzsche als Entdeckung des lebensnotwendigen Scheins. Wahrheit als Wahrheit des Scheins, die stimulieren und schützen soll, kommt nicht mit dem alteuropäischen Pathos daher. Sie tritt nicht in der verkündenden Form des predigenden oder befehlenden Apostels auf, sondern als therapeutisches Experimentieren mit möglichen Erleichterungen. Das Ernsteste wird so als Abklärung, als Entlastung und als belebende und motivierende Lüge verstehbar.
Dieser entscheidende Punkt von Nietzsches Begriff der Erhabenheit findet sich auch in seiner zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung. Nietzsche stellt die These auf, dass der Schein als konstitutiver Aspekt des Lebens eine Art Minimalmonumentalität bedeutet. Leben braucht einen Vorrang des Eigenen vor dem Fremden als einen schützenden Kokon, eine abdichtende Atmosphäre, einen „umhüllenden Wahn“11, der die Horizonte des einströmenden Neuen soweit begrenzt und ausblendet, dass sich ein positives Selbstbild als stabilisiert:
Und dies ist ein allgemeines Gesetz: jedes Lebendige kann nur innerhalb eines Horizontes gesund, stark und fruchtbar werden; ist es unvermögend einen Horizont um sich zu ziehen und zu selbstisch wiederum, innerhalb eines fremden den eigenen Blick einzuschliessen, so siecht es matt oder überhastig zu zeitigem Untergange dahin.12
Dieses kulturelle Immunsystem einer therapeutischen Hybris schützt „die pietätvolle Illusions-Stimmung, in der Alles, was leben will, allein leben kann“13. Die Wahrheit des Lebens ist nicht neutral. Sie ist das genaue Gegenteil einer Perspektive, die das Wahre als Mangel, Entfremdung, Beraubung, Ausbeutung denken will. Der Pessimist Adorno hat Unrecht: Das Ganze als das Unwahre denken zu wollen, ist das Unwahre. Es gibt ein falsches Leben im richtigen. Geschichte monumental verstanden wird zu einem „Mittel gegen die Resignation“14 und motiviert zu einer gesteigerten Lebendigkeit.
Nietzsche selbst gelingt es in den folgenden Jahren, nach seiner Kehre weg vom Wagnerismus, auf diesen Begriff des Scheins aufbauend, Perspektiven freizulegen, die eine avancierte Vorstellung von Monumentalität zeigen. Demnach ist die Monumentalität der Moderne darin zu sehen, dass sie als „Zeitalter der Vergleiche“15 die kultur-psychologische Vorarbeit zu leisten hat für eine weltoffene-weltausblendende Lokalität innerhalb einer globalen postmetaphysischen Ökumene. Dabei geht es um eine Evaluation aller Kulturen im Hinblick auf eine neu zu kombinierende, sich von ressentimen Vergeltungslogiken und von nihilistischen Lethargien distanzierende Vorstellung von vornehmer Vitalität, die vorbildsfähig von zukünftigen Generationen nachgeahmt werden kann. Monumental an unserer Zeit ist die einübende Ritualisierung eines zivilen, globalverträglichen Monumentalismus als Archivsuche und Konstruktionsversuch. Nietzsche selbst spricht von einem kulturellen Experimentieren, an dem sich jeder Heroismus befriedigen könne.16 Und er erwähnt auch die Haltung einer ressentimen Beziehung zur Tradition: „Es gibt freilich sonderbare Menschen-Bienen, welche aus dem Kelche aller Dinge immer nur das Bitterste und das Ärgerlichste zu saugen verstehen; [...]“ und an einem „Bienen-Korb des Mißbehagens“17 bauen.
Der Kunst kommt im „Zeitalter der Vergleiche“ die Aufgabe zu, einen exemplarischen Minimalmonumentalismus – einen Bienen-Korb des Behagens – mitzukonstruieren, der auch angesichts der Aufgabe und den Abgründen des Weltlaufs eine Affirmation der Lage in einer lokal-verdichteten Symbolik plausibel erscheinen lässt. Es gilt, einen Ausdruck für eine Hoffnung zu finden, an die sich glauben lässt. Verklärer aller Länder, vereinigt euch! Kunst steht damit in produktiver Konkurrenz zur Religion und zur Philosophie bei der Arbeit an global-zivilen Verklärungen eines Lebens im nicht nur ökonomischen Wohlstand. Der kategorische Imperativ des postmonumentalen Monumentalismus lautet: Handle so, dass die Wahl der kulturellen Vorbilder, die du imitierst und die dich erziehen, die Permanenz eines nachhaltigen, kreativen und großzügigen Liberalismus so sehr verkörpert, dass dein Leben auch eine mögliche Inspiration für Andere werden kann.

VII. „Nietzsche on a Bike“
In dem Buch von Straka lassen sich einige Werke finden, bei denen eine postmonumentalistische Monumentalität aufscheint. Daran zeigt sich: Wir haben die gelungenen Kunstwerke, um das Dasein des Kunstbetriebs noch erträglich zu finden.
Besonders hervorzuheben ist Mathieu Lacas Bild Nietzsche on a Bike aus dem Jahr 2016 (vgl. S. 665). Es zeigt den Philosophen mit leuchtenden Sportschuhen auf einem Rennrad. Er schaut auf zu dem Betrachter wie ein von seiner Leistung Absorbierter – der angedeutete Kubus um die Figur verstärkt diesen Eindruck – und sein Blick changiert zwischen einem überraschten Angeschautwerden und einem Appell. Möchte man Gedanken in diesen Blick projizieren, könnten sie lauten: „Oh. Was wollen Sie? Steigen Sie selbst aufs Rad. Machen Sie etwas aus sich!“ Nietzsche wird somit exponiert als ein Trainierender, der die Bejahung des Lebens als ein Überwinden auf eine physiologische Weise vollführt, 6.000 Fuß jenseits von Übernietzsche und tiny-Nietzsche.
Der Eindruck von Nietzsche auf Lacas Bild lässt sich auch auf weitere Bereiche des Lebens übertragen. Nach den mobilisierten Massen der rotbraunen und braunroten Berufsrevolutionäre des 20. Jahrhunderts, für die der Kampf immer weitergeht, kommen die athletisierten Massen, die, vom Sport infiziert, glänzende Leistungen vollbringen.18 Das Charisma der tausendjährigen Reiche und der Weltrevolutionen verliert seinen Glanz. Die Weltverbesserung beginnt im Privatleben als Suchen nach der verlorenen Großartigkeit. Make yourself great again and again. Im Geiste Nietzsches: Suche Disziplinen und kultiviere Rituale, die die ressentime Vergeltungslust schwächen, weil sie die leeren Stunden nicht als „Seinsverlassenheit“ (Heidegger) und Entfremdung deuten. Die Zeit erlaubt Studien, die sich dem Bewunderungswürdigen widmen, das zur Nachahmung einlädt und das eine eigene Erfolgsgeschichte der glänzenden Monumentalität entfacht. Nietzsches gebrochene Monumentalität motiviert exemplarisch immer wieder dazu, das Leben monumental aufzurichten. Sein Leben ragt in die Moderne als Denkmal eines „Entschlusses zum Lebensdienste“ (Thomas Mann). Weil die Macht des Großen, das einst war, immer noch andauert, haben wir den Raum mehr zu werden, als wir sind. So wird ein Stolz ermöglicht, der joviale Großzügigkeit ausstrahlt und immun wird, Gefühle von Größe in überdehnte Imperialgelüste zu projizieren. Manche Siege und Niederlagen hat man nicht mehr nötig. Die Geschichte ist zu Ende. Der Kampf geht nicht weiter. Das Trainieren beginnt.
Artikelbild
Mitchell Nolte: Das Turiner Pferd (2019; Quelle) (Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Künstlers.)
Quellen
Mühlmann, Heiner: Countdown. Wien & New York 2008.
Sloterdijk, Peter: Du mußt dein Leben ändern. Frankfurt a. M. 2009.
Ders.: Zeilen und Tage III. Notizen 2013-2016. Berlin 2023.
Straka, Barbara: Nietzsche forever? Friedrich Nietzsches Transfigurationen in der zeitgenössischen Kunst. Basel 2025.
Fußnoten
1: S. 548 f.
2: S. 610.
3: Vgl. hierzu Mühlmann, Countdown, S. 91 ff.
4: Anm. d. Red.: Der osteuropäische Künstler Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch (1879–1935) gilt mit seinem Gemälde Das Schwarze Quadrat (1915) als Stammvater des ästhetischen Modernismus.
5: Ebd., S. 74.
6: „Selbstbezogene kulturelle Variante“.
7: Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern, S. 689.
8: Vgl. Mühlmann, Countdown, S. 63 ff.
9: Vgl. Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, Abs. 8.
10: Vgl. Sloterdijk, Zeilen und Tage III, S. 239 f.
11:Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, Abs. 7.
12: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, Abs. 1.
13: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, Abs. 7.
14: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, Abs. 2.
15: Menschliches, Allzumenschliches I, Aph. 23.
16: Vgl. Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 7.
17: Menschlich, Allzumenschliches, II, Vermischte Meinungen und Sprüche, Aph. 179.
18: Sloterdijk hat instruktiv darauf hingewiesen – vgl. Du mußt dein Leben ändern, S. 133 ff. –, dass mit dem Auftauchen des Typus „Athlet“ seit der Wiedereinsetzung der Olympischen Spiele im Jahr 1896 eine Wiedergeburt der Antike in der Passion für Sport massenhaft glückte. Vom Sport aus bildet der Impuls der Renaissance als Breitentugend weite Bevölkerungsschichten.
Monumentalitätsprobleme. Nietzsche in der Kunst nach 1945
Gedanken zum Buch Nietzsche forever? von Barbara Straka II
In Barbara Strakas neu erschienenem Buch Nietzsche forever? wird der Frage nachgegangen, wie Nietzsche in der Kunst des 20. Jahrhunderts, insbesondere derjenigen nach 1945, rezipiert wird. Dabei stellt sich allerdings bei der Rezeption der Rezeption von Nietzsche die Frage, ob der Philosoph in seiner Monumentalität aus dem Blick gerät. Zeigt das ein grundsätzliches Problem der heutigen Zeit mit Monumentalität? Michael Meyer-Albert plädiert jedenfalls, von Nietzsche ausgehend, gegen Straka für einen „postmonumentale Monumentalität“ als Gegenentwurf zum ästhetischen Postmodernismus. Im ersten Teil des Zweiteilers widmete er sich ihrem Buch, nun akzentuiert er seine Gegenposition.
Amor fati – Eine Anleitung und ihr Scheitern
Reflexionen zwischen Adorno, Nietzsche und Deleuze
Amor fati – Eine Anleitung und ihr Scheitern
Reflexionen zwischen Adorno, Nietzsche und Deleuze

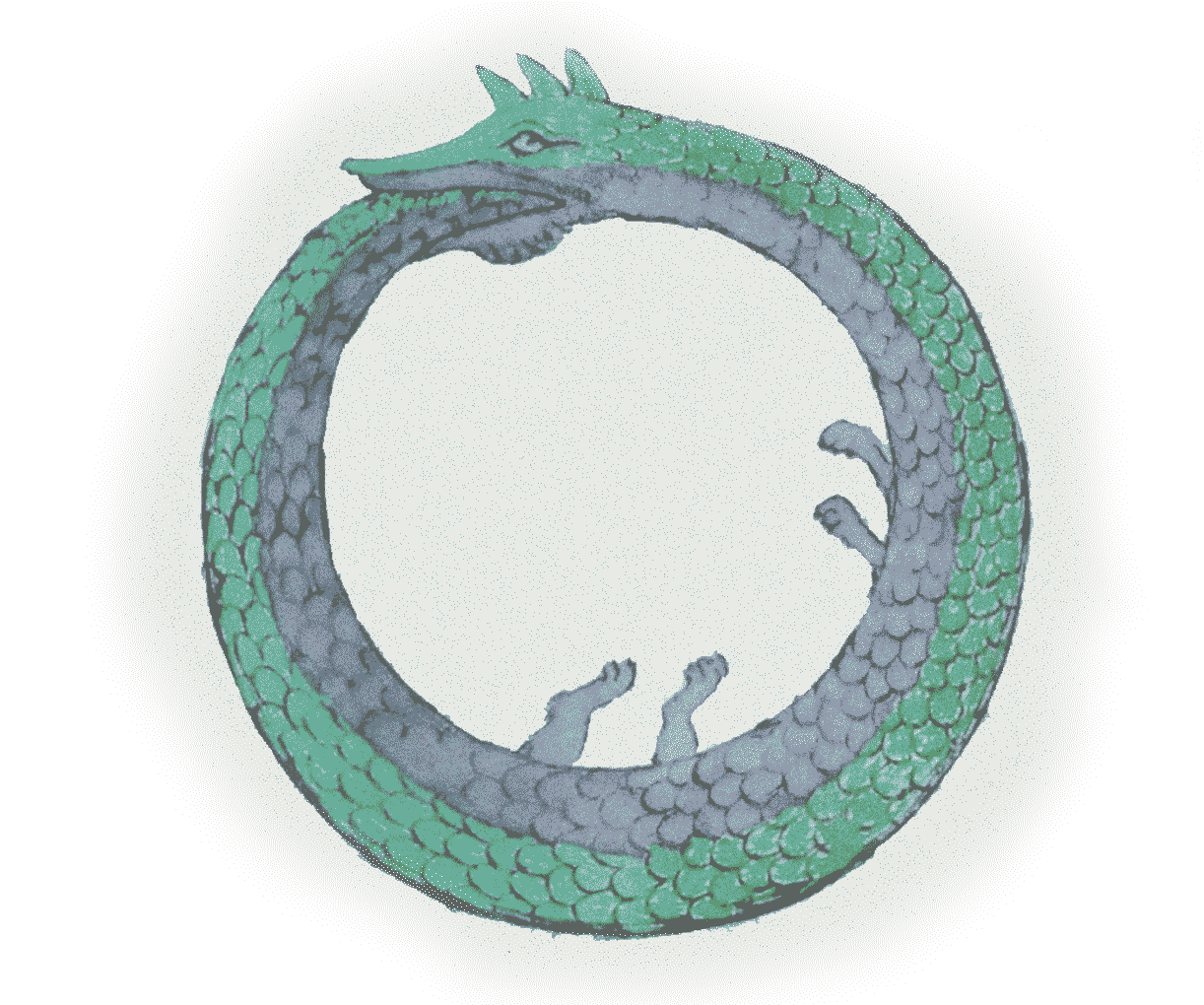
Dieser Artikel versucht, sich zwei der vielleicht rätselhaftesten Ideen Nietzsches anzunähern: der Ewigen Wiederkehr und dem Amor fati, der „Liebe zum Schicksal“. Wie sind diese Ideen genau zu verstehen – und vor allem: Was haben sie uns zu sagen? Wie können wir das als Ewige Wiederkehr gedeutete Schicksal nicht nur bejahen, sondern wirklich lieben lernen?
Unter den Philosophen war es vor allem der „Hauptphilosoph“ des Instituts für Sozialforschung, Theodor W. Adorno (1903-1969), der diesen Ideen Nietzsches skeptisch bis ablehnend gegenüberstand. Wo bleiben in der Haltung des Amor fati die Kritik und die Utopie, deren Banner Adorno und seine Mitstreiter hochhielten?
Im Zuge des allgemeinen Scheiterns der Marxismen bei der theoretischen Bewältigung des Faschismus bemühte sich das Frankfurter Institut ab den 30er Jahren um eine Reorientierung. Der Erfolg dieser Bewegung schien zahlreichen unorthodoxen Marxisten nicht allein aus ökonomischen Gesetzmäßigkeiten heraus verständlich zu sein, es bedurfte ihres Erachtens einer stärkeren Berücksichtigung des „subjektiven Faktors“, also der psychologischen Struktur des bürgerlichen Individuums. Im Rahmen dieses Paradigmenwechsels wandte sich Adorno neben Sigmund Freud auch Nietzsche zu. Für den Rest seines Schaffens bildete dieser einen ständig wiederkehrenden Bezugspunkt für ihn.
Hartnäckig gegenüber Nietzsche blieb Adorno jedoch in einer, für marxistische Nietzsche-Interpreten immer wieder typischen, Hinsicht: dem Beharren auf der Orientierung hin zu einem die Menschheit irgendwie erlösenden Zustand – dessen Vorwegnahme sich vor allem in der Abwertung des Gegenwärtigen manifestiert. Von solcher Warte aus kritisiert er dann auch in seinem aphoristischen Hauptwerk Minima Moralia (1951) – ihm selbst zufolge eine „traurige Wissenschaft […] vom richtigen Leben“1 – Nietzsches Konzept des Amor fati. Nietzsches Wille, „irgendwann einmal nur noch ein Ja-sagender [zu] sein“2, hält er für eine Art Stockholm-Syndrom in der Lebensphilosophie. Eine solche Aufgabe – nicht nur der Bejahung, sondern sogar des Willens zur Bejahung – würde aber einer Preisgabe des Fundamentes für jede lebendige Aneignung der Philosophie Nietzsches gleichkommen. Adornos Kritik aufgreifend soll, unter Bezugnahme auf die Auslegung des wichtigen französischen Nietzsche-Interpreten Gilles Deleuze (1925-1995) ergründet werden, was Nietzsche zur Hand gibt für die universelle und doch immer auch sehr persönliche Frage, weshalb das Dasein doch – und zwar hier und jetzt – bejaht sein will.
I. Wollen wir die Ewige Wiederkehr?
Nietzsches praktischer Philosophie steht man oft etwas ratlos gegenüber. Amor fati, Ewige Wiederkehr – was ist das? Was soll man aus (Quasi-)Imperativen wie „das Nothwendige nicht bloss ertragen, […] sondern es lieben!“3, „ich will irgendwann einmal nur noch ein Ja-sagender sein!“4 und der Frage „willst du diess noch einmal und noch unzählige Male?“5 anfangen? Wie soll man sich selbst dazu bringen, etwas zu wollen, wenn man es nicht will? Gründe könnten bestenfalls etablieren, dass etwas „notwendig“ ist, und als solches zu „akzeptieren“ wäre – aber lieben? Im Zarathustra fragen die „Krüppel“ den Protagonisten des Buches, wie auch sie von seiner Lehre überzeugt werden könnten. Nietzsches „Prophet“ „antwortet“ ihnen, indem er Fragen aneinanderreiht: „Und wer lernte ihn [den Willen] Versöhnung mit der Zeit, und Höheres als alle Versöhnung ist? […] Wer lehrte ihn auch noch das Zurückwollen?“6 In anderen Schriften wird Nietzsche diesbezüglich auch nicht direkter: „[W]ie müsstest du dir selber und dem Leben gut werden, um nach Nichts mehr zu verlangen, als nach dieser letzten ewigen Bestätigung und Besiegelung?“7 Dieses Ausbleiben der Antworten kann frustrieren und fühlt sich nach und nach wie eine Sackgasse an.
Und trotzdem entfaltet doch vor allem die Ewige Wiederkehr immer wieder einen ganz selbstverständlichen Reiz und ein intuitives Verständnis dafür, um was es hier geht. Ist es nicht erstaunlich, dass irgendwie doch verständlich ist, worum es bei der kryptischen Metapher von der Ewigen Wiederkehr geht, obwohl sie als Problem unlösbar scheint? Warum weist man sie da nicht als aberwitzig zurück oder versteht gar nicht erst, was das soll? Verwunderlich ist eigentlich doch nicht die Unlösbarkeit des Problems der Ewigen Wiederkehr, sondern dass wir sie trotzdem verstehen, sie uns nicht loslässt. Gerade weil wir das Problem (und die Antwort womöglich auch) verstehen, kann mit den beim Versuch, auch begrifflich zu fassen, worum es hier geht, aufkommenden Problemen und Frustrationen überhaupt noch etwas angefangen werden.
Warum also? Ich meine, dass die Ewige Wiederkehr uns eigentlich nichts lehrt. Sie gewinnt diesen selbstverständlichen Reiz aus ihrer Resonanz mit dem, was wir selbst schon in uns haben und verstehen. Wer Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft nicht akzeptieren kann, kann auch nicht wollen, dass sich sein Leben ewig wiederholt. Doch gerade darin liegt schon der Keim eines Amor fati, der die Ewige Wiederkehr bejahen will. In allen Verneinungen wühlt der Wunsch danach, zu bejahen. Wir wissen, dass die Verneinung sich selbst nicht will. Zwar können wir sie als Zustand vor uns herschieben, aber dabei ertragen wir nur. Wir spüren, dass man doch eigentlich den Willen zur Bejahung vollständig entwickeln müsste. Andernfalls würden wir dem Problem, wie die Ewige Wiederkehr zu wollen wäre, nicht ratlos gegenüberstehen – wir würden die Aufforderung als sinnlos verwerfen und uns so gar nicht einmal vor ein Problem gestellt sehen. Ganz selbstverständlich würde man sich mit einem Zustand abfinden.
Aber erstmal ist es so, dass wir uns in einem komischen Zwischenraum zwischen Bejahung (eines anderen, noch zu erreichenden Zustandes) und Akzeptanz (des gegenwärtigen Zustandes in seiner Faktizität) wiederfinden, wenn wir einen Zustand verneinen. Deswegen und dadurch triezt uns die Ewige Wiederkehr. Sie zeigt auf, dass ein Zustand der Verneinung oder auch nur des Ertragens sich selbst nicht (wiederkehrend) will. Es ist also ein Wille zu einem Zustand der Bejahung da, der die Bejahung der Ewigen Wiederkehr als Verheißung und als Problem empfinden lässt – denn er ist eben noch nicht die Fähigkeit, zu einem solchen Zustand zu gelangen. Aber wie gelangt man dahin?
Klar ist doch: Manches sollte man nicht akzeptieren, andere Male sollte man sich dennoch unrealistischer Erwartungen entschlagen. Aber hier ist so schwer zu urteilen; ganz grundsätzlich wühlt man mit dieser Frage in sich: Von welchen Hoffnungen löst man sich … und welche Hoffnungen sollte man auch noch durch die Verzweiflung hindurch kämpfen? Oft genug sollte man Letzteres durchhalten gegen einen „gesunden Menschenverstand“, der immer nur beschränkt sein kann auf das hier und jetzt Sagbare, Denkbare, Fühlbare. „Dass ihr verzweifeltet, daran ist viel zu ehren. Denn ihr lerntet nicht, wie ihr euch ergäbet“8, sagt Zarathustra zu den „höheren Menschen“. Denn „[a]lles, was leidet, will leben, dass es reif werde und lustig und sehnsüchtig, – sehnsüchtig nach Fernerem, Höherem, Hellerem.“9 Nur wenn man derart der Hoffnung die Stange hält gegen das Jetzt, kann der Druck des „Weh spricht: Vergeh! Weg du Wehe!“ (ebd.) sich gegen die Welt und sich selbst richten und etwas entstehen, in dem sich das einst noch ungewisse „Ja“ der einstigen Hoffnung ganz entfaltet.
Wenn man irgendwann nur noch ein Ja-Sagender sein und die Ewige Wiederkehr wollen will, es aber nicht kann, kann es nicht darum gehen, eine allgemeine Antwort und Lösung zu finden. Was hindert einen daran, zu bejahen? Man muss die Frage stellen, die man selbst ist. Man wird keine fertige Antwort finden – die Antwort kann man nur geben, in dem man sie wird. So zerfällt die Frage, wie man die Ewige Wiederkehr seines Daseins wollen kann.
Aber die Einsicht, dass man die Antwort nicht suchen sollte, löst die Frage noch nicht. Wie lässt sich beurteilen, welcher Anspruch aufrechtzuerhalten und welcher aufzugeben oder zu modifizieren ist? Und woher sollte man wissen, ob solcher Zweifel nicht auch gegen den Amor fati in Anschlag gebracht werden sollte? Gibt es nicht Zustände, die verneint werden sollten, auch wenn man nicht auf ihre Änderung hinarbeiten kann?
II. Adornos Kritik an Nietzsches Amor fati
Genau das fragt Adorno: „Und es wäre wohl die Frage zu stellen, ob irgend mehr Grund ist, das zu lieben, was einem widerfährt, das Daseiende zu bejahen, weil es ist, als für wahr zu halten, was man sich erhofft.“10 Gerade in den Zuständen der Einkerkerung, wenn man sich nicht mehr gegen die Umstände wehren kann, würde der Wille zur Selbstbehauptung sich gegen die eigene Empörung und die eigenen Ansprüche wenden, damit man sich wenigstens irgendwie behaupten kann: „[S]o könnte man den Ursprung des amor fati im Gefängnis aufsuchen. Auf die Liebe zu Steinmauern und vergitterten Fenstern verfällt jener, der nichts anderes zum Lieben mehr sieht und hat.“ (Ebd.) Wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass man sich an der Notwendigkeit, ein Ja-Sagender zu werden, ausrichten sollte – worauf könne man sich denn dann verlassen? „Am Ende ist Hoffnung, wie sie der Wirklichkeit sich entringt, indem sie diese negiert, die einzige Gestalt, in der Wahrheit erscheint. Ohne Hoffnung wäre die Idee der Wahrheit kaum nur zu denken“ (ebd.). Wenngleich es erstmal ähnlich klingt, gibt Adorno eine radikal andere Antwort als Nietzsche. Nicht das Hier und Jetzt würde dann bejaht, sondern verneint zu Gunsten der Bejahung eines womöglich nicht Erreichbaren, einer Hoffnung.
Es war oben festgehalten, dass mit Nietzsche der praktischen Philosophie die Aufgabe zu Grunde liegt: Das Dasein verlangt danach, bejaht zu werden. Gibt es doch etwas Wahreres? Etwas Wichtigeres? Das droht jetzt wieder zu entgleiten. Wie könnte hier gegen Adorno argumentiert werden? Auf welcher Grundlage kann man hier überhaupt noch urteilen?
Erstmal wieder ein Schritt zurück. Adorno schreibt, es sei die Hoffnung, welche den Blick auf Wahrheit freilege. Es wäre also nicht der Fall, wie man zumeist meint, dass der kühle und realistische Blick ersichtlich mache, was richtig sei – zum Beispiel die darauffolgende, negierende Hoffnung oder Nietzsches Bejahung. Es verhalte sich genau andersherum: zuerst die Hoffnung, dann die Wahrheit. Man würde dann wohl erkennen, dass man sich mit dem Amor fati etwas vormache und mit der negierenden Hoffnung nicht.
Das erscheint als und ist eine selbsterfüllende Argumentation. Aber tun wir sie nicht ab, indem wir uns die trügerische Sicherheit eines vermeintlich objektiven Blicks zurückwünschen, dem sich schon die Wahrheit lichten würde, wenn man nur recht ernst nachdenken würde. Lassen wir uns fallen. Was lässt sich dann mit Nietzsche Adorno entgegenhalten? Finden wir neuen Grund, auf dem stehend erwiesen werden kann, warum die Aufgabe des Daseins die Bejahung seiner selbst ist und die Ewige Wiederkehr affirmiert werden muss?
III. Die Unmöglichkeit einer objektiven Bewertung des Lebens
Dass es keinen objektiven Grund für ein Urteilen über das Leben gibt, das weiß auch Nietzsche: „[E]in Trieb ohne eine Art von erkennender Abschätzung über den Wert des Zieles, existiert beim Menschen nicht.“11 Und für den Fall, in dem Leben über Leben urteilt, muss man also bedenken, dass hier eine Abschätzung stets bloß zeigen kann, wie sie sich selbst vorkommt. Es gilt „diese erstaunliche finesse zu fassen, dass der Werth des Lebens nicht abgeschätzt werden kann. Von einem Lebenden nicht, weil ein solcher Partei, ja sogar Streitobjekt ist und nicht Richter“12. In der Konsequenz haben solche Urteile „nur Werth als Symptome“ (ebd.).
Jetzt kann man sich zwar der Aufdringlichkeit von Adornos Argument erwehren, dass die Hoffnung – die Perspektive auf eine bessere Welt – irgendwie wahrer wäre. Aber es bleibt auch nichts mehr. Alle Einstellungen eröffnen Perspektiven, in denen sie dann als die jeweilig richtige erscheinen. Keiner können wir vertrauen, dass sie jetzt mal die wirklich wahre ist. Die Frage, ob das Leben und die Ewige Wiederkehr bejaht werden muss, scheint jetzt sinnlos. Ein Gewimmel verschiedener Triebe. Und entweder bejahen sie das Leben – oder halt nicht. Fast peinlich mutet jetzt die Frage an, wie die Ewige Wiederkehr bejaht werden kann. Worauf sollte sich irgendeine Anleitung stützen? Wir fallen alle auf uns selbst zurück – auf das, was wir nun mal sind, an dem es nichts zu loben, zu tadeln oder zu argumentieren gibt.
In Menschliches, Allzumenschliches weiß Nietzsche auch nicht weiter zu navigieren, wenn er auf diesem Determinismus aufschlägt: „Ich glaube die Entscheidung über die Nachwirkung der Erkenntnis wird durch das Temperament eines Menschen gegeben“13. So bekommt in Nietzsches Auseinandersetzung mit diesem Komplex das Dasein der Menschen einen fragwürdigen Schein. Unterm Strich bringe das Leben mehr Leid als Lust hervor und dass die Menschen am Leben festhielten, liege an ihren Trieben. Es muss sich aber etwas verändert haben in Nietzsches Denken, dass er in dieser Ausgangslage doch zu etwas fand, dass ihn die Ewige Wiederkehr als etwas zu Wollendes darstellen ließ. Was hat Nietzsche verstanden und warum teilt er es einem nicht einfach mit? Und wie kann man danach fragen?
IV. Warum der Wille sich bejaht …
n dieser Stelle will ich das Problem umdrehen: Was hatte man sich denn eigentlich davon erhofft, eine Antwort zu erhalten? Eine theoretische Antwort, die könnte einem die Notwendigkeit klar machen, würde einen so also zwingen. Oder sollte es ein Geheimnis sein, dessen Vernehmen uns gleichsam transformiert, um dann so zu werden, wie man ja eigentlich sein will? Es hat doch den Geschmack einer Selbstaufgabe, sich zu erhoffen, die Notwendigkeit würde einem das aufzwingen können, wozu man selbst nicht in der Lage war. Die vernünftig eingesehene Notwendigkeit mag einem Anlass geben „sein Wesen in irgend einen Zweck hin abwälzen“14 zu können, wäre man dieser Verantwortung selbst müde. Recht ehrlich betrachtet gibt es doch aber noch einen ganzen eigenen Erwägungsraum, wo uns die Selbstachtung nicht gestattet, uns dem Notwendigem einfach zu ergeben, selbst wenn ihm nichts entgegenzuhalten ist. Es nimmt sich denn auch recht komisch aus, wenn beispielsweise Hannah Arendt (1906-1975) Nietzsches Amor fati als eine schlichte Identifikation mit dem Notwendigen fasst: „Offenbar kommt es nicht darauf an, die Welt oder die Menschen zu verändern, sondern ihre ‚Bewertung‘ derselben“. Eine Transformation, welche in dem „psychologisch höchst wirksamen Trick“ bestünde, „zu wollen, was ohnehin geschieht.“15 So würde dann der Wunsch, ein Ja-Sagender zu sein, den Willen einer Stille zuführen, um von allem zu Verneinendem wegzusehen.16 Solche Entselbstungsliebe ist eine schlichte Angelegenheit und nicht etwa viel wert, nur weil sie viel kostet. Wir aber wollen wirklich „[d]as Nothwendige nicht bloss ertragen, […] sondern es lieben…“17. Und würde solche Manifestation der Liebe der Welt zu sich selbst sich etwa von ihren Verneinungen abwenden? Oder umfasst wirkliche Selbstliebe nicht auch gerade die eigenen Wachstumsschmerzen?
So muss die Bejahung der Ewigen Wiederkunft etwas sein, das grundlos aus unserem Inneren herauskommt. Warum bejahen? Warum überhaupt irgendetwas bejahen? Weil aller Wille immer schon eine Bejahung ist! Dass „der Wille zur Macht nicht ein Sein, nicht ein Werden, sondern ein Pathos [ist,] ist die elementarste Thatsache, aus der sich erst ein Werden, ein Wirken ergiebt…“18. Pathos: Das heißt hier eine Kraft, eine Bewegung, eine Interpretation der Welt und ihre Veränderung. Dabei gibt es nicht ein Etwas, das irgendwas verändern will. Die Veränderung ist das, was als Wille existiert. Oder wie Deleuze sich ausdrückt: „Die Macht ist das, was im Willen will.“19 Der Wille „sucht nicht, er begehrt nicht, vor allem begehrt er nicht die Macht. Er gibt“20. Er gibt aber nicht an jemanden weiter: Der Wille zur Macht ist ein vielfältiges, sich immer erneuerndes Geschenk der Bejahung an sich selbst. Für Nietzsche drückt sich dieser Umstand im Menschen derart aus, dass in ihm Befehlendes und Gehorchendes zugleich sei: „Freiheit des Willens – das ist das Wort für jenen vielfachen Lust-Zustand des Wollenden, der befiehlt und sich zugleich mit dem Ausführenden als Eins setzt“21. Es gibt im Menschen nichts Vorgelagertes, das entscheiden könnte; ein Abwägen gibt es nur als Symptom etwa eines unabgeschlossenen Kampfes verschiedener Willen. Die Frage zu stellen, warum der Wille bejaht, heißt also den Willen zu verkennen. Die Bejahung ist kein optionaler Zustand des Willens, sie ist seine notwendig zukommende Existenzweise. Bejahung durchaus nicht als bilanzierendes Urteil, sondern als Seinsweise. Jeder Wille, solange er existiert, hält sich gegen Einflüsse, Widerstände und die Zeit aufrecht. Seine Bejahung muss keine emphatische Danksagung sein. Seine Bejahung ist seine eigene, immer unbegründete Aufrechterhaltung und Steigerung, welche überhaupt erst das Fundament für Urteil und Bewertung schafft. Es geht bei solcher Bejahung auch nicht um Glück oder Abwesenheit von Leid. Vom Pessimismus schreibt Nietzsche, er brauche „durchaus keine Glückslehre zu sein: indem sie Kraft auslöst, die bis zur Qual zusammengedrängt und gestaut war, bringt sie Glück.“22 Jenes letztere Glück ist die Bejahung, das zu sein und zu tun, was man zu sein und zu tun hat.
V. … und warum der Mensch sich verneint
Mag man mir an dieser Stelle folgen oder nicht: Solcher Standpunkt bekommt doch auf den zweiten Blick etwas Lächerliches. Es sind Zustände des Menschen bekannt, beobachtbar oder vorstellbar, welche sich zwar nicht selbst fremd vorkommen, die doch aber der Welt grämen, dass es so gekommen ist. Zustände, in welchen man sich wünscht, die Dinge wären anders gekommen. Das lässt es so aussehen, es gäbe einen allgemeinen Standpunkt des Urteilens, von dem aus wir unser konkretes Ich bedauern und es gleichsam also nicht bejahen. Das soll nicht geleugnet sein. Es ist aber jener „zweite Blick“ auf das Dasein, welcher uns das Dasein zu etwas Fragwürdigem machen kann. Für den „ersten Blick“ kann aber die Frage nach der Bejahung überhaupt nicht aufkommen, weil der konkrete Wille immer schon eine immanente Bejahung ist. So wie wir uns das bei Tieren vorstellen, kommt bei ihnen lediglich der erste –alles jenseits der Bejahung verunmöglichende – Blick in Betracht.
Die Bejahung der Ewigen Wiederkehr auf Ebene des zweiten Blicks, das ist die Bejahung des Ganzen, des großen Zufalls, dass das Dasein überhaupt und in seiner gegenwärtigen Gestalt existiert. Wieder: Es hilft der Bejahung nichts, sein eigenes konkretes Sein, die Welt oder das Ganze als nun einmal in dieser Form notwendig auszulegen. Nicht nur kann das keine Liebe hervorbringen, man betrügt sich auch selbst darüber, dass in letzter Instanz nichts vollständig notwendig ist, weil die Existenz des Ganzen schlussendlich nur als Zufall verstanden werden kann. Deleuze schreibt:
Denn die ewige Wiederkehr ist die vom Fortgang unterschiedene Wiederkehr, ist die vom Fortgang unterschiedene Kontemplation, aber ebenso die Wiederkehr des Fortganges selbst und die Wiederkehr der Aktion […].23
Er stellt sich ein in sein Spiel versenktes Kind vor, dass sich auch ergötzt, wenn es einen Schritt zurücktut, um dann abermals wieder Lust zu bekommen, weiterzuspielen. Es braucht also solche zweite Bejahung. Auch auf dieser zweiten Ebene kann es nicht um theoretische Einsichten gehen, keine zwingende Notwendigkeit. Genauso selbstverständlich wie auf erster Ebene jeder einzelne Wille sich selbst will, wird der Mensch des Amor fati das Ganze wollen und auch in jener Hinsicht „die ewige Lust des Werdens selbst […] sein“24. Wie also da bejahen? Keine Erklärung nimmt die Arbeit ab. Nietzsches großspurige Beschreibungen eines tapferen Ja-Sagens inmitten allen Leides haben ihren Reiz, erschöpfen sich dann aber doch auch. Wieder hilft es zu fragen, warum es denn eigentlich nicht klappt. Das führt uns zum Problem des Ressentiments25.
VI. Was will das Ressentiment?
Es wurde schon oft beschrieben, wie niedrig das Ressentiment ist, dass es allen Beteiligten schadet. Man kann aber auch versuchen, das Ressentiment zu verstehen. Es handelt sich beim Wort „Ressentiment“ um eine Substantivierung von „wiederfühlen“. Man kann es verstehen als den Umstand, ein Gefühl nicht loslassen zu können – oder besser noch: dass ein Gefühl sich selbst nicht loslassen kann. Das passiert bei Erfahrungen von Verlust, Kränkungen und Enttäuschung. Warum geschieht uns das so häufig? Hinsichtlich des „Kampf[es] um‘s Leben“ wirft Nietzsche Darwin vor, den Geist vergessen zu haben; das Schwache greife immer wieder zum Geist, um über das Starke Herr zu werden.26 Die menschliche Vorstellungskraft gibt all unserem Schmerz vielmehr Mittel, nicht in die Katharsis, die seelische Reinigung, gehen zu müssen, sondern zu überleben oder sogar herrschend zu werden. Es ist uns dadurch zu leicht, nicht eingestehen zu müssen, dass etwas vorbei ist oder nie bestand, und die ganze Härte des Verlustes zu durchleben. Wir können stattdessen immer wieder fragen: „Warum gerade ich?“, „Warum hat diese Person sich nicht anders entschieden?“, „Warum sind die Menschen und die Welt so?“. Aber in ihrem Willen zur Macht werden solche Gefühle noch viel kreativer, der Phantasie sind da leider keine Grenzen gesetzt. Hat nicht Adorno mit seinem Standpunkt der Hoffnung eine Weltauslegung gegeben, innerhalb derer es gut ist, an der Welt, wie sie ist, zu leiden, weil es in ihr eine durch die Hoffnung zugängliche, andere Welt gäbe, welche die wahre ist? Aber wir alle praktizieren in unserem Alltag die kleinen Moralismen, durch welche wir die Welt, die anderen und uns selbst nicht sein lassen, wie sie nun einmal sind. Oder aber wir werfen ihnen vor, schlecht zu sein, weil sie nicht so sind, wie wir sie haben wollten. Wozu das alles? Es geht meist nicht darum, ein geliebtes Objekt wiederzugewinnen, welches erlösen würde. Da ist nur noch der Schmerz, der sich immer wieder neu auslegt, auch den anderen angetan, anerkannt oder eben wieder-gefühlt werden soll. Indem sich das Ressentiment eine Welt schafft, in der es richtig ist, an sich und der Welt zu leiden, versperrt es sich jeden Ausgang. So kann es überleben als ein Wille, der sich in gewisser Weise selbst nicht will, weil die Katharsis nur aufgeschoben wurde – und der doch nicht loslassen kann. Gleich einer kaputten Platte spielt sich dieselbe Spur immer wieder ab.
Den Menschen rückt das alles in einen fragwürdigen Aspekt. Ein Wille, der sich am Leben hält – und eigentlich doch lieber nicht wäre? Das ist es, was sich im Ressentiment manifestiert und sich in der Unfähigkeit zur Bejahung der Ewigen Wiederkehr artikuliert. Zwar zu wollen, man könnte die eigene Wiederkehr wollen, aber trotzdem etwas bleiben, dass sich und die Welt nicht wiederkehrend will – was soll das eigentlich? In der Hauptsache können wir dafür nichts. Am „Versuch […] Mensch“27 ist „ [d]ie Bewusstheit […] die letzte und späteste Entwickelung des Organischen und folglich auch das Unfertigste und Unkräftigste daran. Aus der Bewusstheit stammen unzählige Fehlgriffe, welche machen, dass ein Thier, ein Mensch zu Grunde geht“28. Viel zu viele Möglichkeiten geben uns das Bewusstsein und die Vorstellungskraft, den Schmerz der Fatalität ein wenig aufzuschieben, ohne dass wir dabei wissen, in welche Sackgasse wir uns damit begeben. Wenn wir im Großen wie im Kleinen erstmal fragen „Warum so … und nicht lieber anders?“ begeben wir uns woanders hin, bleiben jedenfalls nicht beim Fatum; so wird uns ein Amor fati immer fremder. „Warum ist die Welt denn so und so?“, „Jene Person hätte sich doch auch anders entscheiden können!“ – Solche Gedanken bleiben nicht Gedanken. Sie bilden eine neue, imaginäre Welt aus, wir fühlen dann in ihr, wir fühlen sie. Sie ist aber eine abschüssige Bahn, weg von jener Welt, welche es zu bejahen gilt.
VII. Wer überwindet wie das Ressentiment?
Wie weiter? „Wille – so heisst der Befreier und Freudebringer“29. Noch aber haben wir das „halbe Wollen“30 und sind nicht „[s]olche, die wollen können“31. Der „Versuch Mensch“ ist nicht dafür verantwortlich, dass er in eine missliche Sackgasse geriet – ja, sie sogar selbst ist. Das sollte dennoch nicht Anlass geben zu einem stumpfen Wunsch zur Rückkehr in eine Zeit vor der Bewusstheit. Die Spuren sind schon verwischt und alles, was da etwa zu wünschen wäre – das sind wir schlicht nicht mehr. Aber dass wir für unsere Lage nicht verantwortlich sind, hat jedoch nicht zu heißen, dass wir nicht hier und jetzt Verantwortung für uns übernehmen können. Eine andere Richtung zeichnet sich nämlich ab: Keine Rückkehr, kein gemächliches Einrichten, sondern eine schonungslose wie auch begrüßende Betrachtung dessen, was sich mit uns im Dasein eigentlich ereignet hat – und dazu wieder ein ganzer Wille. Weil wir uns dabei nicht zurücklehnend auf eine Natur verlassen können, sondern uns selbst als ein Stück neue Natur betrachten und empfinden müssen, spricht Nietzsche von seinem Naturalismus als einem „Hinaufkommen“ in die Natur statt einer Rückkehr.32 Für den hier besprochenen Fall heißt ein Hinaufkommen in der Natur: Ohne Täuschung und mit vollem Bewusstsein auf besagter zweiter Ebene das Dasein bejahen, also das große Ganze bejahen und uns in unserer Rolle darin wiederkehrend wollen. Aber da sind wir noch nicht. Zuerst bedarf es Mitgefühl mit dem Teil von uns, der die Wiederkehr nicht will. Im Zarathustra heißt es: „Aber alles Unreife will leben: wehe!“33 Das Ressentiment hält sich im Zwischenraum auf von Weiter-wollen und Nicht-mehr-wollen. Es gibt nichts Konkretes, dass es mehr wollen kann von der Welt; es harrt einfach aus in irgendeiner Hoffnung auf Erlösung. Wiederum heißt es: „Was vollkommen ward, alles Reife – will sterben!“34 Das gilt nicht nur für alles bejahende Wollen, das sich gerne von neuen Bejahungen beerben lässt. Vollkommenheit kann es jedoch auch für das Leiden geben:
Alles, was leidet, will leben, dass es reif werde und lustig und sehnsüchtig, – sehnsüchtig nach Fernerem, Höherem, Hellerem. „Ich will Erben, so spricht Alles, was leidet, ich will Kinder, ich will nicht mich“.35
All das Leiden im Ressentiment ist nicht etwa irgendwie entartet und müsste rücksichtlos abgeschlagen werden. Es kann stattdessen ein Verständnis und ein Übereinkommen geben. Das Ressentiment selbst ist noch Teil jener Natur, die hinaufkommen und beerbt werden will. War es denn nicht es, was geharrt hat, als das Leid des Abschieds noch zu stumpf gewesen wäre? Und war es nicht gerade das Ressentiment, das darauf gepocht hat, dass die Ewige Wiederkehr etwas zu Bejahendes wäre? Mit einem ach-so-männlichen Willensgebaren ist es hier nicht getan; das weiß auch Zarathustra: „Weh spricht: ‚Brich, blute, Herz! Wandle, Bein! Flügel, flieg! Hinan! Hinauf! Schmerz!‘ Wohlan! Wohlauf! Oh mein altes Herz: Weh spricht: Vergeh!“36 Das Ressentiment, das sich selbst anschauend versteht, dass es vergehen sollte und will und dazu nur die Kraft sammeln musste – das sind auch wir selbst! Dahinter steht kein Subjekt, das kalkulierend irgendetwas durchsetzen könnte. Das „Vergeh!“, das ein Weh zu sich selbst spricht, kann nur intrinsisch motivierter Gang ins Nichts sein, hinter dem dann auch nichts mehr wartet: Keine Rechtfertigung, keine Wiedergeburt, keine Erlösung. Wie kann das gewollt werden? Wie kann hier noch eine Ewige Wiederkehr gewollt werden? Es kann hier nicht um eine Notwendigkeit gehen, sondern nur um eine Selbstverständlichkeit: „Schmerz ist auch eine Lust“37. Und die solchermaßen Ergriffenen würden zum Weh sprechen: „[V]ergeh, aber komm zurück!“38 Solche Lust, will das Vergehen nicht als etwas, das schnell hinter sich zu bringen wäre. Indem sie das Werden und das Ganze will, will sie auch solches Vergehen mit vorbehaltslosem „Ja“ und ewig wiederkehrend. „[S]ie ist durstiger, herzlicher, hungriger, schrecklicher, heimlicher als alles Weh, sie will sich, sie beisst in sich, des Ringes Wille ringt in ihr, –“39. Sowas stellt sich ein oder nicht. Gründe gibt es jedenfalls nicht und alle weitere Begründung wäre fehl am Platz.
Wenn wir Adorno darin folgen würden, dass nur die Hoffnung die Perspektive auf Wahrheit freimache, schränken wir uns ein. Wäre das die ganze Wahrheit? Eine Wahrheit beschränkt durch das, was wir im Hier und Jetzt hoffen können und müssen? Nietzsche hingegen versucht, den Blick freizumachen für die Möglichkeit einer Liebe, die über uns hinaus verweist. In solcher Liebe wird die fatale, tatsächliche Welt nicht weggesehnt, weggefragt oder weggehofft. Sie ist aber keine selbstlose Aufopferung an das Schicksal. Gerade indem sie die Welt nicht unter Anklage stellt, gewährt sie uns den Raum, unsere Leiden und Verzweiflungen geradeheraus zu artikulieren. Wie jede reife Liebe, hält solche Selbstliebe aber ihr Objekt nicht fest, sondern befreit, zeigt uns auf, dass wir nicht auf das von uns Wünschbare beschränkt sein müssen, dass wir kein Ende sind und sein wollen. Solche Liebe, indem sie Lust am Schaffen, Werden und Vergehen ist, das wir sind, lässt uns etwas werden, das einst weiter in der Welt angekommen und zuhause sein wird. Schwingen wir uns dazu auf, die ewige Lust des Werdens selbst zu sein und sie immer höher und immer weiter zu treiben, löst sich auch die Frage des Amor fati in eine Selbstverständlichkeit auf.
Moritz Pliska (geb. 1999) studiert in Kiel Soziologie und Philosophie. Dort versucht er, sich selbst ein gutes erkenntnistheoretisches Experiment zu sein.
Quellen
Adorno, Theodor: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt a. M. 1951.
Arendt, Hannah: Vom Leben des Geistes. Das Denken, Das Wollen. Berlin & München 1979.
Deleuze, Gilles: Nietzsche und die Philosophie. Hamburg 1991.
Fußnoten
1: Adorno, Minima Moralia, S. 13 (Zueignung).
2: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 276.
3: Ecce homo, Warum ich so klug bin, Abs. 10.
4: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 276.
5: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 341.
6: Also sprach Zarathustra, Von der Erlösung.
7: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 341.
8: Also sprach Zarathustra, Vom höheren Menschen, 3.
9: Also sprach Zarathustra, Das Nachtwandler-Lied, 9.
10: Adorno, Minima Moralia, S. 110 (Aph. 61).
11: Menschliches, Allzumenschliches Bd. I, Aph. 32.
12: Götzen-Dämmerung, Das Problem des Sokrates, Abs. 2
13: Menschliches, Allzumenschliches Bd. I, Aph. 34.
14: Götzen-Dämmerung, Die vier grossen Irrthümer, Abs. 8.
15: Arendt, Vom Leben des Geistes, S. 398.
16: Vgl. ebd., S. 400.
17: Ecce homo, Warum ich so klug bin, Abs. 10.
18: Nachgelassene Fragmente Nr. 1888, 14[79].
19: Deleuze, Nietzsche und die Philosophie, S. 93.
20: Ebd., 94.
21: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 19.
22: Nachgelassene Fragmente Nr. 1887, 11[38].
23: Deleuze, Nietzsche und die Philosophie, S. 30.
24: Ecce Homo, Die Geburt der Tragödie, Abs. 3.
25: Anm. d. Red.: Dem Problem des Ressentiments und seiner Aktualität widmet sich auch der diesjährige Eisvogel-Preis für radikale Essayistik (Link).
26: Vgl. Götzen-Dämmerung, Streifzüge eines Unzeitgemäßen, Aph. 14.
27: Also sprach Zarathustra, Von der schenkenden Tugend, 2.
28: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 11.
29: Also sprach Zarathustra, Von der Erlösung.
30: Also sprach Zarathustra, Von der verkleinernden Tugend, 3.
31: Ebd.
32: Vgl. Götzen-Dämmerung, Streifzüge eines Unzeitgemäßen, Aph. 48.
33: Also sprach Zarathustra, Das Nachtwandler-Lied, Abs. 9.
34: Ebd.
35: Ebd.
36: Ebd.
37: Also sprach Zarathustra, Das Nachtwandler-Lied, Abs. 10.
38: Ebd.
39: Ebd.
Amor fati – Eine Anleitung und ihr Scheitern
Reflexionen zwischen Adorno, Nietzsche und Deleuze
Dieser Artikel versucht, sich zwei der vielleicht rätselhaftesten Ideen Nietzsches anzunähern: der Ewigen Wiederkehr und dem Amor fati, der „Liebe zum Schicksal“. Wie sind diese Ideen genau zu verstehen – und vor allem: Was haben sie uns zu sagen? Wie können wir das als Ewige Wiederkehr gedeutete Schicksal nicht nur bejahen, sondern wirklich lieben lernen?
Unter den Philosophen war es vor allem der „Hauptphilosoph“ des Instituts für Sozialforschung, Theodor W. Adorno (1903-1969), der diesen Ideen Nietzsches skeptisch bis ablehnend gegenüberstand. Wo bleiben in der Haltung des Amor fati die Kritik und die Utopie, deren Banner Adorno und seine Mitstreiter hochhielten?
Im Zuge des allgemeinen Scheiterns der Marxismen bei der theoretischen Bewältigung des Faschismus bemühte sich das Frankfurter Institut ab den 30er Jahren um eine Reorientierung. Der Erfolg dieser Bewegung schien zahlreichen unorthodoxen Marxisten nicht allein aus ökonomischen Gesetzmäßigkeiten heraus verständlich zu sein, es bedurfte ihres Erachtens einer stärkeren Berücksichtigung des „subjektiven Faktors“, also der psychologischen Struktur des bürgerlichen Individuums. Im Rahmen dieses Paradigmenwechsels wandte sich Adorno neben Sigmund Freud auch Nietzsche zu. Für den Rest seines Schaffens bildete dieser einen ständig wiederkehrenden Bezugspunkt für ihn.
Hartnäckig gegenüber Nietzsche blieb Adorno jedoch in einer, für marxistische Nietzsche-Interpreten immer wieder typischen, Hinsicht: dem Beharren auf der Orientierung hin zu einem die Menschheit irgendwie erlösenden Zustand – dessen Vorwegnahme sich vor allem in der Abwertung des Gegenwärtigen manifestiert. Von solcher Warte aus kritisiert er dann auch in seinem aphoristischen Hauptwerk Minima Moralia (1951) – ihm selbst zufolge eine „traurige Wissenschaft […] vom richtigen Leben“1 – Nietzsches Konzept des Amor fati. Nietzsches Wille, „irgendwann einmal nur noch ein Ja-sagender [zu] sein“2, hält er für eine Art Stockholm-Syndrom in der Lebensphilosophie. Eine solche Aufgabe – nicht nur der Bejahung, sondern sogar des Willens zur Bejahung – würde aber einer Preisgabe des Fundamentes für jede lebendige Aneignung der Philosophie Nietzsches gleichkommen. Adornos Kritik aufgreifend soll, unter Bezugnahme auf die Auslegung des wichtigen französischen Nietzsche-Interpreten Gilles Deleuze (1925-1995) ergründet werden, was Nietzsche zur Hand gibt für die universelle und doch immer auch sehr persönliche Frage, weshalb das Dasein doch – und zwar hier und jetzt – bejaht sein will.
Monumentalitätsprobleme. Nietzsche in der Kunst nach 1945
Gedanken zum Buch Nietzsche forever? von Barbara Straka I
Monumentalitätsprobleme. Nietzsche in der Kunst nach 1945
Gedanken zum Buch Nietzsche forever? von Barbara Straka I

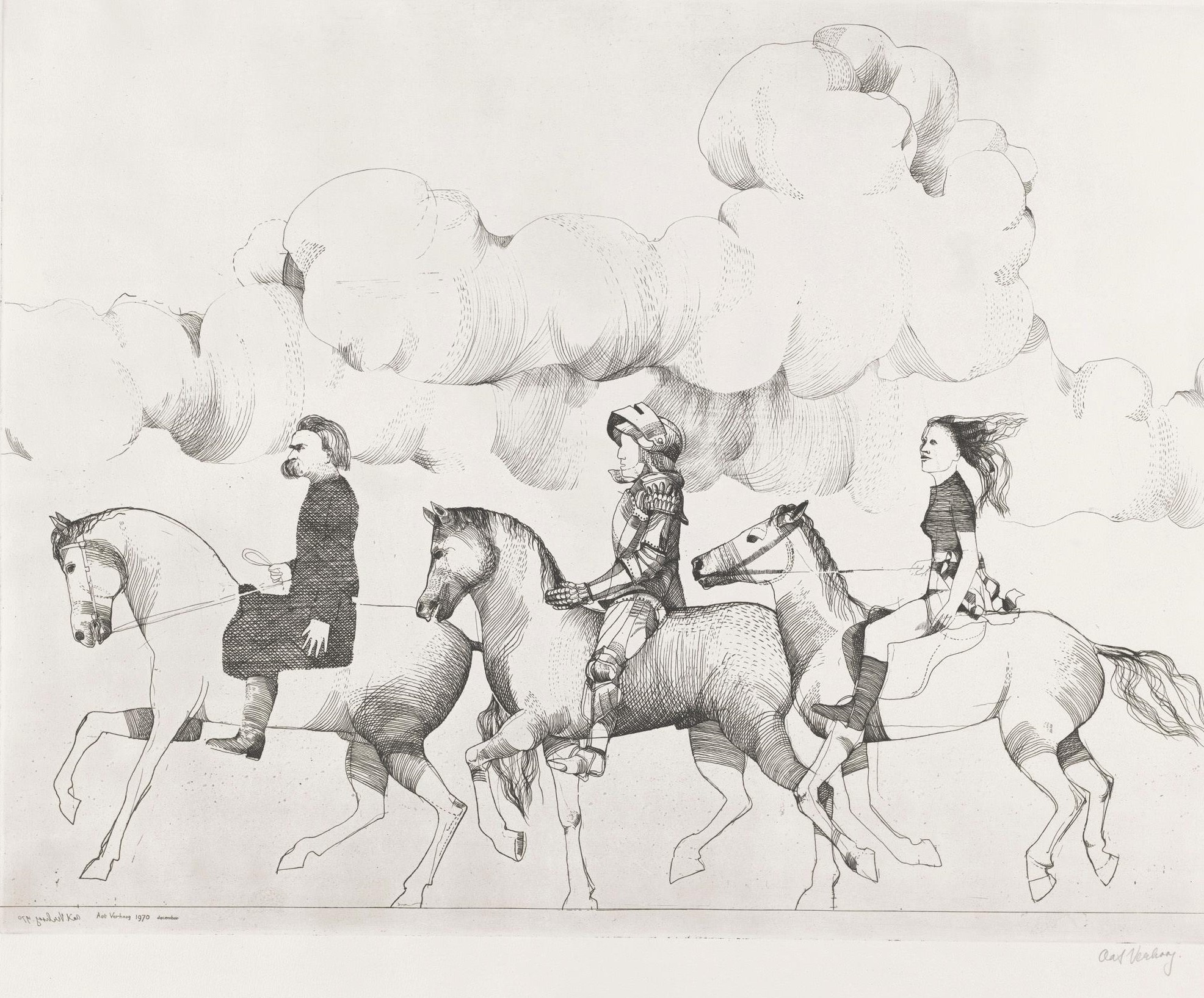
Dass Nietzsche ein Philosoph ist, der besonders zu Künstlern spricht, gar ein „Künstler-Philosoph“, ist beinahe ein Gemeinplatz. In Barbara Strakas neu erschienenem Buch Nietzsche forever? wird der Frage nachgegangen, wie genau Nietzsche in der Kunst des 20. Jahrhunderts, insbesondere derjenigen nach 1945, rezipiert wird. Der Autorin gelingt ein Standardwerk, das in plausiblen Überblicken das Thema anschaulich und kompetent vermittelt. In diesem ersten Teil des Zweiteilers widmet sich Michael Meyer-Albert zunächst ihrem Buch, um dann im zweiten Teil seine eigene Position zu akzentuieren.
„Wodurch also nützt dem Gegenwärtigen die monumentalische Betrachtung der Vergangenheit, die Beschäftigung mit dem Classischen und Seltenen früherer Zeiten? Er entnimmt daraus, dass das Grosse, das einmal da war, jedenfalls einmal möglich war und deshalb auch wohl wieder einmal möglich sein wird[.]
Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, Abs. 2
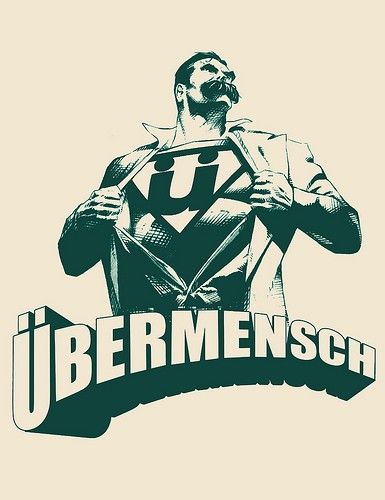
I. Übernietzsche
In seiner Erstlingsschrift Die Geburt der Tragödie (1872) vertrat Nietzsche noch ein pathetisches Kunstverständnis, demzufolge „nur als aesthetisches Phänomen […] das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt“1 sei. Die Opern seines Idols Richard Wagner sollten eine Wiedergeburt des tragischen Mythos der Antike bewirken, eine umfassende Kulturrevolution unter dem Banner der doppelgesichtigen Macht des Dionysischen und Apollinischen. Nietzsches philosophische Kunst bestand nun darin, dass er aus diesem spätromantischen Ästhetizismus einen neuen Begriff von Kunst freisetzte. In einer emanzipatorische „Lebenskunst“2 sollen wir, die „freien Geister“ zu „Dichter[n] unseres Lebens“3 werden und unser eigenes Sein – und das „im Kleinsten und Alltäglichsten zuerst“ (ebd.) – durch den Schein lebensbejahender Perspektiven philosophisch zu verklären lernen.
Nietzsche erfand damit ein Verständnis von Wahrheit als Kunst, das als intensivierte Aufklärung Europa vitalisieren sollte. Gerade weil die Wahrheit zu hart ist, um gelebt zu werden, ist es wahrhaftig, sie auf Abstand zu halten. Für Europa heißt das: Auch wenn die Götter tot sein mögen, wir haben den listigen Übermut der Einfälle, um das Leben mit dem Leben zu befreunden. Insofern ist gelungene Kunst daran zu messen, ob sie das Leben bereichert, indem sie es derart verklärt, dass es motiviert bleibt, das Leben hochzuschätzen. Interessant ist die Frage, wie der Philosoph des Scheins in dem Hauptmedium des Scheins erscheint.
Es ist der Anspruch von Barbara Strakas Buch Nietzsche forever?, das 2025 im Schwabe-Verlag erschien, die Rezeption von Nietzsche auf die Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg darzustellen.4 Als Kunsthistorikerin und ehemalige Kuratorin setzt sie sich dabei ab von der Rezeptionsgeschichte vor 1945, die bestimmt wurde von dem Willen zur Monumentalisierung, den Nietzsches Schwester in ihrem manipulativen Marketing als Nachlassverwalterin verkörperte. Analog zum Wagnerkult, dem Nietzsche ab 1876 philosophisch produktiv abschwor, wurde er selbst zum mythisch-heroischen Kultobjekt und, seit 1889 geistig umnachtet, ab 1897 bis zu seinem Tod 1900 als „lebendes Exponat“ (S. 21) im Weimarer Nietzsche-Archiv ausgestellt. Er wurde mystifiziert als christushafter Antichrist, als philosophischer Prophet des Nihilismus, als germanischer Denker des Übermenschen im Sinne des Faschismus. Nietzsche wurde zum Übernietzsche.
Straka konstatiert, dass diese reduktiven Umwertungen von Nietzsches Philosophie der Umwertungen nachwirken. Nietzsche erschien als der Denker für Hitlers Taten. Erst die textkritische Gesamtausgabe der beiden italienischen Philologen Giorgio Colli und Mazzino Montinari in den 1960er-Jahren erlaubte einen ungetrübten Blick auf die Werke Nietzsches und eine allmähliche Enttabuisierung dieses vermeintlich protofaschistischen Denkers. Es dauerte schließlich eine Generation, bis die Auswirkungen der manipulativen Rezeptionsgeschichte so weit in den Hintergrund traten, dass ab 1980 Nietzsche als „freier Geist“ für die Kunst allmählich und immer auch ambivalent bewertet wiederentdeckt wurde.
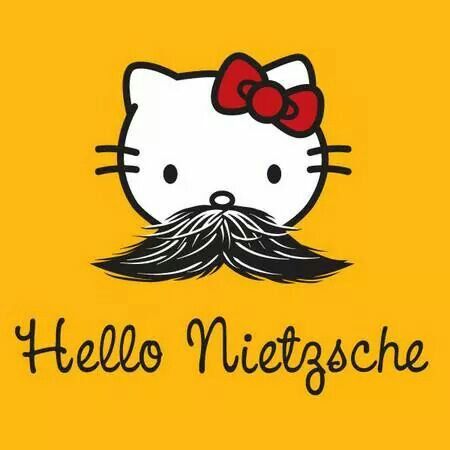
II. Transfigurationen des Nietzsche-Bildes
Strakas Buch leistet einen Überblick über die vielfältige Auseinandersetzung der Kunst mit Nietzsche jenseits von Kult und Hitler, wobei sie mit Bezug auf ihr Fach ein „Versagen der Kunstgeschichte bei der Aufarbeitung des Themas“ (S. 46) unterstellt. Methodisch analysiert Straka das Schaffen von 220 Künstlern – vor allem aus den Jahren 1980 bis 2000 –, sortiert nach 14 Themenclustern (zum Beispiel: Nietzsches Physiognomie, seine Reisen, seine Einsamkeit), die sie jeweils mit exemplarischen Werken veranschaulicht. Es wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass durch die immense Produktionssteigerung des Kunstmarktes seit den 1970er-Jahren, die Ausweitung der Kunstzone durch die Globalisierung und die fehlende digitale Archivierung von Werken vor 1990 die exemplarische Dokumentation der Kunstgeschichte nach 1945 prinzipiell beeinträchtigt ist.
Dennoch wird mit Blick auf Nietzsche in der zeitgenössischen Kunst für Straka deutlich: Es ist vor allem der Wechsel der inspirativen Quelle, der das Bild Nietzsches beeinflusste. Weg von dem konkreten Bild Nietzsches im Genre des Porträts hin zu den Bildern, die Nietzsches Schaffen und Leben evozieren. Es sind diese „Transfigurationen“, die Straka hervorheben möchte.
Die Wucht von Nietzsches Denken für die Kunst – insbesondere von Also sprach Zarathustra, Die fröhliche Wissenschaft, Ecce homo und den literarischen Dionysos-Dithyramben – ist für Straka dabei eminent: „Ohne Nietzsches in seinen Schriften verstreute, doch fundamentale Äußerungen zu Kunst und Ästhetik, die eine inspirierende Rolle für die Kunst der Moderne und Gegenwart einnahmen, hätte die jüngere Kunstgeschichte wohl einen anderen Verlauf genommen.“ (S. 10) Sie ergänzt am Ende ihres Buches: „Für die Künste, ihre Theoriebildung und Weiterentwicklung im 20. und 21. Jahrhundert dürfte das Erbe des umstrittensten aller Philosophen dennoch unbestritten sein.“ (S. 726)
Straka unterscheidet grob drei Phasen der Nietzsche-Rezeption: „Als Gegenstand der bildenden Künste hat Friedrich Nietzsches Bildnis einen beispiellosen Prozess der Konstruktion (um und nach 1900), der Dekonstruktion (nach 1945) und Neukonstruktion (seit den 1980er-Jahren) erlebt.“ (S. 628)
Die letzte Phase der Neukonstruktion gewann mit dem Internet eine gesteigerte Wirkung. Nietzsche „wurde nicht nur populär, sondern avancierte nachgerade zum Pop-Idol und Superstar.“ (S. 628) Instruktiv ist Strakas Differenzierung der verschiedenen Formen des Popphänomens Nietzsche:
1. Nietzsche funny – die Witzfigur (Professor, Bücherwurm, Kauz, Tollpatsch, Antiheld, Frauenfeind); 2. Over-Nietzsche – der Übermensch (Heiliger, Actionheld, Retter, Kämpfer, Sportler); 3. Nietzsche now – der menschlich-allzumenschliche Zeitgenosse (Lehrer, Helfer, Freund, Berater); 4. Nietzsche cool – das Idol (Popstar, Superstar); 5. Nietzsche cute – der Niedliche (Puppe, Zwerg, Spielzeug, Devotionalien); 6. Tiny Nietzsche – der Winzling (Baby, Kleinkind).5
Als divers trivialisiert wird Nietzsche zum Menschen. Der Übernietzsche wird darin so sehr mit Normalität geimpft, dass er zusammenschrumpft und auf Augenhöhe kommt mit den „letzten Menschen“. Straka weist auf dieses kulturkritische „Phänomenen der Ver(allzu)menschlichung“ (S. 663) hin, merkt aber auch an, dass in diesem Delta der Typologien „die Endphase der Dekonstruktion des einstigen Kultbildes Nietzsche“ (ebd.) verwirklicht sein könnte. Die Geschichte von Nietzsche Rezeption in den Künsten endet mit einer pluralen Neutralisierung der einstigen kultischen Monumentalität und eröffnet so den Horizont für verschiedenste kreative Zugänge.
Besonderes Augenmerk entwickelt Straka bei ihren Analysen für die Möglichkeit, ob durch die nun befreite Rezeption Nietzsches die Kunst eine Vermittlerrolle von Philosophie und breiter Öffentlichkeit spielen könnte. Die Kunst als eine weltoffenere Schwester Nietzsches, die das wahre Heldentum des fröhlichen Heroismus von Nietzsche jenseits von Mythos und Banalität popularisierte? Nach dem völkischen nicht der volksnahe, aber doch volksnähere Nietzsche? Straka erwähnt, dass das Nietzsche-Haus in Sils Maria am ehesten diese utopische Aufgabe verwirklichte (vgl. S. 727).
Strakas Buch ist es gelungen, das schier nicht zu bewältigende Ausmaß der Nietzsche-Rezeption in der zeitgenössischen Kunst in plausible thematische Überblicke zu verwandeln. Sie legt damit ein Standardwerk vor, an dem sich jegliche zukünftige Auseinandersetzung mit diesem Thema wird messen müssen. Das reichlich bebilderte Buch besticht durch eine umfassende Kenntnis des Kunstmarktes und der Ideenwelt Nietzsches, die durch umfangreiche Zitate und anschauliche Details an Tiefenschärfe gewinnt.
Artikelbild
Aat Verhoog: Three riders (including Nietzsche) (1970; Quelle)
Quellen
Straka, Barbara: Nietzsche forever? Friedrich Nietzsches Transfigurationen in der zeitgenössischen Kunst. Basel 2025.
Fußnoten
1: Die Geburt der Tragödie, Abs. 5.
2: Menschliches, Allzumenschliches II, Der Wanderer und sein Schatten, Aph. 266.
3: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 299.
4: Aus diesem Buch wird im Folgenden im Fließtext zitiert.
5: S. 662.
Monumentalitätsprobleme. Nietzsche in der Kunst nach 1945
Gedanken zum Buch Nietzsche forever? von Barbara Straka I
Dass Nietzsche ein Philosoph ist, der besonders zu Künstlern spricht, gar ein „Künstler-Philosoph“, ist beinahe ein Gemeinplatz. In Barbara Strakas neu erschienenem Buch Nietzsche forever? wird der Frage nachgegangen, wie genau Nietzsche in der Kunst des 20. Jahrhunderts, insbesondere derjenigen nach 1945, rezipiert wird. Der Autorin gelingt ein Standardwerk, das in plausiblen Überblicken das Thema anschaulich und kompetent vermittelt. In diesem ersten Teil des Zweiteilers widmet sich Michael Meyer-Albert zunächst ihrem Buch, um dann im zweiten Teil seine eigene Position zu akzentuieren.
Vom Leugner über die Verschwörungstheorie zum Ghosting
Nietzsche und die sozialen Verwerfungen durch heute grassierende Ressentiments
Vom Leugner über die Verschwörungstheorie zum Ghosting
Nietzsche und die sozialen Verwerfungen durch heute grassierende Ressentiments


Nachdem sich Hans-Martin Schönherr-Mann bereits in zwei Artikeln auf diesem Blog mit Nietzsches Ressentiment-Begriff beschäftigte (hier und dort), widmet er sich in diesem nun der Frage, wie er sich auf die aktuelle gesellschaftliche Situation anwenden lässt.
Seine These: Die heutige politische Landschaft ist durch viele Zerwürfnisse geprägt, die auf Ressentiments beruhen. Sie verdanken sich der Schwächen der eigenen Argumente. So diffamiert man Kritiker als ‚Corona-‘ oder ‚Klima-Leugner‘. Die Einwände werden gerne als Verschwörungstheorien gebrandmarkt, darf man heute ‚Cui bono?‘ nicht mehr fragen. Oder man bricht zum Selbstschutz gleich kommentarlos den Kontakt ab. Das entspricht nicht nur an vielen Stellen Nietzsches Ressentiment-Verständnis, gerade weil er selbst davon nicht frei ist, aber nach Wegen hinaus sucht.
Der Frage „Worin besteht die Aktualität von Nietzsches Analyse und Kritik des ‚Ressentiments‘?“ widmet sich auch der diesjährige Eisvogel-Preis für radikale Essayistik, bei dem man erneut bis zu 750 Schweizer Franken gewinnen kann. Einsendeschluss ist der 25. August. Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie hier.
Wenn Sie sich den Artikel lieber anhören möchten, finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation eine audiovisuelle Version, eingelesen vom Autoren selbst (Link) – oder auf Soundcloud eine rein Audioaufzeichnung (Link).
Spätestens seit der Corona-Zeit macht ein Wort Karriere, das zwar schon länger eine einschlägige Bedeutung hat, aber Jahrzehnte lang eine eher beschränkte, nämlich der ‚Leugner‘.
Historisch fing es mit dem Gottesleugner an, als im 18. Jahrhundert während der Aufklärung sich der Atheismus verbreitet, der von vielen gläubigen Christen gehasst wird.
Die Aggressivität gegenüber Atheisten beruht indes auf der argumentativen Schwäche, dass sich die Existenz Gottes nun mal nicht beweisen lässt. Versucht sich die Vernunft daran, so Kant, verwickelt sie sich in „ewige Widersprüche und Streitigkeiten“, weil sie „niemals über das Feld möglicher Erfahrung hinaus kommen könne“1. Das Ende aller Gottesbeweise! Wie jener berühmte des Thomas von Aquin, dass alles in der Welt eine Ursache habe, also auch die Welt eine haben müsse. So „muss man zu einem ersten Verändernden kommen, das von keinem anderen verändert wird. Und das verstehen alle unter ‚Gott‘.“2
Das verstärkt bei religiösen Menschen die Aversionen gegenüber religiösen Zweiflern. Dieser Prozess ähnelt dem Ressentiment, wie Nietzsche das Wort in Zur Genealogie der Moral gebraucht, ein aus einer gefühlten Unterlegenheit resultierendes verstetigtes Bedürfnis nach Rache gegenüber dem vermeintlichen ‚Schädiger‘.
Auch auf Nietzsche richtete sich ein derartiger Hass; denn wie heißt es im Zarathustra über die Priester: „Böse Feinde sind sie: Nichts ist rachsüchtiger als ihre Demuth. Und leicht besudelt sich Der, welcher sie angreift.“3
Der Kritiker als Leugner
Karriere machte das Wort vom ‚Leugner‘ in der Corona-Politik. Natürlich gab es unter deren Kritikern Leute, die die Krankheit als solche dementierten. Doch mit dem Wort ‚Corona-Leugner‘ wurden auch alle disqualifiziert, die die Corona-Maßnahmen in Frage stellten. Aus der Panik heraus, Widerspruch und Kritik könnten viele motivieren, die erlassenen Maßnahmen nicht ernst zu nehmen, wie aus dem Wissen heraus, dass sich diese Maßnahmen keineswegs von selber verstehen, reagierten ihre politischen, medialen und medizinischen Verfechter mit aggressiven Ritualen.
Ähnlich sieht es mit der Bezeichnung ‚Klima-Leugner‘ aus, die fast zeitgleich aufkam. Auch hier gibt es Kritiker, die die wissenschaftliche Debatte ablehnen. Aber andere zweifeln primär an der daraus abgeleiteten apokalyptischen Vision eines Weltuntergangs, die eine Dringlichkeit anmahnt, die sich keineswegs von selbst versteht. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse beruhen auf Methoden, Theorien, Experimenten, die keine letzten Wahrheiten sind. Über zukünftige Entwicklungen lassen sich nur ungefähre Voraussagen machen.
So dürfen, ja müssen diese Erkenntnisse auch immer in Frage gestellt werden. Kritiker als ‚Leugner‘ zu disqualifizieren, zeugt von der Schwäche der eigenen Argumentation und dem daraus resultierenden Ressentiment, das umgekehrt durch entsprechende Kritiken reflektiert wird.
Nietzsche gehört jedenfalls zu den Kritikern der modernen Technologien, wenn er schreibt: „Hybris ist heute unsre ganze Stellung zur Natur, unsre Natur-Vergewaltigung mit Hilfe der Maschinen und der so unbedenklichen Techniker- und Ingenieur-Erfindsamkeit“4.
Wie ressentimentbeladen das Wort vom ‚Corona-‘ wie das vom ‚Klima-Leugner‘ ist, zeigt sich daran, dass es, um die Dringlichkeit zu verstärken, implizit an den ‚Auschwitz-Leugner‘ anschließt, der heute wohl immer noch berühmteste Leugner. Am 25. April 1985 verabschiedet der Deutsche Bundestag ein Gesetz, dass die Auschwitz-Lüge verbietet, also die Behauptung, die millionenfache Ermordung der europäischen Juden hätte es nicht gegeben.
Dabei ging es weniger um das Dementi des mehr als gut belegten historischen Faktums, als vielmehr um die damit verbundene Beleidigung der Opfer und ihrer Angehörigen. Daher ist diese Einschränkung der Meinungsfreiheit berechtigt. Beleidigungen sind durch dieses Grundrecht nicht gedeckt.
Ähnlich unterstellen die Vertreter der Corona- wie der Klimapolitik, dass ihre Maßnahmen Menschen schützen sollen. Der entscheidende Unterschied bleibt, dass durch die ‚Corona-‘ wie ‚Klima-Leugnung‘ niemand beleidigt wird. Wenn zudem das ‚Leugner‘-Wort derart verwendet wird, relativiert das die Holocaust-Leugnung gerade.
Weil die Verfechter der Klima- wie der Corona-Politik indes propagieren, die Menschheit retten zu müssen, erscheinen ihnen ihre Kritiker gar als Feinde der Menschheit. Umso mehr müssen sie ihre Anliegen dramatisieren und umso mehr dürfen sie ihre Feinde verachten: Ressentiment pur, das eine entsprechende Reaktion hervorruft, so dass sich gegensätzliche Ressentiments gegenseitig aufschaukeln.
Wer ist kein Verschwörungstheoretiker?
So werden denn auch die diversen ‚Leugner‘ regelmäßig als ‚Verschwörungstheoretiker‘ diskriminiert. Selbstredend gibt es die verrücktesten Weltvorstellungen. Doch gerade religiöse Geschichten sind voll von Verschwörungstheorien. Herausragendes Beispiel ist die von Kirchenvätern entwickelte Trinitätslehre, dass der Heilige Geist hintergründig die Welt lenkt, also die Unsichtbare Hand: wahrlich eine Verschwörungstheorie, noch säkularisiert bei Adam Smith: „Tatsächlich fördert <der einzelne> nicht bewusst das Allgemeinwohl, noch weiß er, wie hoch der eigene Beitrag ist. […] er wird […] von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, der zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat.“5
Diesen christlich-liberalen Gründungsmythos – und natürlich längst nicht nur den – umschreibt Nietzsche mit den treffenden Worten: „[A]lles Leben ruht auf Schein, Kunst, Täuschung, Optik, Nothwendigkeit des Perspektivischen und des Irrthums.“6
Historie besteht nicht aus schlichten Tatsachen, sondern wird von den Historikern geschrieben, die zumeist im Dienst der Mächte stehen, die die Geschichte in ihrem Sinn schreiben lassen. Auch die Fakten müssen zu solchen erklärt und anerkannt werden. Das hat Nietzsche treffend kommentiert:
Gegen den Positivismus, welcher bei dem Phänomen stehen bleibt, „es gibt nur Thatsachen“, würde ich sagen: nein, gerade Thatsachen giebt es nicht, nur Interpretationen. Wir können kein Factum „an sich“ feststellen[.]7
Für Paul Ricœur sind Nietzsche, Marx und Freud die „drei Meister des Zweifels […] drei große ‚Zerstörer‘“8, die sich mit dem Schein der Wirklichkeit nicht zufriedengeben, sondern den Schleier lüften wollen, in dem die Ideologien oder das Unbewusste die Welt erscheinen lassen: Verschwörungstheorien!, von denen die Verteidiger der Demokratie, der Corona- wie der Klima-Politik nichts wissen wollen – eine grandiose Marxvergessenheit im Dienst der Rettung der Menschheit.
Daher darf die Frage ‚cui bono?‘ gar nicht mehr gestellt werden. Oder man ist Verschwörungstheoretiker. Freilich fragt sich, wer hier die Verschwörungstheoretiker sind: wahrscheinlich alle, vor allem aber jene, die anderen ein solches Mäntelchen umhängen. Und alle reagieren mit Ressentiment auf die böse Kritik durch die jeweils anderen, weil sie wiederum um die Schwäche der eigenen Argumentation wissen.
Demokratie, Natur und Gesundheit berufen sich dabei auf die zeitgenössischen Wissenschaften – was auch ihre Kritiker machen. Alle erhoffen sich davon gute Begründungen ihrer Vorstellungen und verdrängen, dass die Wissenschaften ihre Einsichten ständig überprüfen und ändern müssen. Und dahinter stehen ökonomische, politische Interessen oder der schlichte Wille zur Macht. Das gilt für Nietzsche wie für alle Wissenschaftskritiker, wenn er schreibt:
[W]ir selbst, wir freien Geister, sind bereits eine „Umwerthung aller Werthe“, eine leibhafte Kriegs- und Siegs-Erklärung an alle alten Begriffe von „wahr“ und „unwahr“. Die werthvollsten Einsichten werden am spätesten gefunden; aber die werthvollsten Einsichten sind die Methoden.9
Doch Paul Feyerabend führt vor, dass durch die Methodenorientierung die Ergebnisse der Wissenschaften immer methodenrelativ bleiben und sich auch die Methoden wandeln, die Nietzsche im Antichrist noch als den eigentlichen Fortschritt begreift. So schreibt Feyerabend,
dass der Gedanke einer festgelegten Methode oder einer feststehenden Theorie der Vernünftigkeit auf einer allzu naiven Anschauung vom Menschen und seinen sozialen Verhältnisse beruht.10
Die Methodenorientierung schützt also nicht vor dem Vorwurf, abhängig von Interessen zu sein, was allemal viel mehr die modernen Wissenschaften denn Nietzsche betrifft. Das kann dann wiederum nur durch eine aggressivere Verteidigung ausgeglichen werden, was somit das Ressentiment reproduziert, mit dem sich der Szientismus nicht nur in der Corona- und der Klima-Politik verteidigt.
Dagegen war Nietzsche im Zarathustra schon einen gewaltigen Schritt weiter, wenn er schreibt: „Oh meine Brüder, ist jetzt nicht Alles im Flusse? Sind nicht alle Geländer und Stege in‘s Wasser gefallen? Wer hielte sich noch an ‚Gut‘ und ‚Böse‘?“11 Und wer glaubt noch an die wissenschaftliche Wahrheit? Ganz viele und wer das nicht tut, der ist für den Szientismus und die etablierte Politik ein ‚Verschwörungstheoretiker‘, der den Wissenschaften mit Ressentiment, also mit unbegründeter Ablehnung und Aggression begegnet. Freilich ist die Ablehnung wie das Ressentiment gegenseitig.
Ghosting als Ende des sozialen Bandes
Die linke Kritik stellte seit den sechziger Jahren die Demokratie in Frage, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg in der westlichen Welt entwickelt wurde. In den Siebzigern gesellte sich die ökologische Kritik dazu.
Doch nur die Umweltproblematik wurde in allen politischen Lagern seit den Achtzigern schnell und fleißig übernommen. In gewisser Hinsicht avancierte diese daher zu einem neuen sozialen Band, das große Teile der Gesellschaft miteinander ins Vernehmen setzte. Das gipfelt in der Klimakrise als einem sogar globalen Thema.
Diese Gemeinsamkeiten, diese Art sozialen Bandes, gerieten mit der Corona-Politik ins Wanken, die die Gesellschaft spaltete. Es entstanden miteinander verfeindete Lager, die sich gegenseitig mit massivem Ressentiment begegneten, nicht zuletzt weil die zuvor entstandenen Gemeinsamkeiten im Corona-freundlichen Lager die Erwartung schürten, dass alle die Corona-Politik unterstützen würden, ging es schließlich um das hohe humane wie ökologische Gut der Gesundheit und des Lebensschutzes.
Als sich auf der anderen Seite im liberalen Lager viele bevormundet und kommandiert vorkamen, war die Enttäuschung auf der Seite der Corona-Politik groß und man begegnete den Gegnern mit harscher Ablehnung. Umgekehrt verloren die individualistischen Gegner der Corona-Politik das Vertrauen in die Demokratie, die plötzlich als Diktatur erschien, weil sie das Leben bis in die intimsten Sphären reglementierte.
Der Riss ist tief und geht quer durch die politischen Lager, was dazu führt, dass Freundschaften plötzlich zerbrechen, ohne dass darüber kommuniziert wird, weil man sich gegenseitig unlautere Haltungen unterstellt: individuelle Freiheit bzw. Grundrechte vs. Lebensschutz. Dieser sprachlose Bruch von Freundschaften erhielt den Namen ‚Ghosting‘ als ein gegenseitiges ressentimentbeladenes Abtauchen voreinander.
Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte Mitte Oktober 2025 zum wiederholten Male die Menschen dazu auf, diese Sprachlosigkeit und damit das ‚Ghosting‘ zu beenden, um diese private wie gesellschaftliche Spaltung zu überwinden.
Steinmeier hätte sich dabei auf Nietzsche berufen können, wenn dieser im Zarathustra schreibt: „Denn dass der Mensch erlöst werde von der Rache: das ist mir die Brücke zur höchsten Hoffnung und ein Regenbogen nach langen Unwettern.“12 Rache verdankt sich dem Ressentiment wie die Sprachlosigkeit unter den ehemaligen Freunden.
Von einem solchen Ressentiment ist auch Nietzsche mit seiner Verachtung seiner Mitmenschen nicht frei. Wie schreibt er noch in Zur Genealogie der Moral: „Wir sehen heute Nichts, das größer werden will, wir ahnen, dass es immer noch abwärts, abwärts geht, ins […], Gutmütigere, Klügere, Behaglichere, Mittelmäßigere, […], Christlichere – der Mensch, es ist kein Zweifel, wird immer ‚besser‘.“13
Das lässt sich sowohl auf den Corona- wie auf den Klima-Diskurs beziehen, die mit hohem moralischen Anspruch geführt werden und damit die Menschen immer „besser“ machen wollen. Nietzsche will dagegen den Menschen nicht moralisieren, aus dem Menschen einen ‚guten‘ machen, wie es die Klimaaktivisten oder die Verteidiger der Corona-Politik anstreben, für die sich der Mensch ihren moralischen Anforderungen unterwerfen und keine eigenen Werte entwickeln soll. Vielmehr soll er den politischen Mächten dienen, denen es um Gesundheit und Klima und damit um das moralisch ‚Gute‘ geht.
„Auf die Schiffe, ihr Philosophen!“
Jedenfalls lassen sich mit Nietzsches Philosophie des Ressentiments die zeitgenössischen Konflikte analysieren, gerade wenn man Nietzsches eigenes Ressentiment mit einbezieht. Nietzsche hat aber auch eine versöhnliche Perspektive entwickelt, die keine Zukunft bedrohlich präjudiziert wie die szientistischen Klima- und Corona-Verfechter. Er schreibt:
[E]ine neue Gerechtigkeit tut not! Eine neue Losung! Und neue Philosophen! Auch die moralische Erde ist rund! Auch die moralische Erde hat ihre Antipoden! Auch die Antipoden haben ihr Recht des Daseins! Es gibt noch eine andere Welt zu entdecken – und mehr als eine! Auf die Schiffe, ihr Philosophen!14
Dabei ist die Zukunft offen. So attestiert Karl Löwith Nietzsche, „dass er als der Philosoph unseres Zeitalters ebenso zeitgemäß wie unzeitgemäß ist“ 15. Zeitgemäß, weil man mit seinem Ressentiment-Begriff die aktuellen Ereignisse beleuchten kann! Unzeitgemäß, weil er eine darüber hinausweisende Perspektive entwirft, die sicher kaum jemand goutiert, der in die ressentimentbeladenen Konflikte am Anfang des 21. Jahrhunderts engagiert verstrickt ist.
Quellen
Feyerabend, Paul: Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie (1975). Frankfurt a. M. 1976.
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft (2. Aufl. 1787). Akademie-Ausgabe Bd. 3. Berlin 1968.
Löwith, Karl: Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts (1941). Sämtliche Schriften 4. Stuttgart 1988.
Ricœur, Paul: Hermeneutik und Psychoanalyse. Der Konflikt der Interpretationen II (1969). München 1974.
Smith, Adam: Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen (1776). München 1974.
Thomas von Aquin: Summa theologica I 2,1, (1265-73). Opera Omnia, Bd. 4. Rom 1886.
Fußnoten
1: Kritik der reinen Vernunft (2. Aufl. 1787), S. 460 f.
2: Summa theologica I 2,1 (1265-74), S. 31.
3: Also sprach Zarathustra, Von den Priestern.
4: Zur Genealogie der Moral, Abs. III, 9.
5: Der Wohlstand der Nationen (1776), S. 371.
6: Die Geburt der Tragödie, Versuch einer Selbstkritik, Abs. 5.
7: Nachgelassene Fragmente 1886 7[60].
8: Hermeneutik und Psychoanalyse (1969), S. 68.
10: Wider den Methodenzwang (1975), S. 45.
11: Also sprach Zarathustra, Von alten und neuen Tafeln, Abs. 8.
12: Also sprach Zarathustra, Von den Taranteln.
13: Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 12.
14: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 289.
15: Von Hegel zu Nietzsche (1941), S. 240.
Vom Leugner über die Verschwörungstheorie zum Ghosting
Nietzsche und die sozialen Verwerfungen durch heute grassierende Ressentiments
Nachdem sich Hans-Martin Schönherr-Mann bereits in zwei Artikeln auf diesem Blog mit Nietzsches Ressentiment-Begriff beschäftigte (hier und dort), widmet er sich in diesem nun der Frage, wie er sich auf die aktuelle gesellschaftliche Situation anwenden lässt.
Seine These: Die heutige politische Landschaft ist durch viele Zerwürfnisse geprägt, die auf Ressentiments beruhen. Sie verdanken sich der Schwächen der eigenen Argumente. So diffamiert man Kritiker als ‚Corona-‘ oder ‚Klima-Leugner‘. Die Einwände werden gerne als Verschwörungstheorien gebrandmarkt, darf man heute ‚Cui bono?‘ nicht mehr fragen. Oder man bricht zum Selbstschutz gleich kommentarlos den Kontakt ab. Das entspricht nicht nur an vielen Stellen Nietzsches Ressentiment-Verständnis, gerade weil er selbst davon nicht frei ist, aber nach Wegen hinaus sucht.
Der Frage „Worin besteht die Aktualität von Nietzsches Analyse und Kritik des ‚Ressentiments‘?“ widmet sich auch der diesjährige Eisvogel-Preis für radikale Essayistik, bei dem man erneut bis zu 750 Schweizer Franken gewinnen kann. Einsendeschluss ist der 25. August. Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie hier.
Wenn Sie sich den Artikel lieber anhören möchten, finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation eine audiovisuelle Version, eingelesen vom Autoren selbst (Link) – oder auf Soundcloud eine rein Audioaufzeichnung (Link).
Nietzsches Techniken des Philosophierens
Mit Seitenblicken auf Wittgenstein und Heidegger
Nietzsches Techniken des Philosophierens
Mit Seitenblicken auf Wittgenstein und Heidegger
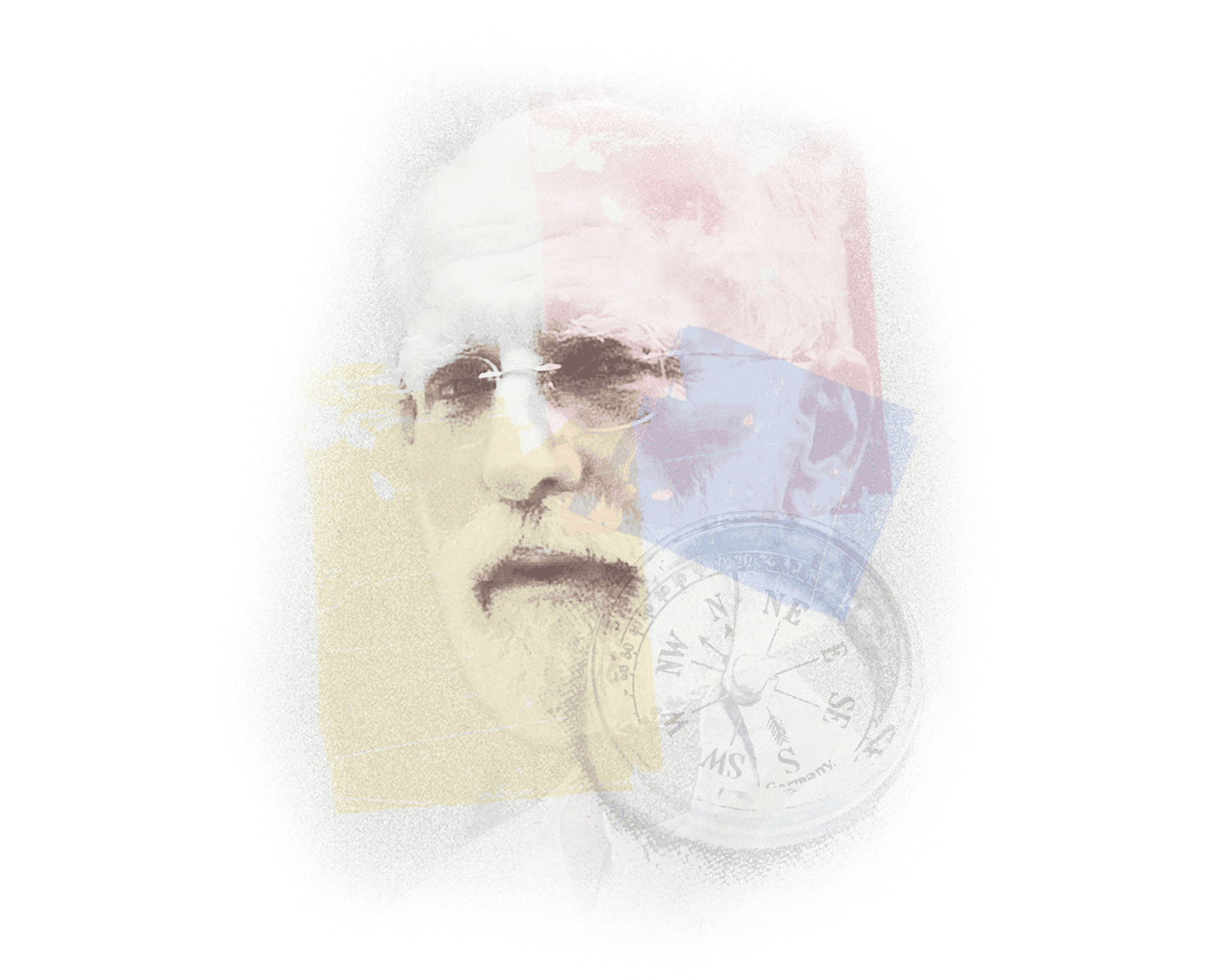

Ein fester Bestandteil der jährlichen Jahrestagung der Nietzsche-Gesellschaft ist die „Lectio Nietzscheana Naumburgensis“, bei der ein besonders verdienter Forscher am letzten Tag noch einmal ausführlich über das Thema des Kongresses spricht und einen prägnanten Schlusspunkt setzt. Beim letzten Mal wurde diese besondere Ehre Werner Stegmaier zuteil, dem langjährigen Herausgeber der wichtigen Fachzeitschrift Nietzsche-Studien und Verfasser zahlreicher wegweisender Monographien zur Philosophie Nietzsches. Das Thema der Tagung, die vom 16. bis 19. Oktober stattfand, lautete „Nietzsches Technologien“ (Emma Schunack berichtete).
Dankenswerterweise erlaubte uns Werner Stegmaier, diesen Vortrag in voller Länge zu publizieren. Er widmet sich in ihm dem Thema des Kongresses aus einer unerwarteten Sicht. Es geht hier nicht um das, was man landläufig unter „Technologien“ versteht – Maschinen, Cyborgs oder Automaten –, sondern um Nietzsches denkerische und rhetorische Techniken. Durch welche Methoden gelang es Nietzsche so zu schreiben, dass sein Werk bis heute immer wieder neue Generationen von Leserinnen und Lesern nicht nur überzeugt, sondern auch begeistert? Und was ist von ihnen zu halten? Er vergleicht dabei Nietzsches Techniken mit denen von zwei anderen bedeutenden Denkern der Moderne, Martin Heidegger (1889-1976) und Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Alle drei Philosophen verabschieden sich seines Erachtens von den in der Antike begründeten klassischen Techniken des begrifflichen Philosophierens und erkunden radikal neue, um ein neues Philosophieren im Zeitalter des „Nihilismus“ zu erproben. An die Stelle eines einsinnigen, metaphysischen Verständnisses von Rationalität tritt ein plurales, perspektivisches Denken, das sich notwendig völlig anderer Techniken bedienen muss. Der Artikel schafft einen grundlegend neuen Rahmen für das Verständnis von Nietzsches Denken und seines philosophischen Kontexts.
I. Nietzsches Faszination durch die Techniken seines Philosophierens
Nietzsche hat von Sokrates, seinem großen Antipoden, gesagt, er habe die vornehmen Athener mit seiner Dialektik „fascinirt“ – mit ihr habe er „ein schonungsloses Werkzeug in der Hand gehabt“, mit dem er den Intellekt seiner Gegner „depotenzirt“1 habe. Dialektik und mit ihr der ganze Rationalismus der westlichen Philosophie war für Nietzsche eine Technik, mit der sich ein Schein von Wahrheit erzeugen ließ. Zu seiner Zeit hatte sich, wie er bald schon für sich festhielt, die „Überzeugung“ durchgesetzt, „daß wir die Wahrheit nicht haben“2, das, was er dann „Nihilismus“ nannte. Nach langem Ringen um dessen Sinn und Folgen erkannte er in ihm zuletzt den „normalen Zustand,“3 in dem wir nach der Metaphysik nun wieder leben, einen Zustand, in dem sich das, was die Metaphysik und die an sie anschließende christliche Dogmatik zu obersten Werten erklärte, seine Glaubwürdigkeit verliert. Als er sah, dass es keine absoluten Gewissheiten mehr gibt, entmetaphysizierte und entmoralisierte Nietzsche konsequent die Sprache der Philosophie, um zu einer neuen „Vertiefung in die Wirklichkeit“4 zu kommen, die wir erst zögernd anfangen zu begreifen, weil wir selbst noch an den metaphysisch-moralischen Idealisierungen hängen.
Nietzsche hat, wie wir heute sehen, kein neues „System“ konstruiert; schon „der Wille zum System“ war für ihn bekanntlich ein „Mangel an Rechtschaffenheit“5. Die berühmten Lehren, die vor allem nach Heidegger der Kern eines solchen Systems sein sollten, die Lehren vom Übermenschen, vom Willen zur Macht und von der ewigen Wiederkehr des Gleichen, hat er, unter zahllosen anderen, seiner Figur Zarathustra in den Mund gelegt, ihn mit ihnen jedoch durchgehend scheitern lassen – niemand, das Volk nicht, seine Jünger nicht, seine Tiere nicht, die höheren Menschen nicht, versteht sie in seinem Sinn, und am Ende geht er allein seinem nur für ihn bestimmten Zeichen entgegen. Unter eigenem Namen führte Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse (Aph. 36) den Begriff des Willens zur Macht als bloße Hypothese zur Prinzipiensparsamkeit ein, als Mittel, das neue Bild der Realität möglichst übersichtlich zu machen („und nichts ausserdem“). Hier hatte er, wie man anhand der Neuedition des späten Nachlasses inzwischen gut erkennen kann, zunächst von der ewigen Wiederkehr des Gleichen gehandelt und an dessen Stelle dann erst den Willen zur Macht eingesetzt.6 Die beiden Hypothesen schienen ihm offenbar funktionsäquivalent für die radikale Neuorientierung der Philosophie, die im Nihilismus anstand. Sie waren für ihn keine Dogmen, sondern ein Teil der Technik seines Philosophierens.
Als Dogmen wurden sie auch nicht weitergeführt. Es gab nicht so etwas wie eine Nietzsche-Schule, vergleichbar zunächst der Hegel-, dann der Kant-Schule im 19. Jahrhundert. Stattdessen hat die Nietzsche-Interpretation inzwischen gelernt, sein Philosophieren nicht mehr auf bestimmte Doktrinen festzulegen, sondern seinen Orientierungsprozess mit all seinen Facetten und all den Unschlüssigkeiten und Wendungen, die er nimmt, zu verfolgen, Nietzsche an der Arbeit zu beobachten.7 Wir können versuchen, daraus zu lernen, wie man sich auch im Nihilismus orientieren und dafür weltweit Leserinnen und Leser gewinnen kann. Im Sinn des Themas dieses Kongresses gehe ich den Techniken von Nietzsches Philosophieren nach, um herauszufinden, wie er im normalen Zustand des Nihilismus eine Orientierungssicherheit gewonnen hat, die bis heute fasziniert.
Um dabei nicht auf Nietzsches Philosophieren fixiert zu bleiben, werfe ich zugleich Seitenblicke auf das Philosophieren Heideggers und Wittgensteins, die im 20. Jahrhundert am innovativsten wirkten. Beide wurden 1889, in dem Jahr geboren, in dem Nietzsche dem Wahnsinn verfiel. Wittgenstein nahm ihn eher distanziert zur Kenntnis, Heidegger baute ihn zum großen Gegner auf, um den eigenen ,anderen Anfang‘ gegen ihn zu profilieren.8 Beide aber leisteten etwas sehr Seltenes und Großes, was Nietzsche ,Selbstüberwindung‘ genannt hätte: Sie stürzten die Grundlagen ihrer eigenen ersten Philosophien um, mit denen sie weltberühmt geworden waren. Wittgenstein erkannte in seiner Logisch-Philosophischen Abhandlung, mit der er die „unantastbare und definitive“ „Wahrheit“ zur Lösung der philosophischen Probleme erreicht zu haben glaubte, eine Doktrin, die sich nicht aufrechterhalten ließ, Heidegger in Sein und Zeit einen verfehlten Schritt auf dem Weg zum „Sinn von Sein“. Stattdessen blickten sie nun ihrerseits auf die Techniken des Philosophierens: die Mittel und Wege, die es zu Doktrinen verführt, und die, durch die es sich davon freihalten kann. Sie sprachen jetzt, wie schon Nietzsche, betont mehr von ihrem ,Philosophieren‘ als von ihrer ,Philosophie‘. Auch sie setzten sich über hergebrachte Standards des Philosophierens hinweg und schufen radikal neue. Und sie hatten ebenfalls wie Nietzsche keinen vorgefassten Plan, den sie systematisch abgearbeitet hätten, sondern ließen sich ganz bewusst auf Überraschungen auch in ihrem eigenen Denken ein. Sie alle kamen mit ihrem Philosophieren nicht zu einem Ziel, sondern nur zu einem vorläufigen Ende. Und doch erreichten sie damit die stärksten Wirkungen.9
II. Gekonnter Umgang mit allgemeinsten Begriffen als Technik des Philosophierens überhaupt
Techniken sind nichts, was man für wahr hält; man beurteilt sie allein nach ihrem Funktionieren und Gelingen. Technik ist auch nicht, wie der späte Heidegger meinte, metaphysikverdächtig; denn sie ist nicht nur Maschinentechnik, die Nietzsche, wie wir gehört haben, gerne nutzte, und der sich Wittgenstein, als Student der Ingenieurswissenschaften, so intensiv widmete, dass er dabei über die Mathematik zur Philosophie kam. Techniken sind auch, für Nietzsche und ebenso für Wittgenstein, Techniken des Komponierens und Musizierens, des Dichtens und so auch des Philosophierens. Nach Nietzsche konnten griechische Tragödiendichter Techniken voneinander lernen,10 kann man in der Bildung Techniken erwerben,11 hat Richard Wagner „das Gelehrtenhafte tiefsinnig überwunden und in instinktive Technik verwandelt“12; Nietzsche spricht auch von Techniken des Handels, der Jagd13 und des sprachlichen Ausdrucks14. In einer Übersicht von Ende 188715 führt er „die große Technik und Erfindsamkeit der Naturwissenschaften“ als Mittel gegen die „Vermoralisirung aller bisherig. Philosophie {u. Werthschätzung}“, die christliche Idealisierung („z.B. {in der Musik}, im Socialismus“), Rousseaus „Haß gegen die aristokratische Cultur“, gegen die romantische „falsche u. nachgemachte Art stärkeren Menschthums“ und schließlich gegen den „Haß“ auf „alle Art Rangordnung u. Distanz“ an. Wie all das, „{was {relativ} aus der Fülle geboren ist im 19ten Jh, mit Behagen}“, sei Technik, neben der „{heiteren Musik usw.}“ und vielleicht auch der „{Historie (?)}“, ein „{relative[s] Erzeugnis[] der Stärke, des Selbstzutrauens des 19 Jhd}“; sie gibt in unserer Sprache neue Orientierungssicherheit, die den Nihilismus erträglich macht. Dagegen sei, wie Nietzsche dann in Der Antichrist (Nr. 44) schreibt, im Christentum die „Technik“, die „Kunst, heilig zu lügen, […] zur letzten Meisterschaft“ gekommen.
Techniken in diesem Sinn sind Praktiken, die nicht bewusst sein müssen, sondern im Gegenteil, wenn man sie sich als solche bewusst macht, z. B. beim Klavierspielen oder bei schlichten Bewegungsabläufen wie dem Gehen, sogar gestört werden können, wie Kleist es in seinem berühmten Aufsatz Über das Marionettentheater geschildert hat; Nietzsche schrieb darüber, wie schlecht man oft über seine Techniken reden kann.16 Sie werden durch Versuche erlernt und in einer Praxis eingeübt, bis man ,es‘ irgendwann ,kann‘, ohne dass man darum erklären können müsste, warum man es kann. Man kann sie lernen, indem man sie bei anderen beobachtet, aber nicht ohne weiteres lehren, weil jeder andere Geschicklichkeiten zu ihnen hat. In jedem Fall müssen sie ,gekonnt‘ sein, und auch das Philosophieren muss in diesem Sinn gekonnt sein. Ob es gekonnt ausgeübt wird, können wie bei jedem anderen Handwerk die am besten einschätzen, die es selber können.
Der späte Wittgenstein notierte für sich: „Wir gehen durch herkömmliche Gedankenbewegungen, machen, automatisch, Gedankenübergänge gemäß den Techniken, die wir gelernt haben. Und nun müssen wir erst, was wir gesagt haben, sichten.“17 Auch der späte Heidegger betont, dass das „Handwerk des Denkens“ gelernt und eingeübt sein müsse.18 Das ergibt einen ,technischen‘ Begriff der Philosophie selbst: nicht mehr bestimmt durch vorgegebene Gegenstände wie Welt und Wahrheit, Sein und Zeit, sondern als gekonnter Umgang mit allgemeinsten Begriffen dieser Art. Und nun kann man beobachten, was zu diesem Können gehört, hier also an den Beispielen Nietzsches, Wittgensteins und Heideggers.
III. Nietzsches Techniken des Philosophierens
A. Nietzsches Techniken als Antwort auf bestimmte Probleme
Im Zusammenhang von Nietzsches Charakterisierung von Sokrates’ „Magie des Extrems“ habe ich schon dargestellt, wie er selbst im Gang seines Werkes auf bestimmte Probleme, die sich ihm stellten, mit bestimmten Techniken ihrer Lösung antwortete.19 Ich bin dort auf sieben gekommen:
1. in der Geburt der Tragödie antwortete er auf das Problem des „theoretischen Menschen“, den Sokrates geschaffen habe, mit der Technik seiner Einbettung in die zugleich neu verstandene griechische Kultur;
2. in Menschliches, Allzumenschliches auf das Problem der Gesamtregierung der Erde mit der Technik der Vergleichung der Kulturen in einem „Zeitalter der Vergleichung“ (Bd. 1, Aph. 23);
3. in Morgenröthe auf das Problem der Selbstverkennung der europäischen Moral mit der Technik einer moralischen Kritik der Moral, aus der dann die Genealogie der Moral wurde;
4. in Die fröhliche Wissenschaft auf das Problem des Nihilismus mit der Technik einer Neuorientierung des Philosophierens von Grund auf durch die Einbeziehung der Kunst;
5. in Jenseits von Gut und Böse auf das Problem des Willens zur Wahrheit, der fortbesteht, auch wenn man weiß, dass man die Wahrheit nicht haben kann, mit der Technik der Erweiterung der Horizonte der menschlichen Orientierung (alle „Grundtriebe des Menschen“ haben „schon einmal Philosophie getrieben“ [Aph. 6]);
6. im V. Buch der Fröhlichen Wissenschaft auf das Problem der Rangordnung (auch im Recht zu Problemen) in einer Zeit unaufhaltsamer Demokratisierung mit der Technik einer Umstellung von Gleichheiten auf Unterschiede;20
7. in Götzen-Dämmerung und den letzten zur Veröffentlichung vorbereiteten Werken auf das „Problem vom Werth des Lebens überhaupt“ (Moral als Widernatur, 5) mit der Technik des Bejahens all dessen, was geschieht, oder der Befreiung vom Ressentiment21.
All diese Techniken – Einbettung, Vergleichung, selbstbezügliche Kritik, Einbeziehung der Kunst, Erweiterung der Horizonte, Brechen mit gewohnten Gleichsetzungen und Bejahung des Gegebenen – vergrößern die Spielräume von Nietzsches Philosophieren und geben seinem Philosophieren zugleich einen eigenen Halt. In diesem Sinn sind sie Orientierungstechniken.22 Man orientiert sich stets an etwas, ohne sich schon darauf festzulegen, und Nietzsche orientiert sich auch philosophisch im Fraglichkeits- und Vorläufigkeitsmodus. Die Wahrheit, die man „nicht haben“ kann, wird mit Nietzsche zum Teil des Spiels, zu einem „Stelldichein […] von Fragen und Fragezeichen“23, das sie nach aller Erfahrung tatsächlich ist. Danach ist das Philosophieren als gekonnte Handhabung allgemeinster Begriffe eine Technik des Sich-Orientierens in der Welt, das immer fraglich, immer vorläufig bleibt. Sie schließt beständig wachsame Selbstkritik, in Nietzsches Sprache unablässige ,Selbstüberwindung‘ ein.
Bis zu einem gewissen Grad kann man diese Techniken auch für Wittgenstein und Heidegger geltend machen. Deutlicher ist das jedoch bei
B. Nietzsches Techniken des Philosophierens überhaupt
Ich nenne wieder 7 Techniken. Wir müssen sehen, wie weit wir ihnen heute folgen wollen – und können.
1. Radikale Destruktion dogmatischer Wahrheiten – bis zum Nihilismus
Nietzsche und so auch Wittgenstein und Heidegger in ihrer Spätzeit destruieren konsequent die dogmatischen Wahrheiten nahezu aller bisherigen Philosophie außer der Heraklits. Man kann in der Philosophie nicht neu anfangen, ohne mit dem Alten aufzuräumen. Man kann es jedoch im Wortsinn von lat. destruere nur schrittweise ,abschichten‘, weil es das Denken immer noch leiten könnte. Alle drei gehen die Destruktion nicht mehr systematisch an wie noch Hegel, sondern greifen punktweise an, wo ihnen traditionelle Doktrinen die philosophische Neuorientierung zu verstellen scheinen, und zielen dabei meist auf Personen wie Sokrates, Platon und Aristoteles, Augustinus, Descartes, Spinoza, Kant und Hegel, stets aber im Blick auf selbstverständlich gewordene Standards des Philosophierens wie die Logik mit ihrem Prinzip des auszuschließenden Widerspruchs oder die epistemologische Isolierung von Vermögen wie Sinnlichkeit, Verstand, Gefühl und Wille. Sie alle lassen logische Paradoxa nicht nur zu, sondern setzen geradezu auf sie, Nietzsche etwa auf die Gewissheit von Ungewissheit,24 lebensnotwendige Unwahrheiten,25 das Lehren von Unlehrbarem (vgl. den gesamten Zarathustra), Mitteilen von Unmitteilbarem26 und Hinnehmen von Unhinnehmbarem (amor fati),27 Wittgenstein auf das Spiel mit Regeln in geregelten Sprachspielen, Heidegger auf die Unbegreiflichkeit des alles entscheidenden Seyns, das er – mit y verfremdet – zugleich hinschreibt und durchstreicht. Sie alle folgen darin Heraklit, der sich an die Zeit hielt, die keinen Bestand hat, Sokrates, der wusste, dass er nichts weiß, und Platon, der schrieb, dass er keine Lehren aufschreibt. Nietzsche greift darüber hinaus moralisch die scheinbar unangreifbare Moral an, soweit sie, selbst verlogen, das Philosophieren zu Lügen zwingt.
Der Gewinn der Technik der Destruktion, die Heidegger ausdrücklich so nennt,28 ist die Befreiung für neue Anhaltspunkte und Horizonte, Weisen und Wege, Standards und Befindlichkeiten des Philosophierens über Systemgrenzen hinaus. Bei Nietzsche sind das etwa Leiblichkeit, Triebe, Instinkte, Stimmungen, Rhythmen, die er zur „Musik des Lebens“29 zusammenfasst, Orientierung auch an anderen Kulturen und Sprachen, lebensnotwendige Täuschungen und Selbsttäuschungen, der große Ernst im Spiel mit allem. Der späte Wittgenstein gewinnt mit der Destruktion des eindimensionalen augustinischen Bilds der Sprache den Durchbruch zum Blick auf die vielfältigen Funktionen der Sprache in den Spielräumen vielfältiger Lebensformen und auf die Techniken der Vergewisserung, die sich in ihnen auftun. Der späte Heidegger sieht für die Lichtung des von ontologischen Vorgaben befreiten Sinns von Sein das „Zuspiel“ „anderer Anfänge“ in einem „ab-gründigen“, grundlosen „Zeit-Spiel-Raum“ vor, in den das Denken sich hineinfinden muss.30
2. Vertiefende Dekonstruktion – zum unmittelbar Plausiblen
Nur destruktives Philosophieren würde völlig haltlos machen; es muss zugleich konstruktiv weiterführen. Derrida hat Destruktion und Konstruktion glücklich im Begriff der Dekonstruktion zusammengeführt und zugleich davor gewarnt, in ihr eine verallgemeinerbare Methode zu sehen.31 Auch die Technik der Dekonstruktion, wie Nietzsche, Heidegger und Wittgenstein sie betreiben, ist in jedem Fall anders am Werk, und das gilt auch schon für die schrittweise Vertiefung der Begriffe in Hegels Dialektik. Sie hebt bisher gewonnene Begriffe so auf, dass sie konstruktiv zu ,tieferen‘ Einheiten der scheinbar einander ausschließenden Gegensätze weiterführt. So werden Widersprüche und Paradoxien auch für die philosophische Orientierung produktiv. Mit der Technik der Vertiefung gewinnen die Begriffe Halt aneinander, ohne dass sie an irgendeinem ,An sich‘ festgemacht werden könnten oder müssten. Anhalt ist stets die unmittelbare Plausibilität des jeweils ,tieferen‘, die bisherigen aufhebenden Begriffs. Bei Nietzsche ist das der Begriff des Lebens. Denn im Leben bewegt sich auch das Philosophieren selbst: „bei allem Philosophiren handelte es sich bisher gar nicht um ,Wahrheit‘, sondern um etwas Anderes, sagen wir um Gesundheit, Zukunft, Wachsthum, Macht, Leben …“32 Mit dem Begriff des Lebens bezieht Nietzsche all das in die philosophische Orientierung ein, was der Begriff eines reinen Denkens als ungewiss und haltlos aus ihr ausgeschlossen hatte, zuallererst die Leiblichkeit und Sinnlichkeit und dann mehr und mehr die unüberschaubar verflochtenen Kontexte und Komplexitäten all dessen, was in der Welt erlebt und erfahren wird. Den Begriff des Lebens vertieft Nietzsche wiederum in den des Willens zur Macht und folgt dabei ausdrücklich dem der alten occamschen Technik der Prinzipiensparsamkeit.33 So gebraucht er ,Wille zur Macht‘ nicht als metaphysischen, sondern als technischen Begriff, als Technik einer konsequenten Begriffsarbeit, und zugleich hat er mit seiner unmittelbaren Plausibilität ein großes Publikum geradezu elektrisiert.
Im Mitternachts-Lied, das Nietzsche am Ende des III. und des IV. Teils von Also sprach Zarathustra wie eine Lösung aller philosophischen und vielleicht auch alltäglichen Probleme einrückt und das, angebracht an einem überragenden Felsen auf der Halbinsel Chastè im Silser See, bis heute Tag für Tag die Spaziergänger gebannt stehen bleiben lässt, demonstriert er seine Technik der Vertiefung am eindrucksvollsten.34 Hier macht er ,tief‘ selbst zum Leitwort – es kommt in elf Zeilen acht Mal vor – für die Einheit des Lebens mit seinen Gegensätzen von Tag und Traum, Weh und Lust, Vergehen und Ewigkeit. Die Tiefe des Philosophierens, die man hier unmittelbar spürt, kommt im Lied gänzlich ohne Begründungen aus; auch die Begriffe von Leben und Willen zur Macht erscheinen nicht mehr, und die „tiefe, tiefe Ewigkeit“ ist auch nicht die der Wiederkehr des Gleichen, sondern der Lust, der Lust am Leben, und das Mitternachts-Lied macht Lust zum Leben.
In der Sprache des späten Heidegger besteht die Vertiefung der Begriffe, die dem Philosophieren Halt gibt, in ,Fügungen‘, die es auch in ,Abgründen‘ noch leiten. Er entwickelt eine eigene poetische Sprache, in deren Fügungen und Fugungen das vergessene Seyn statt logisch begreiflich in der Stille hörbar und so unmittelbar plausibel werden soll. Wittgenstein, für den zunächst noch der Logik „eine besondere Tiefe – allgemeine Bedeutung – [zukam]“, als liege sie „am Grunde aller Wissenschaften“35, sieht dann, skeptisch geworden gegen alles Tiefe in der Philosophie, dass „der Tiefe des Wesens“, die hier vermutet werde, lediglich „das tiefe Bedürfnis nach der Übereinkunft“ entspricht.36 „Tiefe Bedeutung“ bekomme etwas durch eine „Umgebung“, einen bestimmten Kontext, der ihm „Wichtigkeit“ gebe, das sei schon alles.37 Vor allem die philosophisch so geschätzte Technik der scheinbaren Vertiefung der Menschenbeobachtung in ein Inneres, die Begründung beobachtbarer Handlungen durch unbeobachtbare „seelische“ oder „geistige Vorgänge“, schien ihm ein „Taschenspielerkunststück“ zu sein.38 Nietzsche hätte dem wohl nicht widersprochen.
3. Strategische Verallgemeinerungen – bis zum Extrem
Begriffe zu vertiefen ist zugleich eine Technik der Verallgemeinerung. Mit Begriffen überhaupt löst man sich von der Situation, in der sie gebraucht werden, und gewinnt einen weiteren Überblick; mit der fortschreitenden Vertiefung und Verallgemeinerung von Begriffen kann man die augenblickliche Situation, in der man steht, immer besser einordnen und immer mehr mit ihr anfangen. Philosophie mit ihren allgemeinsten Begriffen sucht einen Überblick über das Ganze des Weltgeschehens, um nach Möglichkeit in es eingreifen zu können.
Seit der aristotelischen Metaphysik glaubte man einen festen Anhalt an einem pyramidalen Aufbau von immer allgemeineren Begriffen zu haben; an der Spitze stand dann der allerdings gänzlich leere Begriff des bloßen Seins. Nietzsche, Wittgenstein und Heidegger brechen damit und entlarven die Abstraktion nach genus proximum und differentia specifica als bloße Orientierungstechnik.39 Denn man kann von jedem Punkt aus in unterschiedliche Richtungen und in verschiedenen Graden Begriffe verallgemeinern, muss aber auch jede diese Verallgemeinerungen selbst verantworten. Man kommt weder im Alltag noch in der Philosophie ohne Verallgemeinerungen aus. Aber man ruft dabei nicht ein an sich bestehendes Allgemeines ab, sondern betreibt die Verallgemeinerungen stets strategisch nach bestimmten Bedürfnissen.
Nietzsche hat bei seinem Lehrer Schopenhauer die typische „Philosophen-Wuth der Verallgemeinerung“ angeprangert: Er habe aus dem „ungefähren Fingerzeig“ aufdringlicher und durchdringender geschlechtlicher Willensregungen die „poetische Metapher“ eines blinden Willens gemacht, den schlechthinigen „Primat des Willens vor dem Intellect“ behauptet, ihn „in eine Lücke der Sprache hineingestellt“ und „zu einer falschen Verdinglichung gemissbraucht“; „alle Modephilosophen“ hätten den „mystischen Unfug“ dann weiter ausgemalt und verbreitet.40 Sein eigenes Philosophieren kennzeichnete Nietzsche stattdessen als „schwindelerregende Weite der Umschau, des Erlebten, Errathenen, Erschlossenen“ und zugleich als „{den Willen zur Consequenz}, die Furchtlosigkeit vor der Härte u gefährlichen Consequenz“.41 Ohne Metaphysizierung und einen pyramidalen Aufbau der Begriffe treibt er die Technik der Verallgemeinerung ins Extrem.
Er thematisiert das selbst in seiner Lenzerheide-Aufzeichnung, in der er sich, nach dem Abschluss von Jenseits von Gut und Böse und dem V. Buch der Fröhlichen Wissenschaft, einen Überblick über die leitenden Gedanken seines eigenen Philosophierens zu verschaffen sucht.42 Er beobachtet dort, wie das Extrem des Glaubens an den einen allwissenden, allmächtigen und gerechten Gott, der der menschlichen Orientierung einen absolut gewissen Halt gegeben hat, nun umschlägt in das Extrem des Glaubens an eine vollkommene Ordnungs-, Sinn- und Wertlosigkeit des Daseins, der bei der Masse der nun Rat- und Orientierungslosen zum Willen zur Zerstörung aller Ordnungen und zur Selbstzerstörung werden müsse. Seinen Gedanken der ewigen Wiederkunft und des Willens zur Macht gibt er hier die Funktion, diese Extremisierung noch strategisch zu steigern: Sie sollen einerseits destruktiv die Entmutigung und Lähmung verschärfen und andererseits konstruktiv eine neue „Rangordnung der Kräfte“ provozieren. Sie sind konsequent nicht mehr auf Wahrheit, sondern auf Wirkung angelegt.
Die „Magie des Extrems“43 liegt darin, dass es auf Anhieb ohne Gründe fasziniert, selbst wenn es genug Gegengründe gibt. So war nach der Lenzerheide-Aufzeichnung auch der bisherige „‚Gott‘ […] eine viel zu extreme Hypothese“.44 Aber alle All-Aussagen sind extrem, auch diese, Philosophieren als solches entpuppt sich selbst als ein extremes Unternehmen. Wie der Begriff eines Gottes, der alle Welt beherrscht, sind auch Begriffe wie ,reine Vernunft‘ und ,transzendentales Subjekt‘, mit denen vom ganzen Rest der Welt abgesehen wird, und ebenso „,Wille zur Macht‘ – und nichts ausserdem“45 extreme Verallgemeinerungen; Zarathustra, Nietzsches Figur des philosophischen Lehrers, ist als Extrem geistiger und körperlicher Überlegenheit angelegt.46
Doch auch die Extremisierung allein macht es nicht, eben weil das eine Extrem immer in ein anderes umschlagen kann. Mit ihr muss man ebenfalls gekonnt umgehen. Nietzsche schließt so bekanntlich die Lenzerheide-Aufzeichnung: Danach erweisen sich „die Mäßigsten, die, welche keine extremen Glaubenssätze nöthig haben“, als „die Stärksten“.47 Die stärkste philosophische Technik des Philosophierens wäre demzufolge, Extreme zu denken, ohne ihnen zu verfallen, sondern sich lediglich an ihnen zu orientieren. Legt man sich nicht auf sie fest, kann man mit ihnen experimentieren, Gedankenexperimente anstellen. So hat Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft (Aph. 109) versucht, das vollkommene Chaos zu denken, in dem noch kein Gesetz gilt und es keinerlei Ordnung gibt, also einen extremen nihilistischen Zustand, um zu sehen, was dann möglich wird, und zuletzt als Gegen-Extrem die „große Ambition“ erwogen, „[ü]ber das Chaos Herr [zu] werden {das man ist}; das dieses {sein} Chaos [zu] zwingen, Form zu werden; Nothwendig{keit} [zu werden] in Form: logisch, hart, furchtbar, langsam, einfach, Gesetz {einfach, unzweideutig, Mathematik [] Gesetz“.48 Wenn die Extreme im Philosophieren den Sinn haben, äußerste Spielräume für es aufzumachen, so verbindet Nietzsche programmatisch das Größte und Fernste mit dem Kleinsten und Nächsten, bindet das Allgemeinste an das Konkreteste zurück. Mit dieser Technik verschafft er seinem so weit ausgreifenden Philosophieren zugleich alltägliche Plausibilität.
Große Spielräume bedeuten aber auch Ungewissheit und Unsicherheit der Orientierung, im Alltag wie in der Philosophie. Für den späten Wittgenstein reicht „in jedem ernsteren philosophischen Problem […] die Unsicherheit bis an die Wurzeln hinab. / Man muß immer darauf gefaßt sein, etwas ganz Neues zu lernen.“49 So macht er aus der Not eine Tugend und stellt das Bedürfnis nach Orientierungssicherheit im Philosophieren selbst in Frage: „Nur wenn man noch viel verrückter denkt, als die Philosophen, kann man ihre Probleme lösen.“50 Auch Heidegger will nach dem Abschied von der Metaphysik ausdrücklich keine Sicherheit mehr suchen. Er notiert in seine Schwarzen Hefte: „Absage an alle Sicherung und Unsicherheit – die nur dem Aufstand der Eigensucht des Menschenwesens entstammt“, dem Willen zur Macht in Heideggers metaphysischer Deutung.51
4. Persönliche Perspektivierungen – bis zum Kompromittierenden
Mit ihren gedanklichen Großexperimenten sind gerade produktive Philosophen lange allein – je größer die Experimente angelegt sind, desto weniger trauen sich andere, sie mitzumachen. Auch Gipfelgespräche unter Zeitgenossen sind selten und selten fruchtbar; Nietzsche fand nach Lou Salomé und Paul Rée niemanden mehr, mit dem er auf Augenhöhe hätte philosophieren können, Heidegger und Jaspers entfremdeten sich bald, und Heidegger und Wittgenstein ignorierten einander vollständig. Alle beklagten die Not, vorläufig nicht verstanden zu werden.
So ist man im Nihilismus als normalem Zustand zuletzt auf seine eigene Orientierung angewiesen. Nietzsche hat von Anfang an mutig die eigene Person ins Spiel gebracht, besonders auffällig in den Unzeitgemässen Betrachtungen; zuletzt, in den neuen Vorreden und in Ecce homo, rückt er seine Person ganz in den Vordergrund. Als er hier seine „Kriegs-Praxis“ darlegt, zählt er auch die Strategie oder Technik dazu, sich selbst zu „compromittiren“52: Alle, die philosophieren, lassen dabei unvermeidlich einen bestimmten Standpunkt erkennen. Auch wenn man sich hinter dem scheinbaren Konsens eines ,man‘ oder ,wir‘ zu verbergen sucht, findet man sich selbst unter ,guten Freunden‘, die auch Nietzsche mitunter herbeizitiert, auf einem „Spielraum und Tummelplatz des Missverständnisses“53. Positiv könnte es einen guten Teil von Nietzsches Wirkung ausmachen, dass er sich offen und ehrlich zum Persönlichen seines Philosophierens bekennt und dabei auch schildert, wie er zu seinen Gedanken kommt – nicht im Sitzen am Schreibtisch, sondern auf langen Spaziergängen –, wie die Gedanken da unversehens auftauchen und sich erst nach und nach ausgestalten, wie sie fliegen lernen, aber auch auf Gleise geraten können, aus denen sie schwer wieder herauskommen. Für einen „Willen zum System“ ist das kompromittierend, bei einem Philosophen wie Nietzsche schafft es Vertrauen in seine Aufrichtigkeit.
Philosophisch geht Nietzsche bekanntlich vom „Phänomenalismus und Perspektivismus“54 aller Orientierung aus. Er macht aus der Not des Nihilismus als des Verlustes aller allgemeiner Gewissheiten eine Tugend: die Technik, Perspektiven „aus- und einzuhängen“ und sich so „gerade die Verschiedenheit der Perspektiven und der Affekt-Interpretationen für die Erkenntniss nutzbar zu machen“, jenseits „der gefährlichen alten Begriffs-Fabelei, welche ein ,reines, willenloses, schmerzloses, zeitloses Subjekt der Erkenntniss‘“, eine „reine Vernunft“, „absolute Geistigkeit“, „Erkenntniss an sich“ angesetzt hat.55 So stellen sich philosophische Probleme jedem und jeder anders. Hier kommt es nach Nietzsche wiederum darauf an, „ob ein Denker zu seinen Problemen persönlich steht, so dass er in ihnen sein Schicksal, seine Noth und auch sein bestes Glück hat, oder aber ,unpersönlich‘“.56 Im Nihilismus kann man nur so überzeugen, dass man zu seinen Standpunkten, Horizonten und Perspektiven auch im Philosophieren steht.
Heidegger und Wittgenstein sind nicht so weit gegangen. Sie halten, wie es im Zug der Verwissenschaftlichung der Philosophie zum Standard geworden war, ihre Person aus ihren Schriften möglichst heraus oder beschränken persönliche Äußerungen auf Vorworte. Der späte Heidegger will das Seyn selbst sprechen lassen; der späte Wittgenstein hält in seinen beliebten Kurzdialogen die Leser(innen) regelmäßig im Unklaren, auf welcher Seite er selbst steht.
5. Elastische Sprachgebung – in äußerster Prägnanz
Mit seiner Sprachkunst kann Nietzsche das, was er schreibt, meist ohne weitere Begründung unmittelbar plausibel machen. Er nutzt bewusst die Beweglichkeit von Begriffen entlang von Metaphern, die er sich schon in Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne deutlich gemacht hatte und zuletzt in Zur Genealogie der Moral auf die knappe Klausel bringt: „Die Form ist flüssig, der ,Sinn‘ ist es aber noch mehr …“57. Begriffe überzeugen, gerade wenn sie nicht terminologisch fixiert werden, dadurch, dass sie ihrerseits leben, „mehr oder minder tiefgehende, mehr oder minder von einander unabhängige, an [ihnen] sich abspielende Überwältigungsprozesse“ durchlaufen (ebd.), kurz, dass sie mit der Zeit gehen, in der sich die Orientierung selbst verändert, während sich starre Definitionen rasch als unzureichend und hemmend erweisen. Nietzsche bildet mit einem Wort elastische Begriffe, wie Wittgenstein sie dann nennt.58 Um auf unterschiedliche Themenkomplexe unterschiedlich eingehen zu können, bedient sich Nietzsche wie kein anderer vielfältiger Formen philosophischen Schreibens, Abhandlung, Essay, Aphorismen-Buch, Dialog, Lehrdichtung, Streitschrift und Lied,59 und durchformt sie alle mit einer Technik musikalischer Gestaltung, weil Musik als solche überzeugt.60 Zu ihr gehört die Technik sprachlicher Abkürzung, der Prägnanz; Nietzsche rühmt sich, vielleicht ja zu Recht, selbst der größte Meister darin zu sein, mit einem „minimum in Umfang und Zahl der Zeichen […] ein maximum in der Energie der Zeichen“61 zu erzielen. Hinzu kommt seine Technik des „Glaublich-Machens“ durch Bilder und Gleichnisse, mit denen man „überzeugt“, ohne „beweisen“ zu wollen, eben dort, wo es, anders als in den Wissenschaften, nichts wirklich zu beweisen gibt.62
Wittgenstein war, scheint mir, Nietzsche in seiner sprachlichen Prägnanz ebenbürtig. Wie Nietzsche in Aphorismen-Büchern, in denen man leicht zwischen Themen und Kontexten wechseln und blitzartig neue Einsichten aufscheinen lassen kann („ich halte es mit tiefen Problemen, wie mit einem kalten Bade – schnell hinein, schnell hinaus“63), so philosophierte Wittgenstein in seiner Spätzeit nur noch in verstreuten „Bemerkungen“, die er wie „Landschaftsskizzen“ in „Alben“ zusammenstellte,64 in denen sich jede und jeder selbst orientieren muss. Seine späteren Leitbegriffe ,Sprachspiel‘, ,Lebensform‘ und ,Familienähnlichkeit‘ lehnt er bewusst unterminologisch an die Alltagssprache an und gebraucht sie in beweglichen Spielräumen, ohne sie je streng zu definieren. Weil man annehmen darf, dass sich gerade in der Alltagssprache mit der Zeit die jeweils zur Orientierung geeignetsten Verständigungsmöglichkeiten einspielen, bleibt er ihr im Philosophieren möglichst nahe. Er überbietet noch Nietzsches Heraklitismus, indem er in seinen letzten Bemerkungen Über Gewißheit das Bild des Flusses, in den man nicht zwei Mal steigt, zum Bild des Flussbetts weiterbildet, das sich mit dem Fließen des Flusses seinerseits ständig verändert: Nicht nur die menschliche Orientierung selbst, auch ihre Rahmenbedingungen verändern sich laufend.65 Und auch Wittgenstein verstand sich vor allem als Erfinder neuer Gleichnisse.66
Der späte Heidegger hat die Technik, mechanisierte Terminologien zu vermeiden und stattdessen die Alltagssprache philosophisch neu sprechend zu machen, geradezu zur Manie gemacht, um das unaussprechliche und nicht beherrschbare ,Seyn‘ sprechen zu lassen: indem er jeweils auf die Wortwurzeln zurückging und ihnen tiefere und anspielungsreichere Bedeutungen gab, in denen sie sich auf überraschende Weise neu fügten.67
6. Passungen bloßer Anhaltspunkte – in größter Dichte
Der platonische Sokrates68 setzte sich von den Sophisten ab, indem er vom rhetorisch geschulten Überreden das mit definierten Begriffen und beiderseits anerkannten Argumenten arbeitende Überzeugen unterschied, und begründete so die Philosophie als eigenständige Disziplin. Aristoteles erarbeitete daraus in seiner Topik und seinen Analytiken die Standards der Logik, auf der er zugleich seine Metaphysik aufbaute. Für Nietzsche ebenso wie für Heidegger und Wittgenstein schränken die Standards der Logik das Philosophieren von vornherein ein, eben weil die Begriffe auch im philosophischen Sprachgebrauch immer im Fluss sind, wie heute das Historische Wörterbuch der Philosophie69 hinreichend zeigt. Zudem führt auch die terminologische Fixierung der Begriffe durch Definitionen zuletzt wieder auf undefinierte Begriffe zurück, und Argumente überzeugen, wie Platon schon in Dialogen wie dem Protagoras oder dem Gorgias zeigt, nie alle, also nicht allgemein. Sie sind dann ,gut‘, wenn sie in bestimmten Situationen ,passen‘, das heißt, die jeweiligen Gesprächspartner mit ihren jeweiligen Standpunkten, Horizonten und Perspektiven überzeugen. ,Passen‘ ist die tiefere Einheit des Gegensatzes von ,Überreden‘ und ,Überzeugen‘.
Die Kriterien der Passung können dabei ganz unterschiedlich sein. Aphorismen in Aphorismen-Büchern müssen zueinander passen, ohne auseinander zu folgen. In Nietzsches ,fröhlicher Wissenschaft‘ passen sie nach künstlerischen Kriterien zueinander. „Man ist um den Preis Künstler,“ notiert er zuletzt, „daß man das, was alle Nichtkünstler Form nennen, als Inhalt, als die Sache selbst empfindet.“ Damit, fügt er hinzu, „gehört man freilich in eine verkehrte Welt.“70 Das ist jedoch nicht so neu und verkehrt, wie es scheint. Schon für Aristoteles, der die Korrelation von Form und Inhalt wegweisend für die europäische Philosophie auf den Weg brachte, hat die Form das größere Gewicht: Sie prägt nach ihm die Inhalte, gibt ihnen erst erkennbare Gestalt, und diese Gestalt, die sich bei Lebewesen in ihrem gleich bleibenden Anblick (eīdos) zeigt und in der konstanten Fortzeugung der Individuen einer Art erhält, ist ein ganz realer und deutlicher Anhaltspunkt für die Bildung dauerhafter Begriffe und damit auch die Grundlage systematischer Philosophien im heutigen Sinn. Aristoteles hypostasiert die Formen lediglich metaphysisch zu ewigen Wesen (ousíai), was sich heute nicht mehr halten lässt.
Nachmetaphysisch haben wir es mit eingespielten Passungen in der Beobachtung von Anhaltspunkten zu tun wie individuellem und allgemeinem Aussehen, Wörtern und Sachverhalten, Wörtern, Bildern und Begriffen untereinander in Sätzen, Sätzen in Texten, Argumenten in Beweisverfahren, Formen und Farben, Landschaften und Stimmungen, Gefühlen und Gesichtsausdrücken usw. bis hin zum Zusammenpassen von individuellen Menschen zu Gruppen und Gesellschaften. Passungen bilden sich laufend fort und können immer neue Formen annehmen. Nach Nietzsche legt man sich seine Welt jeweils passend zu seinen Bedürfnissen und Erwartungen zurecht, es sind, im Sinn seines Begriffs des Willens zur Macht, Passungen um fast jeden Preis:
Der Epikureer sucht sich die Lage, die Personen und selbst die Ereignisse aus, welche zu seiner äusserst reizbaren intellectuellen Beschaffenheit passen, er verzichtet auf das Uebrige – das heisst das Allermeiste –, weil es eine zu starke und schwere Kost für ihn sein würde. Der Stoiker dagegen übt sich, Steine und Gewürm, Glassplitter und Skorpionen zu verschlucken und ohne Ekel zu sein; sein Magen soll endlich gleichgültig gegen Alles werden, was der Zufall des Daseins in ihn schüttet[.]71
Die „ethischen Bedürfnisse müssen uns“, notiert Nietzsche zuvor, „auf den Leib passen!“72
Wir haben in unserer Orientierung nur Anhaltspunkte, an die wir uns vorläufig halten, weil sich hinter ihnen stets unendlich Vieles verbergen kann; wir trauen ihnen umso mehr, je besser sie in einer bestimmten Situation unter einer bestimmten Perspektive zu weiteren passen. Passen sie hinreichend gut zueinander, werden sie plausibel, man kann ,etwas mit ihnen anfangen‘, wie ebenso Wittgenstein und Heidegger wie Nietzsche zu sagen pflegen. Auch das gilt in der Philosophie ebenso wie im Alltag. Schaltet man hier Methoden ein, müssen auch sie zum jeweiligen Gegenstand und Sachbereich passen, um zu überzeugen. So ist es eine gängige, wenn auch meist unbemerkte Technik des Philosophierens, das jeweils Passende zu finden und, wenn es sich nicht findet, zu erfinden. Dabei geht es letztlich, wie Wittgenstein, der sehr stark mit dem Begriff des Passens operiert,73 an einer zentralen Stelle seiner Philosophischen Untersuchungen schreibt, um „übersichtliche Darstellung“ (Nr. 122). Heidegger hat das mit seinem Sprachspiel der „Fügungen“ und „Fugungen“ poetischer und pathetischer formuliert: „Alles Fügen des Gefüges wird nur aus der Fügsamkeit zum Fug.“74 Die Passung ist für Heidegger, auch wenn er sie nicht so nennen würde, die Technik der Lichtung des Seyns. Niemand aber hat so reiche und vor allem auch ganz alltägliche und unmittelbar plausible Anhaltspunkte für sein Philosophieren gefunden, die so überzeugend zueinander passen, ohne systematisch rekonstruierbar zu sein, wie Nietzsche. Die Dichte seiner Passungen überzeugt schon als solche.
7. Erzeugung von Pathos – durch Berufung auf den Gott Dionysos
Zum Philosophieren gehört schließlich das Pathos, und auch auf die Technik des Pathos hat sich niemand so verstanden wie Nietzsche. Schon die hohe oder tiefe Allgemeinheit der von der Philosophie gebrauchten Begriffe schafft eine erhabene Grundstimmung. Die Erhabenheit wird gesteigert, wenn man bis zum Göttlichen hinaufsteigt. Auch Nietzsche, Heidegger und Wittgenstein tun das noch, sie tun es auch noch und vielleicht gerade im Nihilismus, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. Wittgenstein bekennt sich, jedoch nur persönlich und vorwiegend in seinen Geheimen Tagebüchern und Briefen, gläubig zu Gott, dem christlichen, die Sündigkeit des Menschen überwachenden und sie strafenden, ihm aber auch unerschütterlichen Halt gebenden Gott. Aus seinem Philosophieren hält Wittgenstein ihn konsequent heraus. Das macht ihn skeptisch gegen alles Pathos in der Philosophie:
„Die Sprache (oder das Denken) ist etwas Einzigartiges“ – das erweist sich als ein Aberglaube (nicht Irrtum!), hervorgerufen selbst durch grammatische Täuschungen. Und auf diese Täuschungen, auf die Probleme, fällt nun das Pathos zurück.75
Heidegger dagegen, der dem Christentum entschieden abgesagt hat, erwartet in seinem späten Philosophieren mit dem für ihn „einzigen“ Dichter Hölderlin noch einmal einen ganz anderen als den christlichen, den „letzten Gott“ eines neuen und „anderen Anfangs“ des Philosophierens.76 Die „Entscheidung über die Flucht und Ankunft der Götter“ sei „die Eröffnung eines ganz anderen Zeit-Raumes für eine, ja die erste gegründete Wahrheit des Seyns, das Ereignis“. Es soll ein Gott sein, der still vorbeigeht und befremdlich und unberechenbar bleibt und der nur „Winke“ für eine neue Orientierung von Grund auf gibt. Er soll nach Heidegger „reinste Verschlossenheit und höchste Verklärung, holdeste Berückung und furchtbarste Entrückung“ sein und auch selbst des Seyns bedürfen, das sich von sich aus lichten müsse. Diese Lichtung aber müssten „große und verborgene Einzelne“ mit ihrem Philosophieren „vor-läufig“ vorbereiten.77
Eines solches Pathos lässt schaudern und ergreift, ob es nun sachlichen Anhalt hat oder nicht. Dagegen hat Nietzsche geradezu fröhlich Dionysos zum Gott seines Philosophierens ausgerufen.78 Dionysos ist seine Idee eines Gottes, der laufend alles zerstören und neu fügen und, so könnten wir jetzt sagen, auf unergründliche Weise miteinander passend machen und sich mit solchen Fähigkeiten souverän auch im Nihilismus orientieren kann. Nietzsche macht aus dem Pathos und Paradox der Metaphysik, sich auf einen Gott zu berufen, aus dem man alles begreifen kann, ohne ihn selbst zu begreifen, ganz offen eine Technik seines Philosophierens. Im Aphorismus Nr. 56 von Jenseits von Gut und Böse schildert er den – zunächst nicht genannten – Gott als „das Ideal des übermüthigsten lebendigsten und weltbejahendsten Menschen, der sich nicht nur mit dem, was war und ist, abgefunden und vertragen gelernt hat“, der es rechtfertigt und „so wie es war und ist, wieder haben will, in alle Ewigkeit hinaus“. Nur von einem göttlichen Standpunkt aus ist der Gedanke der ewigen Wiederkehr des Gleichen nachzuvollziehen. Nimmt man ihn ein, wird das ganze Weltgeschehen, das Menschen so sehr fasziniert und irritiert, sich immer wiederholen mag und letztlich keinen Sinn hat, zu einem Schauspiel in einem griechischen Amphitheater, in dem man von erhöhten Rängen aus auf das Geschehen in der Orchestra hinabblickt, dabei an ihm teilnimmt und ihm zugehört und zugleich auf Distanz zu ihm bleibt. Und Dionysos war der Gott des Theaters, die Athener hatten es ihm zu Ehren erbaut, ihm, der „gerade dies Schauspiel nöthig hat – und nöthig macht – –“ (ebd.). Und die Philosophie blieb ihm verpflichtet: Man nimmt, wenn man philosophierend das Weltgeschehen zu überblicken versucht, unvermeidlich einen göttlichen Standpunkt ein. Dionysos aber, so modelliert ihn Nietzsche dann im Aphorismus Nr. 295 von Jenseits von Gut und Böse, in dem er ihn zum Gott seines Philosophierens erklärt, weiss zugleich „bis in die Unterwelt jeder Seele hinabzusteigen“, versteht sich als Theatergott auf jede Maske und jeden Schein und hält, indem er das Spiel mit ihnen vorführen lässt, mit alldem zu einer „gewagten Redlichkeit, Wahrhaftigkeit und Liebe zur Weisheit“ an. Er liebe den Menschen, lässt Nietzsche ihn in einem inszenierten Zwiegespräch sagen, weil er sich „in allen Labyrinthen noch zurecht[finde].“ Das aber ist nur ein anderes Wort für Orientierung, hier für philosophische Orientierung. Eine dionysische philosophische Orientierung hält sich alles offen, wagt immer neue Anfänge und geht mit unterschiedlichsten Techniken an die Beobachtung des Weltgeschehens heran, und Nietzsche sieht Part des Gottes darin, dem Menschen „immer um viele Schritt“ voraus zu sein, um ihn nicht bei irgendwelchen Festlegungen, Überzeugungen, Dogmen feststecken zu lassen, deren er so bedarf.
Zum Schluss aber entlarvt Nietzsche auch seine Berufung auf einen Gott, diesen verlockenden und verschlagenen Gott Dionysos, als bloße Technik seines Philosophierens. Denn die Götter in ihrer Erhabenheit mussten nie lernen sich zu orientieren und brauchten darum auch nicht zu philosophieren.79 Und so können, schließt Nietzsche den Aphorismus, „in einigen Stücken die Götter insgesammt bei uns Menschen in die Schule gehn“. Die Götter, an die sich die Menschen so gerne pathetisch beim Philosophieren halten, müssen sich ihrerseits dabei an die Menschen halten – „circulus vitiosus deus“80.
Als Sich-Orientieren weiß sich jedes Philosophieren an einen irdischen Standpunkt gebunden. Es kann heute auch nüchtern und unpathetisch am Boden bleiben.
Werner Stegmaier, geboren am 19. Juli 1946 in Ludwigsburg, war von 1994 bis 2011 Professor für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische Philosophie an der Universität Greifswald. Von 1999 bis 2017 war er leitender Mitherausgeber der Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, dem renommiertesten Organ der internationalen Nietzsche-Forschung, sowie der wichtigen Schriftenreihe Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung. Er veröffentlichte zahlreiche Monographien und Sammelbände zu Nietzsches Philosophie und zur Philosophie im Allgemeinen, vor allem seine Philosophie der Orientierung (2008), dann Luhmann meets Nietzsche. Orientierung im Nihilismus (2016) und jüngst Wittgensteins Orientierung. Techniken der Vergewisserung (2025). Die Weiterentwicklung der von ihm begründeten „Philosophie der Orientierung“ ist sein gegenwärtiger Arbeitsschwerpunkt. Weitere Informationen zu ihm und seinem Werk finden Sie auch auf seiner persönlichen Internetseite: https://stegmaier-orientierung.com/
Bibliographie
Derrida, Jacques: Gesetzeskraft. Der „mystische Grund der Autorität“. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1991.
Heidegger, Martin: Anmerkungen I-IV (Schwarze Hefte 1942-1948). Gesamtausgabe Bd. 97. Frankfurt a. M. (Klostermann) 2015.
Ders.: Beiträge (Vom Ereignis). Gesamtausgabe Bd. 65. Frankfurt a. M. (Klostermann) 1989.
Ders.: Sein und Zeit. Tübingen (Max Niemeyer) 1986.
Kaiser, Katharina U.: Gespräch mit Hölderlin I. In: Dieter Thomä (Hg.): Heidegger-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. 2., überarb. & erw. Aufl. Stuttgart & Weimar (Metzler) 2023, S. 184-188.
Marafioti, Rosa Maria: Heideggers „Schwarze Hefte“. Das Seynsdenken und unsere Geschichte. Freiburg & München (Alber) 2024.
Müller, Enrico: Das Pathos Zarathustras. In: Gabriella Pelloni & Isolde Schiffermüller (Hg.): Pathos, Parodie, Kryptomnesie. Das Gedächtnis der Literatur in Nietzsches Also sprach Zarathustra. Heidelberg (Winter) 2015, S. 11-31.
Rauschelbach, Uwe: Die singende Seele. Denken und Schreiben „durch“ Musik bei Nietzsche. In: Nietzscheforschung 29 (2022), S. 85-118.
Sommer, Andreas Urs: Kommentar zu Jenseits von Gut und Böse. Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich Nietzsches Werken, hg v. der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Band 5/1, Berlin & Boston (Walter de Gruyter) 2016.
Stegmaier, Werner: Aspekte der Rezeption und Wirkung [Nietzsches]: Philosophie. In: Nietzsche-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. 2., völlig neu bearbeitete Auflage, hg. v. Robert Krause, Andreas Urs Sommer u. a. Stuttgart & Weimar (Metzler) (im Erscheinen).
Ders.: Die „Magie des Extrems“ in philosophischen Neuorientierungen. Nietzsches neue extreme Problemstellungen und -lösungen und das alte Beispiel des Sokrates. In: Nietzsche-Studien 50 (2021), S. 1-25.
Ders.: Friedrich Nietzsche zur Einführung. 4., erneuerte Aufl. Hamburg (Junius) 2024.
Ders.: Formen philosophischer Schriften zur Einführung. Hamburg (Junius) 2021.
Ders.: Nietzsche an der Arbeit. Das Gewicht seiner nachgelassenen Aufzeichnungen für sein Philosophieren. Berlin & Boston (De Gruyter) 2022.
Ders.: Nihilismus und andere Anfänge. Wege zu einer neuen Orientierung. In: Holger Zaborowski (Hg.): Heidegger und die Frage nach dem Nihilismus, in: Jahrbuch der Heidegger-Gesellschaft (im Erscheinen).
Ders.: Philosophie der Orientierung. Berlin & New York (de Gruyter) 2008.
Ders.: Sein zum Tode – Leben mit dem Tod. Ein Holzweg Heideggers. In: Eike Brock, Günter Gödde, Dennis Sölch & Jörg Zirfas (Hg.): Heidegger und die Lebenskunst. Berlin (Springer/Metzler) 2025, S. 143-160.
Ders.: Was spricht die tiefe Mitternacht? Erläuterungen zu Nietzsches Gedicht „Oh Mensch! Gieb Acht!“. Reihe Nietzsche lesen, hg. v. Timon Georg Böhm, Heft 2, Stiftung Nietzsche Haus in Sils-Maria 2017.
Ders.: Wie ein Gott philosophieren? Nietzsches Anmessung an Dionysos als Gott seiner philosophischen Orientierung. Zum Aphorismus Nr. 295 aus Jenseits von Gut und Böse. In: Jan Kerkmann (Hg.): Religionsphilosophie nach Nietzsche. Der Verlust der Wahrheit und die Suche nach Gott. Reihe Neue Horizonte der Religionsphilosophie, hg. v. Michael Kühnlein, Stuttgart (Metzler) (im Erscheinen).
Ders.: Wittgensteins Orientierung. Techniken der Vergewisserung, Frankfurt a. M. (Klostermann) 2025.
Wittgenstein, Ludwig: Bemerkungen über die Farben. In: Werkausgabe Bd. 8. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984.
Ders.: Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik. Werkausgabe Bd. 6. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984.
Ders.: Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie. In: Werkausgabe Bd. 7. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984.
Ders.: Philosophische Untersuchungen. In: Werkausgabe Bd. 1. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 2006.
Ders.: Über Gewißheit. In: Werkausgabe Bd. 8. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984.
Ders.: Vermischte Bemerkungen. In: Werkausgabe Bd. 8. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984.
Zittel, Claus: Der Dialog als philosophische Form bei Nietzsche. In: Nietzsche-Studien 45 (2016), S. 81-112.
Fußnoten
1: Götzen-Dämmerung, Das Problem des Sokrates, 7.
3: Nachlass 1887, 9[35] / KGW IX 6, W II 1, 115. Anm. d. Red.: Werner Stegmaier zitiert hier und auch im Folgenden Nietzsches späten Nachlass gemäß der IX. Abteilung der von Giorgio Colli und Mazzino Montinari begonnenen Kritischen Gesamtausgabe. In dieser wurde in jahrelanger Detailarbeit der handschriftliche Nachlass von 1885 bis 1889 noch einmal neu gesichtet und versucht, ihn möglichst genau so zu publizieren, wie ihn Nietzsche wirklich aufs Papier brachte, unter größtmöglichem Verzicht auf alle editorischen Eingriffe. Erst 2022 wurde mit dem Erscheinen des letzten Bandes dieser Abteilung das Werk Collis und Montinaris (vorerst) abgeschlossen.
4: Zur Genealogie der Moral, III, 24.
5: Götzen-Dämmerung, Sprüche und Pfeile, 26.
6: Vgl. Stegmaier, Nietzsche an der Arbeit, S. 223-234.
7: Vgl. Stegmaier, Aspekte der Rezeption und Wirkung [Nietzsches]: Philosophie.
8: Vgl. Stegmaier, Sein zum Tode – Leben mit dem Tod und ders.: Nihilismus und andere Anfänge.
9: Bei Heidegger halte ich mich an seine Schwarzen Hefte, in denen, wie in Nietzsches Nachlass, sichtbar wird, wie er sein Philosophieren Schritt für Schritt vorantreibt oder von ihm vorangetrieben wird. Bei Wittgenstein besteht das ganze Spätwerk weitestgehend aus einzelnen „Bemerkungen“, die er immer neu bearbeitet, zusammenstellt und anreichert, aber nicht veröffentlicht. Auch ihm wird erst schrittweise klar, worauf es mit seinem Philosophieren hinauswill und welche Techniken zum Zug kommen, um sich seiner zu vergewissern. Vgl. dazu Stegmaier, Wittgensteins Orientierung. (Anm. d. Red.: Die Schwarzen Hefte, Heideggers Denktagebücher aus den Jahren 1931 bis 1975, die seit 2014 nach und nach publiziert werden, wurden in der breiten Öffentlichkeit vor allem aufgrund der dort enthaltenen politischen Äußerungen rezipiert, insbesondere einiger antisemitischer Passagen. Diese machen jedoch nur einen Bruchteil der Aufzeichnungen aus.)
10: Vgl. Socrates und die Tragoedie, Vortrag 1.
11: Vgl. Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten, Vortrag 2.
13: Vgl. Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 31.
14: Vgl. Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 101.
15: Nachlass 1887, 10[2] / KGW IX 6, W II 2, 141.
16: Vgl. Menschliches, Allzumenschliches, Bd. 1, Aph. 196.
17: Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, S. 541 (1947).
18: Heidegger, Anmerkungen I-IV (Schwarze Hefte 1942-1948), S. 71, 76-81, 118 & öfter.
19: Vgl. Stegmaier, Die „Magie des Extrems“ in philosophischen Neuorientierungen.
20: Vgl. Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 373: „Es folgt aus den Gesetzen der Rangordnung, dass Gelehrte, insofern sie dem geistigen Mittelstande zugehören, die eigentlichen grossen Probleme und Fragezeichen gar nicht in Sicht bekommen dürfen: zudem reicht ihr Muth und ebenso ihr Blick nicht bis dahin“.
21: Vgl. Ecce homo, Warum ich so weise bin, 6.
22: Vgl. Stegmaier, Philosophie der Orientierung. Anm. d. Red.: Wer mehr über Stegmaiers eigene Philosophie der Orientierung, die er hier exemplarisch zur Anwendung bringt, erfahren möchte, dem empfehlen wir zur Lektüre auch das Interview, das wir mit dem Emeritus der Universität Greifswald vor einigen Monaten führten (Link).
23: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 1.
24: Vgl. ebd.
25: Vgl. Jenseits von Gut und Böse, Aph. 4.
26: Vgl. Jenseits von Gut und Böse, Aph. 27.
27: Vgl. Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 276.
28: Vgl. Sein und Zeit, § 6.
29: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 372.
30: Heidegger, Beiträge (Vom Ereignis), S. 69, 169, 379 & 408.
31: Vgl. Jacques Derrida, Gesetzeskraft. Der „mystische Grund der Autorität“.
32: Die fröhliche Wissenschaft, Vorrede, 2.
33: Vgl. Jenseits von Gut und Böse, Aph. 36.
34: Vgl. Stegmaier, Was spricht die tiefe Mitternacht?
35: Wittgenstein, Philosophie Untersuchungen, Nr. 89.
36: Wittgenstein, Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, I 74, S. 65.
37: Wittgenstein, Philosophie Untersuchungen, Nr. 583; vgl. auch Nr. 594.
38: Ebd., Nr. 308. Vgl. Stegmaier, Wittgensteins Orientierung, S. 45-68.
39: Anm. d. Red.: Die lateinische Formel „genus proximum et differentia specifica“ bezeichnete in der mittelalterlichen Scholastik die von Aristoteles etablierte Grundregel jeder Begriffsdefinition. Sie müsse sich stets aus dem Verweis auf die „nächsthöhere allgemeine Gattung“ und auf einen „besonderen Unterschied“ zusammensetzen. So könnte man etwa Nietzsche als „denjenigen Philosophen (genus), der Also sprach Zarathustra schrieb (differentia)“ definieren oder den Winter als „diejenige Jahreszeit (genus), in welcher es auf der Nordhalbkugel am kältesten ist (differentia)“.
40: Menschliches, Allzumenschliches Bd. 2, Vermischte Meinungen und Sprüche, Aph. 5.
41: Nachlass 1888, 14[25] / KGW IX 8, W II 5, 178.
42: Nachlass 1886, 5[71] (datiert „Lenzer Heide den 10. Juni 1887“) / KGW IX 3, N VII 3, 13-24. Vgl. Stegmaier, Nietzsche an der Arbeit, S. 319-358.
43: Nachlass 1887, 10[94] / KGW IX 6, W II 2, 72.
44: Nachlass 1886, 5[71], 3 / KGW IX 3, N VII 3, 15.
45: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 36.
46: Vgl. Enrico Müller, Das Pathos Zarathustras.
47: Nachlass 1886 5[71], 15 / KGW IX 3, N VII 3, 24.
48: Nachlass 1888, 14[61] / KGW IX 8, W II 5, 152.
49: Wittgenstein, Bemerkungen über die Farben, I 15, S. 16.
50:Vermischte Bemerkungen, S. 557 (1948).
51: Heidegger, Anmerkungen I-IV , S. 64.
52: Ecce homo, Warum ich so weise bin, 7.
53: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 27. Vgl. Stegmaier, Nietzsche an der Arbeit, S. 67-83.
54: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 354.
55: Zur Genealogie der Moral, III, 12.
56: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 345.
57: Zur Genealogie der Moral, II, 12.
58: Vgl. Wittgenstein, Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, I 243–246, S. 385.
59: Vgl. Stegmaier, Friedrich Nietzsche zur Einführung, S. 98-113 und Claus Zittel, Der Dialog als philosophische Form bei Nietzsche.
60: Deren konkrete Feinheiten sind noch immer viel zu wenig erforscht. Auch Uwe Rauschelbach beschränkt sich in seiner kundigen Arbeit Die singende Seele weitgehend auf theoretische Überlegungen.
61: Götzen-Dämmerung, Was ich den Alten verdanke, 1.
62: Menschliches, Allzumenschliches Bd. 2, Der Wanderer und sein Schatten, Aph. 145.
63: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 381.
64: Philosophische Untersuchungen, Vorwort.
65: Wittgenstein, Über Gewißheit, 96-99 (1949-1951), S. 140. Vgl. Stegmaier, Wittgensteins Orientierung, S. 199-205.
66: Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, S. 476 (1931).
67: Für sein zweites Hauptwerk, die erst posthum zu veröffentlichenden Beiträge, wählte Heidegger die Form, die er in der Kompilation Der Wille zur Macht aus Nietzsches Nachlass vorfand, in dem alles zum System zu drängen schien. Vgl. Stegmaier, Formen philosophischer Schriften zur Einführung, S. 225-234.
68: Anm. d. Red.: Über Sokrates’ Denken wissen wir fast nur durch dessen Wiedergabe in den Dialogen seines Schülers Platon, der uns hier aber nicht unbedingt den ‚sokratischen Sokrates‘, sondern seine eigene Interpretation seiner Lehren präsentiert.
69: Anm. d. Red.: Das „HWPh“ wurde von 1971 bis 2007 von Joachim Ritter, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel herausgegeben und im Schwabe Verlag (Basel) publiziert. Die dreizehn Bände gelten als Standardnachschlagewerk der philosophischen Forschung und legen zu den 3.670 wichtigsten Begriffen der abendländischen Philosophiegeschichte deren historische Entwicklung prägnant dar. Es ist auch online verfügbar (Link).
70: Nachlass 1888, 18[6] / KGW IX 12, Mp XVI, 56v.
71: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 306.
73: Stegmaier, Wittgensteins Orientierung, S. 170-179.
74: Heidegger, Anmerkungen I-IV, S. 32.
75: Philosophische Untersuchungen, Nr. 110.
76: Heidegger, Beiträge, S. 403, 405 & 411. Zur Bedeutung Hölderlins für Heideggers Denken vgl. Katharina U. Kaiser, Gespräch mit Hölderlin I, zu seiner Rolle in den „Schwarzen Heften“ Rosa Maria Marafioti, Heideggers „Schwarze Hefte“, S. 150 f. & öfter.
77: Heidegger, Beiträge, S. 405-415.
78: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 295. Vgl. Stegmaier, Wie ein Gott philosophieren? – Unter dem Namen des Dionysos wollte Nietzsche seinem „Versuch einer göttlichen Art, zu philosophiren“ eine eigene Schrift widmen: Nachlass 1885, 34[182] / KSA IX 1, N VII 1, 68.
79: Andreas Urs Sommer (Kommentar zu Jenseits von Gut und Böse, S. 804-807) führt die Stelle aus Platons Symposion (203e-204a) in der von Nietzsche benutzten Übersetzung von Franz Susemihl an, nach der „keiner der Götter philosophirt oder begehrt weise zu werden, denn sie sind es bereits, noch auch wenn sonst Jemand weise ist, philosophirt dieser.“
80: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 56. Anm. d. Red.: Die lateinische Formulierung „circulus vitiosus deus“ bedeutet wörtlich „der fehlerhafte Kreis Gott“ oder auch „der Teufelskreis als Gott“. Der französische Philosoph Pierre Klossowski verwendete sie im Titel seiner wichtigsten Monographie zu Nietzsche, Nietzsche et le Cercle Vicieux (1969; vgl. dazu auch Henry Hollands Artikel „Friede mit dem Islam?“ auf diesem Blog.)
Nietzsches Techniken des Philosophierens
Mit Seitenblicken auf Wittgenstein und Heidegger
Ein fester Bestandteil der jährlichen Jahrestagung der Nietzsche-Gesellschaft ist die „Lectio Nietzscheana Naumburgensis“, bei der ein besonders verdienter Forscher am letzten Tag noch einmal ausführlich über das Thema des Kongresses spricht und einen prägnanten Schlusspunkt setzt. Beim letzten Mal wurde diese besondere Ehre Werner Stegmaier zuteil, dem langjährigen Herausgeber der wichtigen Fachzeitschrift Nietzsche-Studien und Verfasser zahlreicher wegweisender Monographien zur Philosophie Nietzsches. Das Thema der Tagung, die vom 16. bis 19. Oktober stattfand, lautete „Nietzsches Technologien“ (Emma Schunack berichtete).
Dankenswerterweise erlaubte uns Werner Stegmaier, diesen Vortrag in voller Länge zu publizieren. Er widmet sich in ihm dem Thema des Kongresses aus einer unerwarteten Sicht. Es geht hier nicht um das, was man landläufig unter „Technologien“ versteht – Maschinen, Cyborgs oder Automaten –, sondern um Nietzsches denkerische und rhetorische Techniken. Durch welche Methoden gelang es Nietzsche so zu schreiben, dass sein Werk bis heute immer wieder neue Generationen von Leserinnen und Lesern nicht nur überzeugt, sondern auch begeistert? Und was ist von ihnen zu halten? Er vergleicht dabei Nietzsches Techniken mit denen von zwei anderen bedeutenden Denkern der Moderne, Martin Heidegger (1889-1976) und Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Alle drei Philosophen verabschieden sich seines Erachtens von den in der Antike begründeten klassischen Techniken des begrifflichen Philosophierens und erkunden radikal neue, um ein neues Philosophieren im Zeitalter des „Nihilismus“ zu erproben. An die Stelle eines einsinnigen, metaphysischen Verständnisses von Rationalität tritt ein plurales, perspektivisches Denken, das sich notwendig völlig anderer Techniken bedienen muss. Der Artikel schafft einen grundlegend neuen Rahmen für das Verständnis von Nietzsches Denken und seines philosophischen Kontexts.
Vater sein mit Nietzsche
Ein Gespräch zwischen Henry Holland und Paul Stephan
Vater sein mit Nietzsche
Ein Gespräch zwischen Henry Holland und Paul Stephan

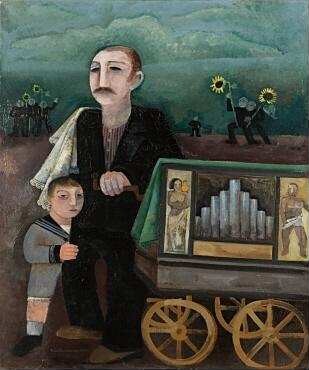
Nietzsche hatte mit großer Gewissheit keine Kinder und äußert sich in seinem Werk auch nicht besonders freundlich zum Thema Vaterschaft. Der freie Geist ist für ihn ein kinderloser Mann, die Erziehung der Kinder die Aufgabe der Frauen. Gleichzeitig dient ihm das Kind immer wieder als Metapher für den befreiten Geist, als Vorahnung des Übermenschen. Vermag er dadurch heutige Väter vielleicht doch zu inspirieren? Und kann man gleichzeitig Vater und Nietzscheaner sein? Henry Holland und Paul Stephan, beide Väter, diskutierten über diese Frage.
Das komplette, ungekürzte Gespräch haben wir parallel auch auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie publiziert (Teil 1, Teil 2).

I. Unsere Vaterschaften
Paul Stephan: Wie kann man mit Nietzsche Vater sein? Hilft die Beschäftigung mit seiner Philosophie dabei, ein besserer Vater zu sein – oder auch nicht? Wir wollen über dieses Thema im Folgenden ganz ergebnisoffen diskutieren. Doch vielleicht sollten wir zunächst klären, was uns, davon abgesehen, dass wir Nietzsche-Forscher sind, überhaupt dazu qualifiziert, darüber zu sprechen. Wir werden nämlich auch von unseren persönlichen Erfahrungen ausgehen, da wir beide auch Väter sind. Henry, du bist derjenige von uns, der sozusagen „mehr Vater“ ist. Wie viele Kinder hast du und was ist der persönliche Hintergrund, von dem aus du auf dieses Thema blickst?
Henry Holland: Ich bin der Vater von vier Kindern, die jetzt zwischen sechs und 23 Jahre alt sind. Das heißt, ich bin zuerst mit 26 Vater geworden. Alle diese vier Kinder stammen von derselben Frau, meiner Frau Rebecca, das kann heutzutage natürlich auch ganz anders sein. Es sind zwei Jungen und zwei Mädchen. Vielleicht ein wenig ungewöhnlich ist auch, dass wir eigentlich schon mit der Lebensphase des Kinderkriegens und der Erziehung von Kleinkindern abgeschlossen hatten, als 2018 Rebecca dann doch noch einmal schwanger wurde und 2019 unser jüngster Sohn Louis zur Welt kam. Dass Rebecca kurz vor ihrem 42. Geburtstag noch einmal Mutter geworden ist, ist heutzutage nicht so ungewöhnlich – zu Nietzsches Zeiten war das ganz anders. Aber es war trotzdem eine sehr schöne Überraschung für uns. – Aber wie steht es mit dir, Paul?
PS: Ich muss vorneweg betonen, dass wir dieses Gespräch am 30. Oktober aufzeichnen und erst kurz vor Weihnachten publizieren werden. Also, es ist so, dass ich einen Sohn habe, Jonathan – er ist jetzt drei, wird aber am 18. November vier werden –, und ich bin im Augenblick sehr aufgeregt und das Thema „Vaterschaft“ beschäftigt mich gerade auch persönlich sehr, weil meine Partnerin Luise im Augenblick schwanger ist mit unserem zweiten Kind. Jetzt ist es noch unterwegs, doch wenn wir das Gespräch veröffentlichen werden, ist es vielleicht schon so weit.1 Was wir jetzt schon wissen: Es wird eine Tochter sein, was mich tatsächlich sehr freut. Ich hätte auch kein Problem damit, der Vater von zwei Söhnen zu sein, das fände ich auch ganz toll, aber ich stelle es mir zumindest so vor, dass es vielleicht nochmal eine andere Erfahrung ist, ein Mädchen aufzuziehen.
HH: Ja, das kann ich gut nachvollziehen und ich habe mich damals sehr gefreut, dass das erste Kind ein Mädchen war. Das hört sich vielleicht wie eine essentialistische Sichtweise an, doch es ja auch aus einer konstruktivistischen Perspektive heraus betrachtet so, dass die Kinder notwendig beeinflusst von bestehenden Geschlechterrollen aufwachsen – das kann man einfach nicht verleugnen, auch wenn man es anders haben will. Ich habe selbst versucht, meinen Töchtern alle Freiheiten, alle Spielräume zur Verfügung zu stellen, die ich auch einem Jungen zur Verfügung gestellt hätte – aber trotzdem fällt mir doch auf in meinem eigenen Milieu: Die eher ‚schwierigen‘ Kinder sind doch mehrheitlich Jungen, diejenigen, die eher auffallen oder sich auflehnen, die sich sozial nicht anpassen möchten, die im Klassenzimmer aufbegehren. Auch wenn sich viele von uns von den bestehenden Geschlechternormen befreien möchten, ist doch davon auszugehen, dass diese Rollen noch ein langes Nachspiel haben und haben werden. Nietzsche formuliert das trefflich in der Fröhlichen Wissenschaft:
Nachdem Buddha todt war, zeigte man noch Jahrhunderte lang seinen Schatten in einer Höhle, – einen ungeheuren schauerlichen Schatten. Gott ist todt: aber so wie die Art der Menschen ist, wird es vielleicht noch Jahrtausende lang Höhlen geben, in denen man seinen Schatten zeigt. – Und wir – wir müssen auch noch seinen Schatten besiegen!2
PS: Daran würde ich gerne anknüpfen, auch wenn uns das etwas von unserem eigentlichen Thema abbringt. Ein wichtiger Aspekt des Vaterseins ist für mich, dass man als Vater plötzlich ganz viele andere Eltern kennenlernt, die Kinder im selben Alter wie das eigene Kind haben. Und dabei kann man wirklich zahlreiche überraschende Beobachtungen und Erkenntnisse machen. Wobei hier natürlich gilt, was du auch schon meintest: Wir können nicht für ‚die Väter an sich‘ sprechen. Wir gehen hier von einem bestimmten Milieu aus, dem wir beide angehören, einem intellektuellen Mittelschichtsmilieu, dem vor allem Kulturschaffende und Akademiker angehören. Und in diesem Milieu wird gerade recht homogen die Auffassung vertreten, dass sehr stark darauf zu achten ist, die Kinder möglichst ‚gendersensibel‘ zu erziehen, d. h. man soll nach Möglichkeit keinen großen Unterschied machen zwischen Töchtern und Söhnen. Auch ich finde diese Entwicklung grundsätzlich sehr gut und habe mir das auch so vorgenommen – aber gerade vor diesem Hintergrund fand ich es doch sehr interessant zu beobachten, dass sich auch sehr kleine Kinder von ein, zwei Jahren, die also noch sehr ‚unerzogen‘, ungeprägt sind und auch von Eltern erzogen werden, die sehr darauf achten, nicht irgendwelchen Stereotypen zu folgen, sich oftmals sehr stereotyp verhalten. Nur ein Beispiel: Als mein Sohn ganz klein war, so ungefähr 1½, bin ich mit ihm einmal pro Woche zu einer musikalischen Früherziehung gefahren. Das war sehr schön. Es war eine Gruppe von etwa sechs, sieben Kindern, Jungen und Mädchen. Da war es wirklich ganz eindeutig so, dass es immer die Jungen waren, die im Zimmer herumgestreunt sind, die versucht haben, nach außen zu gehen und den Raum zu entdecken, die eher laut waren und aus Erwachsenensicht ‚Unsinn‘ gemacht oder auch mal gestört haben, die also wild waren, während die Mädchen fast immer bei ihrem Elternteil gesessen sind und eher ‚zu still‘ waren im Gegensatz dazu, unsicher und schüchtern.
Ich könnte jetzt viele solcher Beispiele anführen. Und natürlich kenne ich auch kleine Mädchen in meinem Bekanntenkreis, die sehr ‚wild‘ sind. Aber meine durchschnittliche Beobachtung ist wirklich, dass man schon in einem bemerkenswert frühen Stadium diese ganzen klischeehaften Unterschiede bemerken kann – und das eben auch bei Kindern, deren Eltern sehr ‚gendersensibel‘ sind. Diese Erfahrung hat mich zu dem Schluss geführt, dass es vielleicht doch einen größeren Einfluss der Biologie, der Gene, gibt, als man oftmals meint und behauptet. Klar, das ist schwer abzugrenzen von der Rolle der unbewussten Prägung, von der du sprachst. Man wird das nie eindeutig voneinander abgrenzen können und ich möchte hier auch gar nicht die Grundsatzdiskussion ‚Natur vs. Kultur‘ aufmachen – aber mich haben die erwähnten Erfahrungen eben doch zu einer etwas differenzierten Auffassung gebracht.
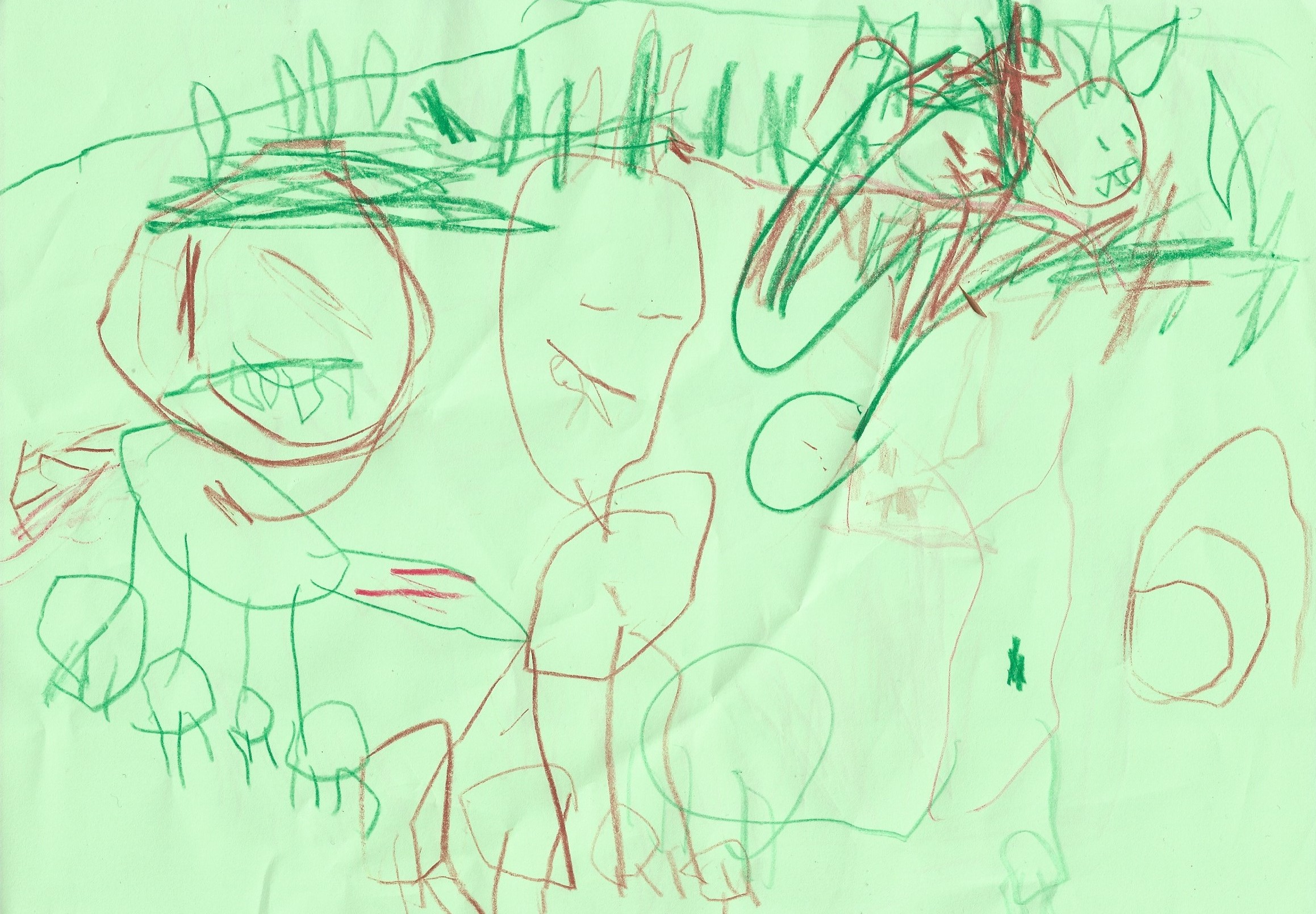
II. Nietzsches problematisches Verständnis von Mann und „Weib“
HH: Vielleicht ist das ein guter Anlass, um auf Nietzsche zu sprechen zu kommen und die bestimmt schlechteste Seite von Nietzsche in Bezug auf das Thema Elternschaft, Mutterschaft, Vaterschaft. Wir könnten uns vielleicht von seinen schlechtesten ausgehend zu seinen geistreicheren und interessanteren Aussagen vorarbeiten. Es muss eben doch betont werden, dass Nietzsche an einigen Stellen mit biologistischen Statements auf den Tisch haut, wenn er etwa schreibt: „Alles am Weibe ist ein Räthsel, und Alles am Weibe hat Eine Lösung: sie heisst Schwangerschaft“3. Dieser Satz gehört wirklich zu Nietzsches zehn schlimmsten Aussagen. Da wirkt es – vor allem, wenn man diese Sätze isoliert betrachtet, was man nicht machen sollte – ja wirklich so, als ob die Frauen für Nietzsche nur dazu da sind, schwanger zu werden und durch diese biologische Fortpflanzung dem Allgemeinwohl zu dienen. Und die Frauen, die das nicht machen, sollen einfach ihren Mund halten.4 Also, es ist schon eine sehr frauenfeindliche Aussage. Wie gehst du, in Bezug auf das Thema Elternschaft, mit dieser ja doch sehr biologistischen Seite von Nietzsche um?
PS: Ja, ich sehe diese Seite genauso wie du. Sie zeigt einmal mehr die große Differenz, die uns von Nietzsche trennt. Und es gibt zig Stellen, wo er dementsprechend immer wieder die klare Ansicht äußert, dass Frauen für die Kindererziehung und das Kinderkriegen vor allem zuständig sein sollen, Männer hingegen sollen, wie es auch in der von dir zitierten Passage des Zarathustra heißt, „Krieger“ sein und sich um den Haushalt und die Kinder nicht sorgen. In einem Satz: „So will ich Mann und Weib: kriegstüchtig den Einen, gebärtüchtig das Andre“5. Und das führt uns vielleicht zum eigentlichen Hauptpunkt dieses Gesprächs: Ist es nicht eigentlich ein Widerspruch, in irgendeiner Hinsicht Nietzscheaner und Vater zu sein? Hat Nietzsche uns Vätern im 21. Jahrhundert, die wir uns sehr anders verstehen, überhaupt noch etwas zu sagen? Ich glaube, das gilt für uns beide und für die meisten Angehörigen unseres Milieus, dass wir eben ein ganz anderes Verständnis von Vaterschaft haben, wie es im späten 19. Jahrhundert so wahrscheinlich noch niemand vertreten hat: Dass man sich eben wirklich die Aufgaben der Fürsorgearbeit mehr oder weniger mit der Mutter teilt, auch wenn es um die ganz kleinen Kinder geht. Das sind ja Sachen, die vielleicht sogar noch vor 30 oder 40 Jahren noch vollkommen undenkbar gewesen wären, die vielleicht in anderen Milieus auch bis heute noch gar nicht so verbreitet sind, die aber in unserem Milieu schon sehr selbstverständlich geworden sind. Wenn Nietzsche diese Entwicklung mitbekommen könnte, würde er wohl, gelinde gesagt, die Hände über den Kopf schlagen und den endgültigen „Untergang des Abendlands“ diagnostizieren, die völlige „Verweiblichung“ und „Verweichlichung“6 der Männer, den finalen Triumph der ressentimentgetriebenen „allgemeinen Verhässlichung Europa’s“7. Siehst du das ähnlich, Henry?
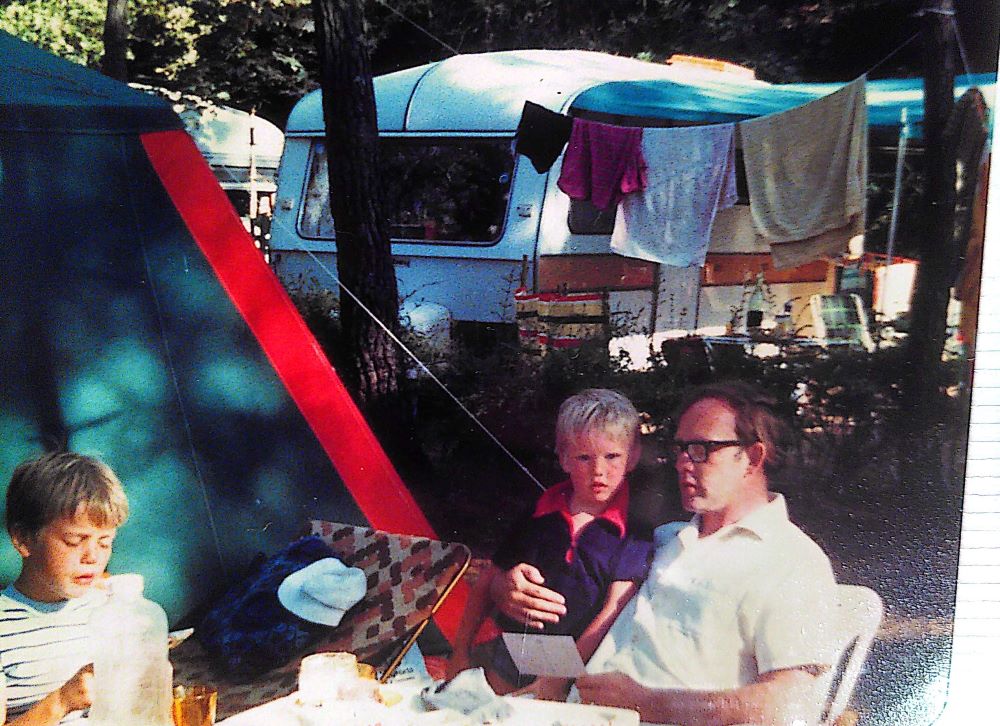
III. Vaterschaft und Authentizität
HH: Mir scheint es so zu sein, dass wir das doch machen können, dass wir Nietzscheanerinnen und Nietzscheaner sein können und doch zugleich progressive Eltern im 21. Jahrhundert. Ich würde in dieser Hinsicht tatsächlich wieder – es kommt einfach immer wieder hoch – auf den Authentizitätsbegriff zurückkommen. Du kennst dich damit viel besser aus als ich, schließlich hast du zu diesem Thema gerade erst eine ganze Doktorarbeit geschrieben und abgegeben. Authentizität ist ein ganz zentrales Konzept für Nietzsche und ich meine, dass das, was die Kinder vor allem bei uns Eltern suchen, sowohl bei den Vätern als auch bei den Müttern, eben Authentizität ist. Bei den Vätern allerdings in etwas anderer Form, denn sie neigen doch eher dazu, abwesend in der Beziehung zu sein und da es seitens des Kindes die Erwartung, dass dieser Elternteil authentisch bleibt. Und das heißt: Nicht nur statisch ist, sondern nach Authentizität strebt, durchaus im Sinne von Nietzsches Idee der Selbstwerdung als kreativer, unabschließbarer Prozess der Selbstschöpfung.
Ich versuche das mal anhand meiner ältesten Tochter, Alma, konkret zu machen. Also sie teilt mit mir ganz klar meine linkspolitischen Ansichten, die erwartet schon auf jeden Fall, vielleicht sogar als Grundbedingung, dass ich mich nicht geschlechtsdiskriminierend oder sonst wie diskriminierend äußere – und das bin ich auch eigentlich nicht, das tue ich nicht. Aber das ist nicht ihre Haupterwartung an mich, dass ich mich, etwas platt ausgedrückt, immer ‚politisch korrekt‘ ausdrücke, sondern dass ich in meinem Wesen, in meinem Handeln, auch außerhalb der Familie, authentisch bleibe und dass diese Authentizität auf irgendeine Weise abrufbar und auch überprüfbar ist.
Um es vielleicht noch deutlicher zu machen und um die Brücke zu meinem eigenen Vater zu schlagen, der noch am Leben ist: Der ist noch in der Endphase des britischen Imperialismus aufgewachsen, als noch ganz andere Werte galten. Da war einer der Hauptwerte diese Vorstellung von „Dienst“. Man steht, man lebt das Leben im Dienst der anderen – dafür ist man da. Also man ist da als Familienvater, um das Geld zu verdienen, indem man im äußeren Leben einen ordentlichen Beruf ausübt. Das „Selbst“ kommt dabei gar nicht so sehr ins Gespräch. Also es gibt eine bestimmte Schicht von britischen Männern, da wäre das allerletzte, worüber die sich unterhalten würden das eigene Selbst. Darüber spricht man quasi nicht, da geht es doch eher um dieses Dienstprinzip. Da habe ich mich als junger Mann und als junger Vater oft gefragt: Was ist eigentlich das authentische Selbst von meinem Vater hinter dieser Existenz im Dienst der anderen? Was ist sein authentischer Kern? Und da blieb mir oft nichts als ein Fragezeichen, das ist schon bemerkenswert.
PS: Ja, das ist sehr interessant und da haben wir anscheinend eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht. Wir kamen ja auch schon im Vorgespräch kurz darauf zu sprechen, dass es heutzutage sehr schwierig geworden ist, ein authentisches Verständnis der eigenen Vaterschaft zu gewinnen, weil die vorhandenen Rollenbilder, an denen man sich in seinem eigenen Selbstentwurf orientieren und abarbeiten könnte, sehr fluide geworden sind. Früher war es sehr klar: Der Vater ist der, der das Geld verdient. Da gibt’s ja zum Beispiel diese Fernsehserie Breaking Bad, wo das mehrmals vorkommt: „A man provides“, „ein Mann versorgt“, selbst wenn ihn diejenigen, die er versorgt, noch nicht einmal respektieren oder lieben. Er kümmert sich gar nicht groß um die Kinder. Wir heute versuchen, ein anderes Verständnis zu entwickeln von einem anwesenden und sich kümmernden, liebevollen Vater.8
Bei meinem Vater war das nun sehr ähnlich wie bei deinem. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mich für das Thema der ‚Authentizität‘ so interessiere. Man muss dazu wissen, dass mein Vater in der DDR groß geworden ist. Da gibt’s ja dieses Schlagwort vom „homo sovieticus“, das der sowjetische Philosoph und Dissident Alexander Sinowjew in den 80ern geprägt hat, um den extrem angepassten Menschentyp zu beschreiben, der in den Staaten der ‚sozialistischen Welt‘ gefordert und gefördert wurde. Quasi als hyperopportunistische Realisierung von Nietzsches Dystopie des „letzten Menschen“, der sich am Ende der Geschichte wähnt; ein Mensch ohne inneres Zentrum, der sich um Authentizität noch nicht einmal bemüht, sondern ganz im Dienst für das Gemeinwesen aufgeht.9 Ich glaube, dieses Konzept lässt sich auch auf die DDR anwenden. Noch stärker als im Westen war die Erziehung in der DDR sehr stark auf das Ideal des „Dienst“ ausgerichtet, ich finde dieses Stichwort sehr gut. Man sollte nicht von sich selbst ausgehen; es gab bestimmte gesellschaftliche Erwartungen und die sollte man erfüllen. Ich habe meinen Vater, der auch noch am Leben ist, auch immer als sehr unauthentischen Menschen wahrgenommen. Er ist nach wie vor ein Rätsel für mich in vielerlei Hinsicht, er ist ein sehr ironischer Mensch, der fast nie über seine Gefühle spricht und darüber, was ihn eigentlich umtreibt. Man hat den Eindruck, dass er eben kein gutes Verhältnis zu sich selbst hat, und das ist mir auch schon als Kind aufgefallen und hat mich auch, meine ich, dahin geführt zu versuchen, ein anderer Mann, ein anderer Vater zu werden. Mein Vater hat mir da insofern eher als negatives Beispiel eigentlich gedient, auch wenn ich ihm nichts vorwerfen will. Gerade, als ich ein kleiner Junge war, war er auch ein sehr guter Vater und hat sich durchaus viel gekümmert. Aber ich habe eben auch schon sehr früh dieses Defizit, diese Distanz zu ihm gespürt.
Und ja, es gibt zwischen diesen Themen ‚Authentizität‘ und ‚Vatersein‘ in der Tat eine enge Verbindung. In meiner Doktorarbeit taucht es jedenfalls oft auf, öfter, als ich es am Anfang meiner Forschungsarbeit für möglich gehalten hätte. Aber das führt uns vielleicht zu einem nochmal etwas anderen Männlichkeitsverständnis. Es gibt eben, wie bereits angedeutet, zum einen dieses Verständnis vom Mann als Diener, der sich für das Gemeinwesen opfert, wie es etwa Hegel artikulierte, aber dann eben auch das Verständnis vom Mann als jemand, der vollkommen stur nur an sich selbst denkt, der seine eigene Selbstverwirklichung über alles stellt. Und das ist eben die Vorstellung von Männlichkeit, die man bei Nietzsche eigentlich findet, und um die sein gesamtes Verständnis von Authentizität kreist – was aus meiner Sicht ein riesiges Problem darstellt. Man betrachte nur die folgende Stelle aus der Genealogie:
Dergestalt perhorreszirt [weist mit Abscheu zurück] der Philosoph die Ehe sammt dem, was zu ihr überreden möchte, – die Ehe als Hinderniss und Verhängniss auf seinem Wege zum Optimum. Welcher grosse Philosoph war bisher verheirathet? Heraklit, Plato, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer – sie waren es nicht; mehr noch, man kann sie sich nicht einmal denken als verheirathet. Ein verheiratheter Philosoph gehört in die Komödie, das ist mein Satz: und jene Ausnahme Sokrates, der boshafte Sokrates hat sich, scheint es, ironice verheirathet, eigens um gerade diesen Satz zu demonstriren. Jeder Philosoph würde sprechen, wie einst Buddha sprach, als ihm die Geburt eines Sohnes gemeldet wurde: „Râhula ist mir geboren, eine Fessel ist mir geschmiedet“ (Râhula bedeutet hier „ein kleiner Dämon“); jedem „freien Geiste“ müsste eine nachdenkliche Stunde kommen, gesetzt, dass er vorher eine gedankenlose gehabt hat, wie sie einst demselben Buddha kam — „eng bedrängt, dachte er bei sich, ist das Leben im Hause, eine Stätte der Unreinheit; Freiheit ist im Verlassen des Hauses“: „dieweil er also dachte, verliess er das Haus“. Es sind im asketischen Ideale so viele Brücken zur Unabhängigkeit angezeigt, dass ein Philosoph nicht ohne ein innerliches Frohlocken und Händeklatschen die Geschichte aller jener Entschlossnen zu hören vermag, welche eines Tages Nein sagten zu aller Unfreiheit und in irgend eine Wüste giengen: gesetzt selbst, dass es bloss starke Esel waren und ganz und gar das Gegenstück eines starken Geistes. Was bedeutet demnach das asketische Ideal bei einem Philosophen? Meine Antwort ist – man wird es längst errathen haben: der Philosoph lächelt bei seinem Anblick einem Optimum der Bedingungen höchster und kühnster Geistigkeit zu, – er verneint nicht damit „das Dasein“, er bejaht darin vielmehr sein Dasein und nur sein Dasein, und dies vielleicht bis zu dem Grade, dass ihm der frevelhafte Wunsch nicht fern bleibt: pereat mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fiam!…10
Es gilt also: Wenn auch die Welt zugrunde ginge, die Philosophie soll leben, der Philosoph soll leben, ich soll leben. Ich denke, in diesem Zitat steckt ganz viel von Nietzsches Freiheits- und Authentizitätsverständnis drin, was eben gar nicht mit der Vaterschaft vereinbar ist. Der Sohn wird hier nur als „kleiner Dämon“ beschrieben – und es gibt viele derartige Stellen, aus denen eindeutig hervorgeht, dass Nietzsche, der ja auch selbst bekanntermaßen kein Vater war, davon auch gar nichts wissen will. Er hält das Vatersein mit der philosophischen, aber auch der authentischen Existenz für vollkommen unvereinbar.

IV. Philosophen als Väter – eine gute Idee?
HH: Ja, das ist eine interessante Passage. Wobei Nietzsches These empirisch gesehen anfechtbar ist. Hegel hatte etwa zwei legitime Söhne und einen weiteren unehelichen,11 Marx hatte sogar sieben Kinder mit seiner Frau Jenny, wovon drei das Erwachsenenalter erreichten.12 – Wobei es strittig ist, ob Marx auch ein guter Vater war.
PS: Ich würde Nietzsche da ein Stück weit in Schutz nehmen wollen. Es ist schon auffällig, dass es so viele Philosophen gibt, die kinderlos geblieben sind, teilweise als Junggesellen gelebt haben, teilweise vielleicht ein Kind hatten.13 Also du mit deinen vier Kindern bist da auf jeden Fall schon auffällig, würde ich sagen. Heutzutage noch mehr. Aber im 18./19. Jahrhundert war es ja eher die Regel, dass man fünf oder sechs Kinder hatte, sehr große Familien – und da waren die Philosophen dann doch meistens eher eine Ausnahme. Dass dem so ist, hat natürlich auch wieder mit dem Bild zu tun, dass der Mann der Versorger der Familie sein soll und klar – wie auch heute noch, aber damals war’s eben auch nicht sehr anders –, dieser Pflicht nachzukommen fällt Philosophen oft sehr schwer.
HH: Wobei ich mich gar nicht als Philosophen bezeichnen würde, sondern als jemanden, der sich für Philosophie interessiert und damit arbeitet! – Meine Antwort jedenfalls auf diese Nietzsche-Passage wäre, um es etwas ökonomischer und neutraler anzugehen, dass er, wenn er in einem bürgerlichen Haushalt mit Ehe und Kindern gelebt hätte, so einfach nicht hätte schreiben können. Sein Schreibstil, der Schreibprozess, seine Texte wären anders geworden. Diese Arbeitsweise, die von sehr kurzen Perioden der nächte- und tagelangen Produktivität geprägt war und dann langen Phasen, in denen Nietzsche so stark unter seinen Krankheitssymptomen litt, dass er rein gar nichts zu Papier bringen konnte – diese ‚Ökologie‘ könnte ein Vater in einem halbwegs ‚normalen‘ Umfeld unmöglich so durchziehen. Den umgekehrten Fall hat man etwa bei den Familienvätern Hegel und Marx, deren Hauptwerke viel langsamer zustande kamen und entsprechend auch viel gesättigter sind, eine ganz andere Form und Stringenz aufweisen.
Bezogen auf Nietzsches Behauptung, dass so viele große Philosophen unverheiratet geblieben sind, möchte ich einfach die klassische marxistische Frage stellen: Wer hat dann die Reproduktionsarbeit gemacht? Also nicht nur im Sinne von dem Kinderkriegen und der Erziehung, sondern auch: Wer hat das Mittagessen gekocht? Wer hat geputzt? Wer hat die Wäsche gewaschen? Und die Antwort auf diese Frage, auch im Falle Nietzsches, wird niemanden überraschen: Es waren zu 95 % Frauen, meist ungenannte. Ich denke etwa an Alwine Freytag, die langjährige Dienerin im Haushalt der Mutter, die dabei half, Nietzsche in seinen letzten Jahren zu pflegen – wer kennt die schon? Es gibt immer mehrere Menschen, die diese ganze reproduktive Arbeit im Hintergrund erledigt haben, so dass der „große Philosoph“ seine Werke schreiben konnte.
Das ist für manche vielleicht selbstverständlich, doch geht es in der Philosophiegeschichtsschreibung oftmals doch verloren. Und darin liegt, glaube ich, auch begründet, warum wir solche Werke wie diejenigen Nietzsches vielleicht nicht mehr sehen werden. Es gibt einfach keine Frau und keinen Mann, niemanden, der sich so eine Lebensführung noch leisten könnte – das meine ich nicht rein ökonomisch, sondern von der Haltung her, wofür man sich selbst verantwortlich fühlt und wofür nicht.
PS: Ja, Nietzsche war viele Jahre lang auf die Pflege von Frauen vollkommen angewiesen, als Kind sowieso und dann, als er geistig umnachtet war, wieder. Kürzlich habe ich erst bei der letzten Jahrestagung der Nietzsche-Gesellschaft14 einen sehr interessanten wie auch unterhaltsamen Vortrag gehört über den, gescheiterten, Plan Nietzsches, sich einen tragbaren Ofen zu kaufen, gehalten von Ralf Eichberg. In dem wurde anhand des Briefwechsels zwischen seiner Mutter und ihm sehr deutlich, dass es allerdings auch ein Problem für den Rentier Nietzsche war, dass er sich Dienstboten nicht so richtig leisten konnte, aber zur gleichen Zeit auch einfach nicht kochen konnte – sehr zur Besorgnis seiner Mutter. So privilegiert war seine Position also nicht – aber prinzipiell gebe ich dir natürlich Recht. Das gilt ja ganz allgemein, dass die philosophische Arbeit seit Jahrhunderten zu einem großen Teil auf der Arbeit von Frauen im Hintergrund beruht, sei es als Dienstbotinnen, aber auch als Sekretärinnen oder sogar ungenannte Co-Autorinnen.
Wenn es nun um die heutige Philosophie geht, ist das natürlich die Frage: Ist ein Fortschritt oder vielleicht auch ein Rückschritt? Ja, Nietzsches extravaganter Schreibstil hat etwa mit der fast schon stereotypen Männlichkeit zu tun, die er in seinen Werken nicht nur propagiert, sondern die dieser Stil auch selbst performiert. Nur ist es eben eine unreife, puerile Männlichkeit. In der Rede Von alten und jungen Weiblein, die wie bereits zitierten, geht ja eigentlich hervor, dass die Frauen nicht nur Kinder bekommen und erziehen sollen, ihre Aufgabe ist umfassender:
Der Mann soll zum Kriege erzogen werden und das Weib zur Erholung des Kriegers: alles Andre ist Thorheit.
Allzusüsse Früchte – die mag der Krieger nicht. Darum mag er das Weib; bitter ist auch noch das süsseste Weib.
Besser als ein Mann versteht das Weib die Kinder, aber der Mann ist kindlicher als das Weib.
Im ächten Manne ist ein Kind versteckt: das will spielen. Auf, ihr Frauen, so entdeckt mir doch das Kind im Manne!
Ein Spielzeug sei das Weib[.]
Also in Nietzsches Vorstellung bleibt der Mann zeitlebens ein Kind, soll auch gar nicht erwachsen werden. Und klar: Diese Kindlichkeit, diese Unreife, die man sich bewahrt, kann, wie im Falle Nietzsches und in vielen anderen Fällen auch, ein großes kreatives Potenzial freisetzen. Aber ich meine schon, dass es der Philosophie auch nicht schlecht tut, von einer etwas reiferen und verantwortungsvolleren Haltung auszugehen, wie man sie als Vater ja automatisch an den Tag legen und entwickeln muss. Das würde ich auch für mein eigenes Denken, für meine eigene philosophische, intellektuelle Arbeit so sagen. Also es ist natürlich ein Verlust, Vater zu werden, nicht nur ein Zeitverlust, quantitativ gesehen, sondern auch qualitativ gesehen ein Konzentrationsverlust. Man kann eben nicht mehr nächtelang durchschreiben, wenn man jeden Morgen vom Kind geweckt wird oder es in die Kita bringen muss. Man wird mehr und mehr in eine verantwortungsvolle und auch sorgende Position gedrängt, die dem Denken jedoch nicht unbedingt hinderlich ist, sondern eher zu einer Vertiefung des Denkens führt, mit der insbesondere einhergeht, weniger stark von sich selbst her zu denken, sondern sich wirklich auf diese Beziehung zum anderen Wesen einzulassen – und ich sehe das eigentlich sowohl für mich als Person als auch für mich als Intellektuellen eher als große Bereicherung und als Gewinn des Vaterseins. Es stimmt einfach nicht, wie Nietzsche mantrahaftig verficht, dass eine „große Kultur“ notwendig nur so beschaffen sein kann, dass sich eine kleine Kaste von „Herren“ unbesorgt um die kleinen Dinge des Lebens auf dem Rücken von Millionen „Sklaven“ und vor allem eben „Sklavinnen“ auslebt – dies führt zu einer kastrierten Kultur, dies führt genau zu jener Dekadenz und Lebensfremde, vor der Nietzsche so wortreich warnt; und genau weiß, dass er das selbst ist: Ein typischer décadent, das tragikomische Ergebnis eines letzten Aufblühens einer schon zu seiner Zeit im Untergang befindlichen Kultur, die auf Ausbeutung und Abtrennung basierte. Der Ausweg aus der kulturellen Dekadenz kann nur in einer nichtdekadenten Lebensführung liegen – hinein in die Produktion und eben auch die Reproduktion; Überwindung der Trennung von Kopf- und Handarbeit – doch Nietzsche vermochte eine solche Option allenfalls zu erahnen, wenn er neidisch auf die „gebärende“ Fähigkeit der Frau blickt und sie zur Metapher authentischer kreativer Schöpfung erhöht. Als fürsorgender Vater hätte er daran auch auf einer ganz nichtmetaphorischen Ebene teilhaben können. – Wobei ich das nicht als moralische Kritik verstanden wissen möchte, schließlich wäre Nietzsche ein anderes Leben angesichts seiner Krankheit ja kaum möglich gewesen.

V. Nietzsches persönliche Erfahrungen
HH: Ja, dieses Stichwort vom ‚Denken über die Beziehungen zu anderen Menschen‘ möchte ich gerne aufgreifen. Wobei ich mich schwer tue, Nietzsches Stil und Haltung als ‚unreif‘ zu bezeichnen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, denn wenn man dieses ‚Halbgare‘ und ‚Unreife‘ nicht hätte, wäre es wiederum nicht Nietzsche, sein Werk hätte nicht dieses Authentische, was es so einzigartig macht. Es ist eben wirklich Nietzsches Werk.
Aber zurück zum Denken in und über Beziehungen. Dieses tiefere Denken in und über Beziehungen zu anderen Menschen oder über die Gesellschaft, über politische Formen – da würde ich zum Beispiel schon sagen, dass da Hegel mehr zu sagen hat als Nietzsche, wenn es etwa um das Verhältnis zwischen dem Individuum und dem Staat geht, was, wie ich glaube, ein wichtiges philosophisches Thema bleibt. Nietzsche ist an einem genuinen Gesellschaftsdenken gar nicht interessiert, das ist nicht sein Thema.
Wie du ja schon angedeutet hast: Nietzsche hat eben, ganz im Sinne seiner Lehre vom amor fati, aus der Not eine Tugend gemacht. Nietzsche hatte es sehr schwer in menschlichen Beziehungen. Er pflegte kaum solche, die man überhaupt in irgendeinem Sinne als ‚normal‘ bezeichnen könnte, erst recht nicht, wenn sie irgendeine sexuelle Komponente hatten. Das zeigt vielleicht am deutlichsten seine kurze Freundschaft mit Lou Salomé. Ihm ging vielleicht einfach die Fähigkeit dazu ab, langanhaltende Beziehungen zu führen, vor allem romantische und erst recht erotische – und ihm gelingt es, aus diesem Zufall eine ganze Philosophie zu schaffen. Diese Umwertung von philosophischen Zufällen zu Philosophenem scheint mir ein allgemeines Charakteristikum von Nietzsches Werk zu sein. Warum auch nicht? Aber das wirft natürlich die Frage auf, was andere Menschen daraus machen können.
Vielleicht sollten wir vor diesem Hintergrund auch auf Nietzsches eigenes Verhältnis zu seinem Vater zu sprechen kommen. Das scheint mir für unser Thema ganz zentral zu sein. Dieser starb ja, als Nietzsche fünf Jahre alt war, also wirklich sehr früh. Diese Beziehung war aber durchaus intensiv. Der kleine Nietzsche war der einzige, dem es erlaubt war, sich im Arbeitszimmer seines Vaters aufzuhalten, während dieser, ein evangelischer Pastor, seine Predigten geschrieben und sich um die schriftliche Gemeindearbeit gekümmert hat. Vielleicht, weil er im Gegensatz zu vielen anderen Kleinkindern sehr ruhig gewesen ist, nicht so arg gestört hat. Wobei das ja auch auffällig ist. Es gibt wenige Anzeichen dafür, dass der kleine Nietzsche viel mit anderen Kleinkindern gespielt und sich ausgetobt hat. Heutzutage hätte ihn sein Vater vielleicht eher zum Therapeuten mitgenommen – und der frühe Tod des geliebten Vaters hat diese ungewöhnliche Veranlagung beim kleinen „Friedrich“ sicher noch verstärkt.
Es gibt da ein für unser Thema sehr einschlägiges Zitat, das vom Verlassenwerden durch den eigenen Vater handelt, von dessen Abwesenheit und davon, wie sehr diese Erfahrung den frühen Nietzsche prägte. Es handelt sich um eine Kindheitserinnerung von Nietzsche, die er kurz vor seinem 14. Geburtstag niederschrieb, in einer der bemerkenswert zahlreichen autobiographischen Schriften aus seiner Jugendzeit. Es geht darin um die Zeit nach dem Tod seines Vaters und den kurz darauf folgenden Tod seines kleinen Bruders Ludwig Joseph:
In der damaligen Zeit träumte mir einst, ich hörte in der Kirche Orgelton wie beim Begräbnis. Da ich sah, was die Ursache wäre, erhob sich plötzlich ein Grab und mein Vater im Sterbekleid entsteigt demselben. Er eilt in die Kirche und kommt in kurzem mit einem kleinen Kinde im Arm wieder. Der Grabhügel öffnet sich, er steigt hinein und die Decke sinkt wieder auf die Öffnung. Sogleich schweigt der rauschende Orgelschall und ich erwache. – Den Tag nach dieser Nacht wird plötzlich Josephchen unwohl, bekommt die Krämpfe und stirbt in wenig Stunden. Unser Schmerz war ungeheuer. Mein Traum war vollständig in Erfüllung gegangen. Die kleine Leiche wurde auch noch in die Arme des Vaters gelegt.15
Klar, man kann nicht wissen, ob das eine echte Erinnerung ist und wie viel Nietzsche da schon als Jugendlicher poetisch hinzugedichtet hat angesichts seiner lyrischen Neigung. Aber trotzdem ist eine Erinnerung, in der es darum geht, verlassen worden zu sein und um Abschied – und sie wirft bei mir die Frage auf, wie sehr das Nietzsche auf eine Philosophie gebracht hat, die sich sehr um den „starken Einzelnen“ dreht, in der es zur Tugend gemacht wird, dass man sich abkapselt, dass man sich nicht auf den anderen verlassen sollte, dass man als Mann nicht heiraten und eben keine Kinder bekommen sollte. Und da scheint mir ein diametraler Gegensatz zu unserem Verständnis von Vaterschaft bestehen, in dem es vor allem darum geht, für das Kind da zu sein, für Gespräche da zu sein, aktiv mit dem Kind zu spielen, also die Gestaltung einer aktiven Beziehung zum Kind.
PS: Ja, die Abwesenheit des Vaters wird ja in so gut wie allen biographischen Texten zu Nietzsche als wesentlicher Faktor seiner persönlichen Entwicklung angegeben und ich bin auch ganz einverstanden damit. Vielleicht gibt es in der Tat auch, natürlich unbewusst, verdrängt, viel Enttäuschung und Wut, mit Nietzsche selbst gesprochen: Ressentiment, gegenüber dem Vater. Denn als Kind erlebt man ein solches Ereignis womöglich gar nicht so sehr als Schicksalsschlag, sondern so, als hätte einen das verstorbene Elternteil bewusst im Stich gelassen. Mit dieser Erfahrung hat man das ganze Leben lang zu kämpfen. Und auch im Falle Nietzsches mag das ein entscheidender Grund sein, warum er ja, man muss es so deutlich sagen, wirklich generell scheitert in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Also was ich an dieser Stelle auch ganz klar betonen möchte: Ich bin natürlich nicht der Auffassung, dass man unbedingt Vater werden muss, um als Mann in ein fürsorgliches, verantwortungsvolles Verhältnis zu anderen zu treten, es gibt da natürlich viele andere Formen, das zu realisieren. Die Vaterschaft ist eine davon, eine romantische Zweierbeziehung natürlich auch, es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Aber man kann bei Nietzsche ja durchaus davon sprechen, dass er in dieser Hinsicht ganz generell versagt hat. Also es gibt kein Beispiel fast in seinem Leben für eine wirklich gelungene zwischenmenschliche Beziehung über einen längeren Zeitraum auf Augenhöhe – was natürlich absolut traurig ist, aber auch ein gewisses Licht auf sein Denken werfen sollte.
Und dann gibt es auch noch diese etwas komische Geschichte mit Lou Salomé. Da liegt es ja nahe, Nietzsche zu kontern: Er sagt, der verheiratete Philosoph gehöre in die Komödie – aber noch viel mehr gehört ja dorthin vielleicht der Philosoph, der eine größere Anzahl von gescheiterten Heiratsanträgen hinter sich hat. Also er wollte es jedenfalls zeitweilig durchaus. Wobei man hier auch sehen muss, dass aus Briefen immer wieder hervorgeht, dass er sich vor allem auch aus pragmatischen Gründen verheiraten wollte, um materiell besser versorgt zu sein – oder auch, um quasi eine ‚kostenlose Pflegerin‘ oder Assistentin zu haben. Wobei das im Falle Lou Salomés sicherlich noch etwas Anderes ist, die sah er durchaus auch als Austauschpartnerin auf Augenhöhe und wahrscheinlich auch als romantisch-erotisches Objekt der Begierde in irgendeiner Form – wobei ich jetzt das Thema von Nietzsches genauer sexueller Orientierung gar nicht aufmachen will, zumal es auf unserem Blog ohnehin schon ausgiebig thematisiert wurde.16 Aber der Pragmatismus, bisweilen geradezu Zynismus, in Sachen Ehe, den er in seinen Briefen bisweilen durchscheinen lässt, spricht jedenfalls nicht gerade für ihn.17
Aber, wie immer bei Nietzsche: Auch bei diesem Thema gibt es eine Stelle im Werk, wo er genau das Gegenteil vertritt. Ich habe wenigstens eine einzige gefunden aus seiner mittleren Schaffensphase, eine kurze Notiz aus dem Nachlass von 1881, wo es heißt:
Nachkommen haben – das erst macht den Menschen stätig, zusammenhängend und fähig, Verzicht zu leisten: es ist die beste Erziehung. Die Eltern sind es immer, welche durch die Kinder erzogen werden, und zwar durch die Kinder in jedem Sinne, auch im geistigsten. Unsere Werke und Schüler erst geben dem Schiffe unseres Lebens den Compaß und die große Richtung.18
Sofern ich nichts übersehen habe, hat es diese Stelle eben auch nicht ins veröffentlichte Werk geschafft, aber ich finde sie wirklich großartig. Sie entspricht auch meiner eigenen Haltung viel eher als die fast schon etwas gruselige Passage aus der Genealogie, aus der ich oben zitiert habe. Dass auch die Kinder den „Erzieher erziehen“, dass Erziehung generell als ein Wechselspiel verstanden werden muss, als ein Reifungsprozess, in dem auch die Eltern erst reif werden – das finde ich schon einen sehr klugen Gedanken. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch auf jeden Fall bestätigen, dass das so ist, und ich würde daher schon behaupten, dass es Nietzsche sehr gut getan hätte, diesen weiteren Schritt der Erziehung noch machen zu dürfen. Wie gesagt: Das ist keine moralische Kritik, das war ja eher sein Schicksal und er hat es sicherlich verstanden, aus diesem Schicksal das Beste zu machen und hat sich dann eben ex post eine philosophische Rechtfertigung dafür überlegt. So, wie die meisten Philosophen.
Ich sehe da zwei mögliche Szenarien. Einmal, dass Nietzsche als Vater aufgehört hätte, sich mit philosophischen Themen zu beschäftigen und sich wirklich nur noch ums „Versorgen“ gekümmert hätte – oder, dass er seine Philosophie trotzdem weitergeführt hätte und vielleicht wären sogar noch bessere Bücher dabei herausgekommen, wenn es ihm gelungen wäre, diesen kindlich-narzisstischen Aspekt, den er auf jeden Fall sehr stark hat, und eine etwas verantwortungsvollere Sichtweise auf die Gesellschaft, auf das große Ganze, in die man als Vater ja geradezu hineinerzogen wird, zusammenzuführen. Vielleicht wäre er dann wirklich der größte Philosoph des 19. Jahrhunderts geworden. Es ist möglich, oder?
HH: Ja, es ist möglich und mir gefällt dieses Gedankenspiel sehr. Wobei ich natürlich die zweite Option präferieren würde. Wenn er jemanden gefunden hätte, auf Augenhöhe, wenn ihm das gelungen wäre, wäre bestimmt ein sehr anderes Werk entstanden, vielleicht ein wesentlich reiferes Werk.
Was ich an dieser Stelle noch wichtig finde zu erwähnen: Was waren eigentlich Nietzsches Begegnungen als Erwachsener mit kleinen Kindern? Da gibt es nicht viele, alle nennenswerten Begegnungen fanden im Haushalt der Wagners statt, ab 1869, als Nietzsche gerade seine Professur in Basel angetreten hatte und regelmäßig in den Landsitz der Wagners im naheliegenden Tribschen eingeladen worden war. Cosima war zu diesem Zeitpunkt noch mit ihrem ersten Mann Hans von Bülow verheiratet, aber Richard Wagner und sie waren bereits seit 1864 liiert und lebten seit 1867 zusammen, hatten sogar mit der Gründung einer gemeinsamen Familie begonnen mit zwei Töchtern, Isolde (geb. 1865) und Eva (geb. 1867). Im Mai 1869 besuchte Nietzsche Tribschen zum ersten Mal und schon im Juni kam Siegfried, das dritte gemeinsame Kind des Paares, zur Welt. Und hier wird nun interessant: Die Biographin Sue Prideaux19 stellt es tatsächlich so dar, dass Nietzsche so lebensfern im Alltag gewesen ist, dass er es quasi nicht mitbekommen hat, dass Cosima schwanger war, als er die Wagners im Mai besuchte – was schon ein Kunststück gewesen wäre, eigentlich kann das gar nicht so gewesen sein. Und es sei sogar so gewesen, dass Nietzsche dort war in der Nacht, als Siegfried geboren wurde, und er habe das einfach gar nicht mitbekommen, nicht einmal die Schreie, die damit sicherlich einhergegangen sind. Er habe die Geburt erst realisiert beim Frühstück, als der neue Anwesende nicht mehr zu übersehen war. – Soweit jedenfalls die Version der Ereignisse, wie Prideaux sie erzählt. Und auch wenn das möglicherweise eine Übertreibung ist, spiegelt diese Anekdote doch sehr gut etwas wider von Nietzsches großer Weltfremdheit.
PS: Ja, er war bestimmt nicht die alleremphatischste Persönlichkeit, hat immer etwas in seiner eigenen Welt gelebt, das kann man sich sehr gut vorstellen.
HH: Wobei Cosima und vor allem Richard später zusammen ernsthaft mit dem Gedanken spielten, dass Nietzsche eine Art Erzieherrolle für Siegfried übernehmen sollte. Im Jahr 1872 äußert Wagner in zwei Briefen Nietzsche gegenüber solche Planspiele und geht dabei so weit, angesichts seines fortgeschrittenen Alters Nietzsche als eine Art Ersatzvater für „Fidi“ ins Spiel zu bringen – und entsprechend Nietzsche selbst als Ersatzsohn Wagners.20 Allerdings zeigte Nietzsche daran kein Interesse, denn beide Male ignorierte er das Ansinnen seines „geliebten Meisters“, wie er Wagner in dieser Zeit noch nannte, einfach.21 Also es scheint so, dass Nietzsche seine wiederholten Besuche in Tribschen inmitten eines Haushalts von kleinen tobenden Kindern doch genossen hat, dass er jedoch keinen Weg gefunden hat, diese Erfahrung in seiner eigenen Biographie weiter zu vertiefen.
PS: Ja, ich glaube, eine solche Beziehung zu einem Kind aufzubauen hätte Nietzsche auf jeden Fall gutgetan. Wobei man hier auch sehen muss: Die Wagners hatten Nietzsche gegenüber nicht immer die besten Intentionen. Christian Saehrendt spricht in einem Artikel über die Beziehung Nietzsche/Wagners auf unserem Blog auch von einer „schrecklich netten Familie“, in die der junge Professor sich da begab. Vielleicht ging es Richard Wagner auch bei diesem Plan darum, Nietzsche einfach nur auszunutzen – aber vielleicht hatte er auch gespürt, dass es Nietzsche gefördert hätte, in eine Art Vaterrolle zu schlüpfen.
HH: Ich denke, wir sollten von guten Absichten ausgehen, auch wenn schlechte natürlich nicht auszuschließen sind. Festzuhalten ist jedenfalls, dass es durchaus diese Phase gab, in der Nietzsche als ‚Hausfreund‘ der Wagners regelmäßig Kontakt mit kleinen Kindern hatte – aber dass er diese Gelegenheit nutzte, um eine intensive Beziehung aufzubauen, etwa zu dem jungen Siegfried, ist unwahrscheinlich. Siegfried Wagner wird in Nietzsche wohl kaum irgendeine Art von Vaterfigur wahrgenommen haben; es blieb bei einem Gedankenspiel. – Vielleicht führt es uns an dieser Stelle weiter, darauf einzugehen, was Nietzsche über die Kindheit im Allgemeinen schrieb.

VI. Nietzsches Bejahung der Kindheit
PS: Ja, auf dieses Thema sollten wir unbedingt noch zu sprechen kommen! Es ist ja wirklich bemerkenswert, dass Nietzsche mit realen Kindern so gut wie nie zu tun hatte, aber sicher zu den Denkern zählt, die zum Thema Kindheit und auch Schwangerschaft die schönsten Sachen gesagt haben.
Die Schwangerschaftsmetapher findet sich vor allem in Also sprach Zarathustra. Sie hat natürlich eine frauenfeindliche Komponente in dem Sinne, dass Nietzsche, wie wir es ja schon thematisiert haben, eben von einer strikten Zweiteilung der Geschlechter in dieser Hinsicht ausgeht und beide in einer bestimmten Rolle fixiert. Aber man muss auch sagen, dass Nietzsche das Gebären zugleich extrem aufwertet und als Metapher für die Fähigkeit zu einer kreativen Schöpfung an sich ansieht. Auch Männer können bei ihm in diesem Sinne „gebärende“ sein und Kinder bekommen, auch Zarathustra oder er selbst. Die feministische Interpretin Caroline Picart spricht vor diesem Hintergrund sogar von „Nietzsches unheilbarem Gebärneid [womb envy]“22. Es handelt sich also in gewisser Hinsicht um eine Abwertung, aber eben auch eine Aufwertung und es gibt einen ganz Strang in der weiblich-feministischen Nietzsche-Rezeption, in der sich die Frauen positiv auf diese Seite von Nietzsches Werk beziehen, ausgehend interessanterweise bei Lou Salomé bis hin zur wichtigen differenzfeministischen Theoretikerin Luce Irigaray.23
Aber noch wichtiger für unser Thema ist die Metapher des Kindes. Hier gibt es zahlreiche tiefschürfende Stellen im Werk Nietzsche, die mich als Vater immer wieder inspiriert haben, und die eigentlich nur dadurch zu erklären sind, dass Nietzsche Zeit seines Lebens eben ein ‚großes Kind‘ geblieben ist, sich eine große Kindlichkeit bewahrt hat und aus diesem Grunde eben sehr gut über die Kindheit schreiben konnte, auch wenn ihm die empirische Erfahrung gefehlt hat. Ich denke, um nur eines von zahllosen Beispielen zu nennen, an diesen berühmten Satz aus Jenseits von Gut und Böse: „Reife des Mannes: das heisst den Ernst wiedergefunden haben, den man als Kind hatte, beim Spiel.“24 Das ist natürlich ein spezieller Begriff von „Reife“, aber wenn ich meinen Sohn beim Spielen beobachte, schießt er mir immer wieder durch den Kopf und er besitzt schon auch eine Wahrheit. Kinder sind ja manchmal so unglaublich vertieft in ihre Spiele, sie nehmen sie so wichtig. Der Erwachsene macht sich darüber oft lustig und interpretiert dieses Ernstnehmen des Unwichtigen als kindisch und unreif – doch beneidet er das Kind nicht auch um diese Fähigkeit und sind wir Erwachsenen so anders, wenn wir uns für etwas begeistern?
Und auch zu diesem Aspekt gibt es zahllose Passagen im Zarathustra. Es gibt da etwa eine Stelle aus dem Buch, die auch die schwedische feministische Autorin Ellen Key (1849-1926) ihrem Buch Das Jahrhundert des Kindes (1900), ein Klassiker der Reformpädagogik, als Motto voranstellte:
Eurer Kinder Land sollt ihr lieben: diese Liebe sei euer neuer Adel, – das unentdeckte, im fernsten Meere! Nach ihm heisse ich eure Segel suchen und suchen!
An euren Kindern sollt ihr gut machen, dass ihr eurer Väter Kinder seid: alles Vergangene sollt ihr so erlösen! Diese neue Tafel stelle ich über euch!25
Das könnte man interessanterweise sogar als Plädoyer für die Vaterschaft interpretieren,26 aber es ist vor allem als Plädoyer für die Kindheit zu verstehen. Dass man die Offenheit und Kreativität der Kinder fast schon als Vorbild nehmen soll für eine schöpferische, lebensbejahende Haltung. Und es gibt auch zig Stellen, wo das spielende Kind eigentlich sowohl als Metapher für den schöpferischen Menschen, der auf dem Weg zum Übermenschen ist, als auch für den Übermensch selbst fungiert.27
Klar, das ist ein romantisierendes Verständnis von Kindheit, das man als realer Vater vielleicht auch nicht zu 100 % teilen mag – und Nietzsche weiß darum auch28 –, aber grundsätzlich sind das großartige Sätze, die uns dazu ermuntern sollten, die eigene Kindlichkeit auch als Väter nicht ganz zu verlieren und vielleicht auch von unseren Kindern zu lernen, unsere eigene Kindlichkeit neu zu entdecken, das ist ja auch eine Seite des Vaterseins, oder?
HH: Ja, diese Unvoreingenommenheit oder auch Unverdorbenheit, diese Fähigkeit, sich vollkommen im Spiel zu verlieren, die wir vor allem bei kleineren Kindern beobachten, das findet sich auch in vielen von Nietzsches Texten. Ich glaube, was ihn auszeichnet im Vergleich zu vielen anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern – und ich neige dazu, Nietzsche tatsächlich eher mit besonderen Schriftstellern als mit anderen Philosophen zu vergleichen, ich sehe ihn immer mehr zuerst als Künstler und erst nachrangig als Philosophen: Er hat oft ganz wenig Selbstzensur, ganz wie kleine Kinder. Das erleben wir immer wieder mit unserem sechsjährigen Louis, diese völlige Offenheit selbst Fremden gegenüber in der Mitteilung. Er trifft etwa im Zug eine völlig unbekannte Person und plaudert einfach drauf los über Details aus dem Familienleben, die kein Erwachsener jemals geradeaus einfach so erzählen würde – denn die allermeisten Erwachsenen habe doch eine gewisse Selbstzensur verinnerlicht, wir überlegen uns schon ziemlich genau, was gesagt werden darf und was nicht. Vor allem, wenn wir schreiben, erst recht, wenn es etwas ist, was in Richtung Wissenschaft geht, dann überlegen wir noch genauer, dann arbeitet diese Selbstzensur noch stärker. Ich denke da oft an George Orwells Einsicht, dass diese Selbstzensur noch viel mächtiger ist als die Zensur selbst, also das, was wir selbst herausfiltern, bevor wir einen Text überhaupt abgeben.29
Und das ist das Großartige bei Nietzsche: Natürlich hat er seine Texte sorgfältig überarbeitet, bevor sie in den Druck gingen, aber trotzdem wirken sie so, als ob er geradeaus erzählt, als würde er keinerlei Selbstzensur vornehmen, völlig authentisch sprechen. Und das kann natürlich in beide Richtungen ausschlagen – manchmal bringt ihn diese Offenheit dazu, ganz furchtbare Sachen zu schreiben, manchmal aber auch zu echten Weisheiten und Juwelen. Das ist fast das Größte, was wir von Kindern lernen können.
Und ich mag auch diesen Gedanken aus dem anderen Zitat, dass die Kinder die Erzieher der Erwachsenen sind. Das ist wirklich ein großartiges Motiv. Und ich finde das nicht romantisierend, es ist schon real. Die Herausforderung besteht eben darin, das im Alltag auch authentisch zu leben. Was zum Beispiel unser Louis mit mir oft machen will, weniger mit meiner Frau Rebecca, das ist der von ihm so genannte toy fight, ‚Spielkampf‘. Er will das oft direkt nach dem Aufstehen machen, so gegen halb 7, schon vor dem Frühstück. Das heißt vor allem, schon ziemlich wild auf Papa rumzuspringen. Natürlich gibt es ein paar Spielregeln, also es darf nicht gekratzt, nicht gebissen, nicht an den Haaren gezogen werden und auf bestimmte sensible Bereiche darf man auch nicht hauen – aber bis auf diese vier Grundregeln ist es relativ regellos, man darf mehr oder weniger alles machen und das ist wieder eine Gelegenheit, ein unzensiertes Selbst zu leben, was zur Entwicklung eines authentischen Selbst beitragen kann. Ich denke, das ist schon etwas, was uns, egal, ob wir Väter sind und Kinder haben oder nicht, im Alltag fehlt, weil er so wahnsinnig durchstrukturiert und durchterminiert ist. Und auch die Digitalisierung hat die erhoffte Befreiung nicht gebracht, eher das Gegenteil ist der Fall. Unsere Zeit ist einfach immer mehr ökonomisiert, alles soll planbar sein. Und ich glaube schon, dass uns unsere Kinder die Möglichkeit geben, uns davon, und wenn es nur für 20 Minuten ist, zu befreien, immer wieder zu befreien – und das ist etwas, was ich nicht gerne missen würde.

VII. Noch einmal: Männlichkeit und Weiblichkeit
PS: Ja, dem kann ich mich nur anschließen; ich habe da eine ganz ähnliche Erfahrung. Wo ich gerne nachhaken würde im Hinblick auf das Thema Gender und Geschlechterrollen: Das ist eben auch interessant, wie Kinder schon sehr intuitiv den Eltern verschiedene Rollen zuweisen und an sie unterschiedliche Erwartungen herantragen. Auch bei uns ist so – und das geht nicht, jedenfalls nicht bewusst, von uns aus –, dass von meiner Partnerin und mir sehr verschiedene Dinge erwartet werden. Von mir auch vor allem dieses Kämpfen, das läuft bei uns fast genau so ab, da wird auch immer viel „gekämpft“ – aber das will Jonathan fast nur mit mir machen. Manchmal auch mit Luise – was aber natürlich gerade jetzt, wo sie hochschwanger ist, nicht besonders gut funktioniert –, aber vor allem mit mir will er kämpfen und ‚kämpferische Dinge‘ machen, die eher stereotyp männlich sind, während er mit Luise eher auch mal ausgiebig kuschelt, knutscht, eben eher zärtliche Dinge macht. Bei ihm und mir ist es hingegen so, dass er solche Dinge gar nicht unbedingt machen möchte und mir das auch zu verstehen gibt – was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, selbst wenn es mich mitunter ein wenig kränkt.
HH: Genau auch bei uns gibt es „toy fighting“ nur mit mir, Rebecca sagt da auch einfach „Nein“ und hat keine Lust drauf – dafür macht sie wahnsinnig viele andere Sachen mit Louis. Man kann hier von „Stereotypen“ sprechen, aber man könnte es, philosophisch betrachtet, auch anders nennen. Man könnte ihr etwa den Begriff „Archetyp“ ins Spiel bringen – bewegt sich dann aber gleich auf dünnem Eis. Vielleicht neutraler gesagt: Viele spezifische Verhaltensweisen bleiben gegendert, ob wir das wollen oder nicht, das ist eben unser kulturelles Erbe. Ein konkretes Beispiel: das Stricken. Vielleicht sind die Kreise, in denen ich mich bewege, die falschen und nicht progressiv genug, aber ich kenne keinen einzigen Mann, der strickt. Natürlich habe ich Fotos von solchen Männern gesehen, aber ich kenne keinen. Ich kenne hingegen eine Reihe von Frauen, die stricken – Rebecca etwa strickt sehr gut, sie macht wahnsinnig tolle modische Pullis und sowas, die fast schon Kunstwerke sind. Sie hat auch Louis das Fingerstricken beigebracht, er kann zum Beispiel kleine Schals oder so etwas selber machen – das ist ein ganz reales Können, eine Fähigkeit. Also das sind Fertigkeiten, die von Natur aus keinem Geschlecht angehören, die aber auch kulturellen Gründen nur einem Geschlecht zugeordnet und entsprechend tradiert werden.
Und vielleicht ein weiteres Beispiel anzuführen, auch wenn es vielleicht etwas profan ist: In Großbritannien gibt es die „Ladybird Books“, das sind kleinformatige Bücher für kleine Kinder, vergleichbar vielleicht ein wenig mit den deutschen Pixi-Büchern, die eine Massenauflage gehabt haben. Also alle Mittelschichtskinder in meiner Generation haben die gehabt, die hatten einfach eine gute Qualität und sehr gute Illustrationen – aber viele waren in den 1950er- und 1960er-Jahren geschrieben worden und fallen daher sehr stark in die Gender-Stereotype hinein, sowohl, was die Mädchen und Frauen als auch, was die Jungen und Männer angeht. Da werden wirklich alle Klischees bedient. Kürzlich hat der Verlag, quasi als postmodernen Witz, was rausgebracht, das nennt sich „Ladybirds for Grown-Ups“, für Erwachsene also,30 das nimmt diese ganze Sache etwas auf den Arm, da gibt es etwa ein Buch, das heißt einfach nur The Dad. Da steht der Vater stereotyp am Grill und da steht so etwas wie – die Texte sind wie in echten Kinderbüchern sehr kurz: „Das ist der Papa. Er wirkt kompliziert, doch er lebt einfach nur von Bier und Würsten.“ Mehr steht da nicht. Meine Frau Rebecca und ich finden das tatsächlich sehr witzig, weil wir viele Väter kennen, die wirklich so sind.
Worauf ich hinauswill: Das ist der Zwiespalt, in dem Väter unserer Generation stecken, dass wir immer noch ein starkes kulturelles und soziales Erbe haben – wir sprechen über Jahrhunderte, die sehr stark gegendert waren – und erst seit etwa 40, 50 Jahren versuchen, da herauszukommen, aber das eben nicht gleich auf Anhieb schaffen. Diese einfachen Väter, die nicht oder kaum ihre Gefühle zeigen konnten, geschweige denn, darüber zu sprechen, die in dieser Hinsicht etwas einfach gestrickt waren – die bleiben als Erbe in uns, das es vielleicht zu überwinden gilt.
PS: Ja, mich würden auch keine zehn Pferde zum Stricken bringen, auch wenn ich das mit etwa acht, neun Jahren eine Zeit lang ganz gerne gemacht habe. – Ich wollte aber an dem Punkt vielleicht eine kleine Gegenrede anbringen. Also es gibt, das darf man nicht unerwähnt lassen, auch keinen reinen Biologismus bei Nietzsche. Es gibt zum Beispiel in der Götzen-Dämmerung diese bemerkenswerte Sentenz: „Der Mann hat das Weib geschaffen – woraus doch? Aus einer Rippe seines Gottes, – seines ‚Ideals‘…“31 Und es gibt viele andere solcher Stellen, wo sich zeigt, dass Nietzsche als historisch denkender Mensch schon ein Bewusstsein davon hat, dass Geschlechterrollen durchaus wandelbar sind, ‚sozial konstruiert‘, wie man heute sagen würde.32
Das andere ist, wie bereits angedeutet, dass seine Äußerungen über die Frauen ja gar nicht abwertend gemeint sind. Selbst in Von jungen und alten Weiblein heißt es ja unter anderem auch:
Ein Spielzeug sei das Weib, rein und fein, dem Edelsteine gleich, bestrahlt von den Tugenden einer Welt, welche noch nicht da ist.
Der Strahl eines Sternes glänze in eurer Liebe! Eure Hoffnung heisse: „möge ich den Übermenschen gebären!“
Ähnlich wie das spielende Kind ist eben nicht nur der Mann als „Krieger“, sondern gerade auch die gebärende Frau für ein Sinnbild und leibhaftiger Vorschein des Übermenschen und Zarathustras und sogar sein eigenes Schaffen werden immer wieder mit dem Gebären gleichgesetzt – sogar in dieser Rede selbst. Und dass sich auch der berüchtigte ‚Peitschen-Satz‘ aus dieser Rede im Sinne eines solchen Konstruktivismus interpretieren lässt, sollte ebenso klar sein.33 Doch auch essentialistisch gelesen gibt und gab es eben zahlreiche Frauen und Feministinnen, die sich diese Seite Nietzsches positiv, affirmativ angeeignet haben und sich davon bei ihrer Definition von Weiblichkeit haben inspirieren lassen.
Also meine Position in dieser Hinsicht ist ganz klar, dass es ein Problem ist, wenn es diese repressiven Normen gibt, diese Stereotype, und man den Druck hat, sich dem anzupassen, weil sie einfach die Vielfalt der menschlichen Gattung nicht abbilden und wenig Platz für Abweichung zu lassen. Es ist insofern ein guter Prozess, dass die sich im Augenblick so auflösen und flexibler werden. Aber zur gleichen Zeit muss man aber auch sehen, dass diese Stereotypen nicht nur willkürlich sind, sondern dass es schon so etwas wie ein biologisches Substrat in irgendeiner Form gibt. Dieses ist natürlich schwer zu bestimmen, man wird es wahrscheinlich nie in Reinform definieren können. Aber es gibt ja eben Indizien davor, dass sich dieses stereotype Verhalten schon bei Kleinkindern beobachten lässt und insofern nicht rein anerzogen sein kann. Das ist ein Faktum, über das man bei aller Kritik an den repressiven Geschlechternormen nicht hinwegsehen kann. Ebenso ist es unbestreitbar, dass sich bestimmte Hormone wie insbesondere Testosteron auf das Seelenleben auswirken. Es macht eben etwas mit Menschen, wenn sie von Natur aus einen höheren Testosteronspiegel haben.34
Man muss da einfach aufpassen, und da kommt auch wieder Nietzsche ins Spiel, dass man nicht die eine repressive Moral durch die andere ersetzt. Alle Menschen sollen gleich sein, man darf sich als Mann bloß nicht zu männlich verhalten, als Frau wiederum nicht zu weiblich. Da würde ich schon sagen: Nein, es ist doch ganz in Ordnung, auch mal nach vorgegebenen Stereotypen zu leben. Wieso soll man sich da krampfhaft verbiegen? Das kann durchaus ein Ausdruck von Authentizität sein.
Ganz abgesehen von der Biologie hat es ja auch seinen Sinn, dass es diese Rollenverteilung gibt. Auch homosexuelle Paare können sich von ihr interessanterweise oft nicht lösen und ein Partner nimmt in ihnen eher eine ‚weibliche‘, der andere eine eher ‚männliche‘ Rolle ein. Es geht hier um die Aufteilung bestimmter Aufgaben, wobei man natürlich darauf achten sollte, diese fluide und situativ zu gestalten, so dass sich beide Partner gleichermaßen entfalten können.
HH: Ja, ich pflichte dir da ganz bei, dass es keinen Sinn macht, die eine repressive Moral durch eine andere zu ersetzen. Wobei das in manchen Kreisen als heikel angesehen werden könnte. Dieses ganze Thema der manosphere, also einer bubble im Netz, wo es darum geht, einen neuen Sinn für ‚echte Männlichkeit‘ in Abgrenzung zu ‚wokeness‘ und Feminismus zu kreieren, und die oft als sehr sexistisch und misogyn wahrgenommen wird (und sicher auch in großen Teilen ist), das ist schon ein sehr heißes Eisen geworden. Christian Saehrendt hat sich dieses Thema auf unserem Blog ja schon angenommen in seinem Artikel zur Frage, ob Nietzsche ein „Incel“ war. Wenn überhaupt von Männern und Vätern in der öffentlichen Diskussion gesprochen wird, geht es meist um dieses Thema der „toxischen Männlichkeit“. Aber was ist, wenn man nicht „toxisch“ werden oder bleiben möchte – gibt es einen öffentlichen Raum, um darüber offen zu diskutieren? Manche sind zu der interessanten Ansicht gekommen, dass einige Männer genau deswegen so anfällig dafür sind, auf diese manosphere-Schiene zu geraten, weil es bislang so wenige Modelle gibt für eine gute, nichttoxische Männlichkeit oder Väterlichkeit. Und es ist auch auffallend in dieser gesellschaftlichen Gleichberechtigungsdebatte – die weiterhin geführt werden muss aus guten Gründen –, dass ein Unterkapitel von diesem Diskurs ist, dass sowohl die besten als auch die schlechten Lebensergebnisse im globalen Norden von Männern erreicht werden. Man hat also als Mann zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit, sehr reich oder erfolgreich zu sein – aber auch, Suizid zu begehen, an einer Suchterkrankung zu leiden, jung zu sterben, dass man es einfach nicht gebacken kriegt, sich vernünftig zu ernähren, oder langzeitarbeitslos zu werden – um nur ein paar von den schlechtesten Lebensereignissen zu nennen, die besonders stark mit Männern verbunden sind. Das ist auch ein Teil des Vaterseins, diesen Spagat zu schaffen, ein guter Vater zu sein, ohne bei diesen schlimmsten Ergebnissen zu landen.
Oder, um es nochmal konkreter zu machen: Warum wählen so viele von diesen Männern und Vätern Donald Trump oder rechtspopulistische Parteien? Natürlich wählen ihn auch Frauen, aber es sind doch signifikant mehr Männer. Bei Weitem nicht, weil die alle so gut abgesichert oder privilegiert sind – es ist eher im Gegenteil so, dass Millionen von ihnen so prekär leben, dass sie außerhalb der gesellschaftlichen Mechanismen stehen und gar kein Vertrauen mehr darin haben, ihre eigenen Lebensverhältnisse besser zu gestalten; sie wetten stattdessen auf einen ‚großen Wurf‘, einen ‚Trump-Wurf‘; diese Vorstellung, ein ‚harter Mann‘ zu sein, ein toxischer Mann, der ohne jegliche gesellschaftliche Absicherung durchkommt.
Also es durchaus eine Wette von uns, ein solches Thema wie Vaterschaft öffentlich zu besprechen in einer Zeit, in der der öffentliche Diskurs über Männer vor allem von diesem Begriff der ‚toxischen Männlichkeit‘ geprägt ist – ich hoffe, diese Wette geht gut aus.
PS: Ja, ich nehme es auch so wahr, dass es da ein Vakuum gibt, eine Abwesenheit von Vorbildern einer nichttoxischen, verantwortungsvollen Männlichkeit und Väterlichkeit – was gerade bei jungen Männern zu einer großen Orientierungslosigkeit führt und dazu, dass sie sich zum Ersatz um Möchtegern-‚Übermänner‘ wie Trump, Musk oder gar Putin scharen. Die alten „Götzen“ sind gefallen, aber keine neuen an ihre Stelle getreten – und das führt paradoxerweise gerade zu einer beängstigenden Renaissance solcher pseudoarchaischer ‚barbarischer‘ Gestalten. Doch wir emanzipierten Männer sollten dieses Vakuum, auf ganz nietzscheanische Art, nicht betrauern und auch in keine Nostalgie verfallen, sondern als Chance zu einem kulturellen Neuanfang, zur Schöpfung eines neuen, besseren Verständnisses von Männlichkeit und Väterlichkeit. Dabei sind vor allem wir als Väter gefordert, ein solches Verständnis nicht nur zu predigen, sondern vor allem auch zu leben, unseren Söhnen hoffentlich nicht nur als negative Abstoßfiguren, sondern auch als Vorbilder zu dienen, an denen sie wachsen können – um sich dann natürlich auch wieder von uns abzustoßen, das gehört zum Vatersein ja leider auch dazu.
Mir geht es im Kern darum, dass man sich einfach um eigenes, authentisches Verständnis von Vaterschaft und Männlichkeit – und natürlich entsprechend auch von Mutterschaft und Weiblichkeit – bemühen sollte, das unabhängig von vorhandenen Stereotypen ist. Aber es wäre eben auch unauthentisch, und auch einfach nicht besonders gesund, nicht heilsam für einen selbst, sich jetzt krampfhaft von diesen Stereotypen um jeden Preis freimachen zu wollen – sowohl, was das eigene Selbstverständnis, als auch, was die eigene Erziehungspraxis angeht. Ich nehme in meinem Umfeld da schon solche Tendenzen wahr, dass man zum Beispiel um jeden Preis vermeiden will, dass die Jungen mit Waffen spielen oder sich für Krieg interessieren – und die Mädchen vielleicht genau dazu zwingen möchte. Und die Jungs bringt man dazu, mit Puppen zu spielen. Also das ist jetzt natürlich eine Überspitzung, aber es gibt eben schon derartige Tendenzen, die ich auch wieder nicht gutheißen kann.
Generell finde ich diesen ganzen Diskurs über ‚toxische Männlichkeit‘ nicht unberechtigt. Ich denke, es gibt das. Es gibt übrigens vielleicht auch eine Art ‚toxische Weiblichkeit‘, also stereotype weibliche oder sogar mütterliche Verhaltensweise, die nicht besonders heilsam sind für ihre Umgebung. Sie treten nur subtiler in Erscheinung, etwa in Formen der emotionalen Manipulation und Erpressung. Wobei natürlich die Frage ist: Was heißt ‚toxisch‘ überhaupt? Ist das nicht ein sehr vager Begriff?
Also ich finde es generell gut, dass solche Verhaltensweisen hinterfragt werden, sowohl bei Frauen als auch Männern. Aber zur gleichen Zeit beobachte ich da auch eine gewisse Einsichtigkeit oder sogar Diskriminierung von typisch männlichen Verhaltensweisen, die aber auf jeden Fall zumindest heuchlerisch ist, weil genau diese Verhaltensweisen ja auch ihre soziale Berechtigung haben und in vielen Fällen notwendig sind in der jetzigen Gesellschaft. Auch Leute, die sich sehr stark über typisch männliche Verhaltensweisen aufregen, freuen sich ja vielleicht auch, wenn es einen taffen Polizisten gibt, der sie zur Not verteidigt. Und es wird jetzt viel über eine „Zeitenwende“ und Aufrüstung gesprochen – was ich aus anderen Gründen auch wieder problematisch finde –, aber da muss man halt beides wollen, da kann man nicht sagen, dass man diese männlichen Verhaltensweisen, die man als Soldat nun einmal an den Tag legen muss, sind ganz schlecht und problematisch, aber wir brauchen zugleich viel mehr Soldaten und wenigstens alle Männer – Warum eigentlich nur die? Hat das vielleicht doch auch etwas mit der Biologie zu tun? – sollen wieder Wehrdienst leisten. Also ich sehe da eine gewisse Widersprüchlichkeit in unserer Gesellschaft und in den Debatten zu diesem Thema. Ganz generell gesprochen, sollte man vielleicht einfach mal anerkennen, dass diese typisch männlichen Verhaltensweisen teilweise gar nicht so schlecht sind und eben auch ihr Recht haben, sofern sie nicht in ein bestimmtes Extrem getrieben werden.
Das beste Beispiel ist ja Nietzsche selbst, der ja vielleicht tatsächlich auch irgendwie, wenn man diesen Begriff gebrauchen möchte, ein ‚toxischer‘ oder jedenfalls stereotypen Mann war. Darüber haben wir diskutiert und daran kann man viel kritisieren, aber diese Haltung es ihm wiederum auch ermöglicht, sein großartiges Werk zu schaffen. Ich glaube ja, dass es auch dem Werk gutgetan hätte, wenn Nietzsche seine eigene Männlichkeit stärker hinterfragt hätte – aber wäre es wirklich zustande gekommen ohne den infantilen Narzissmus, den Nietzsche kultivierte?
Und auch bei mir selbst bemerke ich, dass ich zunehmend, auch wenn das teilweise meinem Naturell gar nicht entspricht, in so eine männliche Rolle getrieben werde, die ich so definieren würde, dass man einen etwas anderen Erziehungsstil hat, dass man in bestimmten Stresssituationen eher derjenige ist, der ruhig bleibt und klare Ansichten macht. Ich glaube, das ist schon etwas, was einfach gebraucht wird, was man dann vielleicht als Mann auch leisten muss. Klar, zum einen versage ich oft genug darin, zweitens gibt es auch Situationen, in denen meine Partnerin diesen Part übernimmt, aber ich glaube, diesen Part, diesen vielleicht leicht ‚autoritären‘ Part, braucht es halt manchmal schon, und es käme dann vielleicht eher darauf an, dass man diesen männlichen Part auf eine nichttoxische und verantwortungsvolle Weise einnimmt, aber auch nicht vollkommen von sich weist. Ich glaube, dass diese neue ‚postmoderne Post-Männlichkeit‘ teilweise etwas sehr Infantiles hat, also auch wieder eine ‚toxische‘ Männlichkeit auf andere Art – auf Nietzsches Art. Da bleibt man eigentlich ein Kind, man gibt Verantwortung ab, man will um keinen Preis mehr ‚autoritär‘ sein oder etwa durch eine zu laute Stimme auffallen oder so etwas, man spricht ganz leise, macht die Beine nicht breit beim Sitzen … Also dieses Infantile wird verknüpft mit einer extrem moralischen und selbstverneinenden Haltung. Das ist auch wieder eine einseitige Entwicklung, eine Flucht vor der Verantwortung und auch vor der Authentizität, denn ich nehme es durchaus so wahr, dass solche Männer auch in keinem authentischen Selbstverhältnis stehen, sondern eben eine Seite von sich selbst künstlich verdrängen, die sie vielleicht stärker ausleben sollten. Man sollte den ‚inneren Mann‘, den ‚inneren Vater‘ in sich wertschätzen lernen – das ist vielleicht unsere Aufgabe in der jetzigen Situation.
HH: Wäre das nicht ein gutes Schlusswort für unser Gespräch?

VIII. „Wie die Kinder werde!“
PS: Etwas würde ich vielleicht noch einbringen. Wir haben ja viel über Lou Salomé gesprochen und über Nietzsche – da liegt es vielleicht nahe, auf den Dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926) einzugehen, der etwa eine Generation jünger als Nietzsche war und witzigerweise mit Lou Salomé nicht nur befreundet war, sondern vielleicht das geschafft hat, von dem Nietzsche geträumt hat, also in einer Beziehung mit ihr war. Witzigerweise nahm er in dieser auch wieder eher die Rolle eines ‚großen Kindes‘ ein und Lou eine mütterliche – das ist bei Dichtern und Denkern ja vielleicht gar nicht mal so selten. Von ihm gibt es jedenfalls ein großartiges Gedicht, in dem er diese Haltung des Kindlichwerdens in sogar noch lyrischeren und beeindruckenderen Worten als Nietzsche zum Ausdruck bringt, und damit würde ich unser Gespräch sehr gerne ausklingen lassen:
Träume, die in deinen Tiefen wallen,
aus dem Dunkel lass sie alle los.
Wie Fontänen sind sie, und sie fallen
lichter und in Liederintervallen
ihren Schalen wieder in den Schoß.
Und ich weiß jetzt: wie die Kinder werde.
Alle Angst ist nur ein Anbeginn;
aber ohne Ende ist die Erde,
und das Bangen ist nur die Gebärde,
und die Sehnsucht ist ihr Sinn –35
Das ist doch vielleicht ein gutes Schlusswort: „Und ich weiß jetzt, wie die Kinder werde.“ Aber vielleicht muss man teilweise dann doch auch mehr Verantwortung übernehmen – das ist dann aber wieder die philosophische Ebene.
HH: Dem kann ich mich sehr anschließen. Vielen Dank, Paul, für dieses erhellende Gespräch.
Das Artikelbild ist ein Gemälde von Felix Nussbaum aus dem Jahr 1931, Leierkastenmann. Fotograf: Kai-Annett Becker. Quelle: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/6CQPR6PYR3GSAEFLYDCJDO7VC7ZKNCK7
Literatur
Wer ist der „homo sovieticus“? Ein Dialog der Narthex-Redaktion mit Vitalii Mudrakov. In: Narthex. Heft für radikales Denken 6 (2020), S. 56-63.
Diethe, Carol: Vergiss die Peitsche. Nietzsche und die Frauen. Übers. v. Michael Haupt. Hamburg & Wien 2000.
Key, Ellen: Das Jahrhundert des Kindes. Übers. v. Francis Maro. Berlin 1905.
Kimmel, Michael S.: Masculinity as Homophobia. Fear, Shame, and Silence in the Construction of Gender Identity. In: Harry Brod (Hg.): Theorizing Masculinities. Thousands Oaks 1994, S. 119-141.
Orwell, George: Farm der Tiere. Ein Märchen. Übers. v. Ulrich Blumenbach. München 2021.
Picart, Caroline: Classic and Romantic Mythology in the (Re)Birthing of Nietzsche's Zarathustra. In: Journal of Nietzsche Studies 12 (1996), S. 40-68.
Prideaux, Sue: Ich bin Dynamit. Das Leben des Friedrich Nietzsche. Übers. v. Thomas Pfeiffer und Hans-Peter Remmler. Stuttgart 2021.
Rilke, Rainer Maria: Gedichte 1895 bis 1910. Werke Bd. 1. Hg. v. Manfred Engel & Ulrich Fülleborn. Frankfurt a. M. & Leipzig 1996.
Stephan, Paul: Links–Nietzscheanismus. Eine Einführung. 2 Bd.e. Stuttgart 2020.
Ders.: »Vergiss die Peitsche nicht!«. Eine Untersuchung der Metapher des »Weibes« in Also sprach Zarathustra. In: Murat Ates (Hg.): Nietzsches Zarathustra Auslegen. Marburg 2014, S. 85-112.
Wagner, Richard: Brief an Nietzsche v. 25. 6. 1872 (Nr. 333). In: Briefe an Friedrich Nietzsche Mai 1872 – Dezember 1874. Kritische Gesamtausgabe Briefwechsel Bd. II/4. Hg. v. Giorgio Colli & Mazzino Montinari. Berlin & New York 1978, S. 29 f.
Ders.: Brief an Nietzsche v. 24. 10. 1872 (Nr. 372). In: Ebd., S. 102-106.
Fußnoten
1: Stand 20. 12.: Unsere Tochter lässt sich immer noch Zeit.
2: Aph. 108.
3: Also sprach Zarathustra, Von alten und jungen Weiblein.
4: So heißt es auch an anderer Stelle: „Wir Männer wünschen, dass das Weib nicht fortfahre, sich durch Aufklärung zu compromittiren: wie es Manns-Fürsorge und Schonung des Weibes war, als die Kirche dekretirte: mulier taceat in ecclesia!“ (Jenseits von Gut und Böse, Aph. 232) Und unter Bezug auf die erwähnte berüchtigte Passage aus Zarathustra schreibt er in Ecce homo: „‚Emancipation des Weibes‘ – das ist der Instinkthass des missrathenen, das heisst gebäruntüchtigen Weibes gegen das wohlgerathene“ (Warum ich so gute Bücher schreibe, Abs. 5).
5: Also sprach Zarathustra, Von alten und neuen Tafeln, 23.
6: Menschliches, Allzumenschliches II, Vorrede, Abs. 3.
7: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 232.
8: Man findet diese Konzeption von Männlichkeit auch in der Philosophie, vor allem bei Hegel in seinen Grundlinien der Philosophie der Rechts (1820), dieser furchtbaren Apologie des unauthentischen Menschen, der seine „wahre Freiheit“ im Opfer findet, sei es als „Marktplatzmann“ – ein Begriff der kritischen Männlichkeitsforschung (vgl. Michael S. Kimmel, Masculinity as Homophobia) –, sei als treuer Bürokrat im Staatsdienst, sei es, in seiner höchsten Form, als Soldat, der fürs „Vaterland“ fällt. Der Soldat und der „Krieger“ – da treffen sich seltsamerweise Hegel und Nietzsche, auch wenn es bei Nietzsche da ja eher um den resoluten Willen zur Selbstverwirklichung geht. Noch im 18. Jahrhundert, man denke nur an Rousseaus Émile (1761), dieses große Plädoyer für einen aktiven Vater als verantwortungsvollen Erzieher der Kinder, dachte man darüber noch ganz anders – doch genau gegen dieses Bild vom sorgenden Vater wandte sich Nietzsche ja, wenn er von der „Verweichlichung“ Europas spricht!
9: Vgl. hierzu Wer ist der „homo sovieticus“?
10: Zur Genealogie der Moral, Abs. III, 7.
11: Hinzu kommt eine, allerdings sehr früh verstorbene, Tochter. Für seinen unehelichen Sohn übernahm Hegel zumindest zeitweilig die erzieherische Verantwortung.
12: Hinzu kommt möglicherweise ein unehelicher Sohn.
13: Der Extremfall ist vielleicht Rousseau, der zwar, wie erwähnt (vgl. Fn. 8), die Idee einer engagierten Vaterschaft verfocht – freilich idealerweise nur mit einem Kind –, seine eigenen Kinder jedoch ausnahmslos ins Waisenhaus gab.
14: Vgl. den Bericht von Emma Schunack auf diesem Blog (Link).1
15: Aus meinem Leben, Die Jugendjahre.
16: Hier genüge der Hinweis, dass es alles andere als ausgemacht ist, dass Nietzsche sich für Frauen überhaupt in sexueller Hinsicht interessierte. Vgl. Dionysos ohne Eros von Christian Saehrendt und das Interview, das ich mit Andreas Urs Sommer über dessen neue Nietzsche-Biographie geführt habe.
17: Zu Nietzsches zeitweiligen Bemühungen um eine Ehefrau vgl. Christian Saehrendts Artikel Dionysos ohne Eros auf diesem Blog. Allerdings gilt es hier hervorzuheben, dass eigentlich nur ein Antrag an eine Frau, die junge Russin Mathilde Trampedach, eindeutig belegt ist. Wie der Kommentator „Rafael“ zu Recht darlegt, gibt es berechtigte Zweifel an der in der Forschung immer wieder vertretenen These, Nietzsche habe, je nach Variante, ein, zwei oder gar drei Mal um Lou Salomés Hand angehalten. Für diese Erzählung gibt es nämlich keinerlei zeitgenössischen Beleg, sie stützt sich fast ausschließlich auf Salomés eigene Autobiographie (vgl. dazu auch ausführlicher diesen Blogartikel). – An Nietzsches jedenfalls zeitweiligem Wunsch sich zu vermählen besteht kein Zweifel (vgl. etwa Bf. an Malwida von Meysenbug v. 25. 10. 1874). Seiner Schwester berichtet er am 25. 4. 1877 von dem Plan, eine „nothwendig vermögliche[] Frau“ zu heiraten, um seine beschwerliche Professur aufgeben zu können (Link). Er erhofft sich von einer Ehe in jener Zeit, so in einem Brief an Meysenbug vom 1. 7. 1877, eine „Milderung [s]einer Leiden“. Später schreibt er an Franz Overbeck – ironischerweise kurz, bevor er Lou Salomé persönlich kennenlernt, angesichts seines sich verschlechternden Gesundheitszustands: „Nun müssen mir meine Freunde noch eine Vorlese-Maschine erfinden: sonst bleibe ich hinter mir selber zurück und kann mich nicht mehr genügend geistig ernähren. Oder vielmehr: ich brauche einen jungen Menschen in meiner Nähe, der intelligent und unterrichtet genug ist, um mit mir arbeiten zu können. Selbst eine zweijährige Ehe würde ich zu diesem Zwecke eingehen“ (Bf. v. 17. 3. 1882). An Overbeck berichtet er später, seine Mutter wolle ihn verheiraten, um ihm eine „fürsorgliche Pflegerin“ zu verschaffen (Bf. v. 6. 10. 1885) – doch er hat zu diesem Zeitpunkt mit dieser Idee schon abgeschlossen, schrieb er doch an seine Mutter selbst Ende April desselben Jahres: „Meine liebe Mutter, Dein Sohn eignet sich schlecht zum Verheirathet-werden; unabhängig sein bis zur letzten Grenze ist mein Bedürfniß, und ich bin für meinen Theil äußerst mißtrauisch geworden in diesem Einen Punkte. Eine alte Frau, und noch mehr ein tüchtiger Diener wäre mir vielleicht wünschenswerther“ (Link). – Diese Briefe bezeugen Nietzsches eher pragmatisches Verhältnis zum Thema Ehe, wobei man, wie Carol Diethe argumentiert (vgl. Vergiss die Peitsche, S. 38), derartige Äußerungen immer cum grano salis nehmen sollte, zeigt sich Nietzsche in seinen Briefen doch oft als großer Ironiker. Er betont zumal immer wieder auch, dass eine Ehe auf Freundschaft gründen soll und gibt seinem Abscheu über die gängigen „Conventionsehe[n]“ (Bf. an Carl v. Gersdorff v. 15.04.1876) Ausdruck. Er sucht zumal klar nach einer gebildeten Frau und keinem ‚netten Dummnchen‘.
18: Nachgelassene Fragmente 1881 16[19].
19: Vgl. Ich bin Dynamit.
20: Vgl. Richard Wagner, Brief an Nietzsche v. 25. 6. 1872 & Brief an Nietzsche v. 24. 10. 1872.
21: Dass er es beim ersten Mal ignorierte, folgt implizit daraus, dass Wagner sich genötigt sah, den Vorschlag überhaupt zu wiederholen. Doch in dem überlieferten ausführlichen Antwortbrief auf diesen wiederholten Vorschlag geht Nietzsche auf diese Offerte mit keiner Silbe ein, so als hätte er sie ‚überlesen‘ (vgl. Brief an Richard Wagner v. Mitte Nov. 1872, Nr. 274).
22: Classic and Romantic Mythology in the (Re)Birthing of Nietzsche’s Zarathustra, S. 41. Übers. PS.
23: Vgl. hierzu Diethe, Vergiss die Peitsche und auch die entsprechenden Kapitel in Paul Stephan, Links–Nietzscheanismus.
24:Aph. 94.
25: Von alten und neuen Tafeln, Abs. 12.
26: Generell gibt es im Zarathustra das Ideal der Ehe als Symbiose, um gemeinsam das Kind als Projekt der gemeinsamen „Selbstüberwindung“ zu realisieren (vgl. insbesondere die Rede Von Kind und Ehe).
27: Vgl. insbesondere die zentrale Reden Von den drei Verwandlungen und Von den Tugendhaften.
28: Vgl. seine eher skeptischen Erwägungen in Menschliches, Allzumenschliches, Bd. II, Der Wanderer und sein Schatten, Aph. 265.
29: Vgl. den als Vorwort zu Farm der Tiere entworfenen Text Die Pressefreiheit (Link zum Original).
30: Vgl. die Verlagswebseite.
32: Niemand geringerer als Simone de Beauvoir zitiert diese Stelle etwa zur Untermauerung ihrer konstruktivistischen Position in Das andere Geschlecht (vgl. Links–Nietzscheanismus, Bd. 2, S. 354) und auch Judith Butler bezieht sich in ihrem radikalen Konstruktivismus immer wieder auf Nietzsche (vgl. ebd., S. 473-478). Feminismen aller Spielarten können sich in Nietzsches Schriften wiedererkennen. (Vgl. dazu auch ebd., Bd. 1, S. 50-55.) Das Seltsame an Nietzsches bisweilen essentialistisch anmutenden Äußerungen zum Thema ‚Mann und Weib‘ ist ja gerade, dass sie in einem offenkundigen Gegensatz zu seinem prinzipiellen Antiessentialismus stehen – und er weiß darum, wenn er etwa in Jenseits von Gut und Böse betont, dass es sich bei diesen Ansichten um „meine Wahrheiten“ handelt (Aph. 231).
33: Vgl. hierzu ausführlich Stephan, »Vergiss die Peitsche nicht!«.
34: Man denke nur an die einschlägigen Berichte von Menschen, die sich entsprechenden Hormontherapien unterzogen haben.
35: Gedichte 1895 bis 1910, S. 72.
Vater sein mit Nietzsche
Ein Gespräch zwischen Henry Holland und Paul Stephan
Nietzsche hatte mit großer Gewissheit keine Kinder und äußert sich in seinem Werk auch nicht besonders freundlich zum Thema Vaterschaft. Der freie Geist ist für ihn ein kinderloser Mann, die Erziehung der Kinder die Aufgabe der Frauen. Gleichzeitig dient ihm das Kind immer wieder als Metapher für den befreiten Geist, als Vorahnung des Übermenschen. Vermag er dadurch heutige Väter vielleicht doch zu inspirieren? Und kann man gleichzeitig Vater und Nietzscheaner sein? Henry Holland und Paul Stephan, beide Väter, diskutierten über diese Frage.
Das komplette, ungekürzte Gespräch haben wir parallel auch auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie publiziert (Teil 1, Teil 2).
